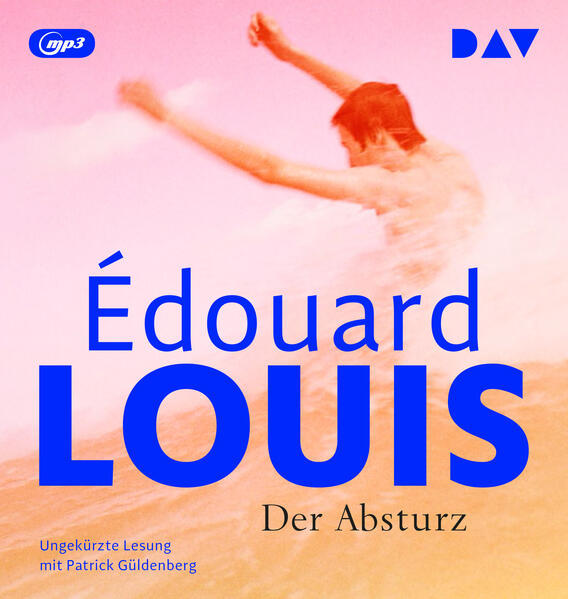Besprechung vom 12.10.2025
Besprechung vom 12.10.2025
Wie Klasse Wünschen Grenzen setzt
Nach dem Vater und der Mutter ist im neuen Buch des Schriftstellers Édouard Louis jetzt der Bruder dran: "Der Absturz"
Von Lorenz Füsselberger
Edouard Louis schreibt gerne über Édouard Louis, über seine Familie, seinen Vater, gleich zwei Bücher über die Mutter und jetzt auch seinen Bruder. Nachdem 2015 "Das Ende von Eddy" erschien, in dem Louis schilderte, wie er in Nordfrankreich als Kind der verarmten französischen Arbeiterklasse aufwuchs, war das der erste in einer Reihe autobiographischer Romane. Nun ist die deutsche Übersetzung des siebten und letzten Stücks seines Mosaiks an Familiengeschichten erschienen: "Der Absturz". Darin arbeitet Louis die Geschichte seines namenlosen älteren Bruders auf und beginnt damit am Tag von dessen Tod: Am Telefon teilt seine Mutter ihm mit, der Bruder sei im Krankenhaus und sein Körper könne nur noch maschinell am Leben gehalten werden. Rückblickend erzählt Louis den stetigen Verfall seines Bruders seit der Jugend, schildert episodenhaft dessen Abstieg, geprägt von Armut, Demütigung, Gewalt, Perspektivlosigkeit und Alkoholismus.
Dabei macht er schon zu Beginn klar, dass er und sein Bruder kein gutes Verhältnis hatten und Louis sich vor allem an seine Grausamkeit erinnert. Beispielhaft dafür ist eine Übernachtung in der Wohnung des Bruders am Tag vor Édouards erster Abiturklausur. Louis, der damals noch bei seinen Eltern wohnt, vereinbart mit seinem Bruder, bei ihm schlafen zu dürfen, um vor den Klausuren einen kürzeren Schulweg zu haben. In der ersten Nacht betrinkt sich der Bruder, lässt Louis nicht schlafen, worin dieser einen grausamen Sabotageversuch seines Bildungserfolgs sieht. "Meinen Bruder kennenzulernen, bedeutete, ihn hassen zu lernen", sind die Worte, mit denen der Autor diese Erzählung einleitet.
Erklärungsversuche für das Schicksal seines Bruders sucht Édouard Louis in der Soziologie und der Psychoanalyse, was nicht verwunderlich ist. Louis studierte Soziologie, vor allem das Werk Pierre Bourdieus, und wurde zu einem engen Freund des Soziologen Didier Eribon. Typisch für Louis' Schreiben ist seine Analyse der Wirkmechanismen sozialer Determination auf die Individuen einer verarmten französischen Arbeiterklasse. Anschaulich wird das in der Theateradaption seines Romans "Wer hat meinen Vater umgebracht?" an der Berliner Schaubühne, in der Louis zum Ende die Bilder der ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy und Emmanuel Macron von einer Leine reißt und ihr politisches Erbe für den Tod seines Vaters verantwortlich macht.
In seinem neuen Roman vollzieht sich in diesem Punkt eine Wandlung seines Denkens. Zusätzlich zu der sozialen Determination als Erklärung für den Abstieg seines Bruders wendet sich Louis dessen Träumen und deren Kollision mit seiner Klasse zu. Die Klassenzugehörigkeit einer Person begrenzt auch ihre Wünsche. So schildert Louis, wie sein Bruder als junger Erwachsener eine prestigeträchtige Ausbildung zum Restaurator machen wollte. Wegen seiner Unzuverlässigkeit, der hohen Kosten und der Einwände des Vaters konnte er diesen Wunsch nicht realisieren, "denn in unserer Welt darf man sich nicht ausprobieren".
Louis - das zieht sich durch all seine Bücher - versteht die soziale Determination als totalitär. Er neigt dazu, seinen Protagonisten jeglichen Handlungsspielraum abzusprechen und diese als reine Vertreter sozialer Kategorien zu verstehen. Passend dazu tragen Louis' Protagonisten meist keine Namen. Der Vater und der Bruder begegnen den Lesenden immer nur in ihrer Rolle innerhalb sozialer Verhältnisse, als Vater, Bruder, Sohn, Ehemann oder Arbeiter. Neu an diesem Roman ist jedoch, dass die Imagination, soziale Grenzen zu überwinden, nicht als Teil, sondern als Fehler des Systems begriffen wird. Eine gewagte These. Gehören die vorgeblichen Aufstiegsmöglichkeiten nicht zu den die sozialen Ordnungen maßgeblich stabilisierenden Mechanismen?
In der Mitte des Romans findet der Bruder eine Anstellung. Sein Chef wählt ihn sogar als Erben aus. Dann scheitert die Beziehung am Alkoholismus des Bruders. Eine mögliche Depression des Bruders wird angedeutet, das Zusammenspiel von psychischer Gesundheit, Klasse und Männlichkeit allerdings kaum entfaltet. Was heißt es, psychisch krank zu sein, wenn es innerhalb einer Klasse kein Bewusstsein und keine Sprache für Depression gibt? Und wie beeinflusst eine Vorstellung von Männlichkeit, die sich durch die Abgrenzung von allem Weiblichen, Schwulen und Gefühlvollen profilieren muss, die Psychologie einer Person? Louis greift die patriarchale Männlichkeit des Bruders wiederholt auf, schildert dessen verbale Attacken gegen queere Männer. Untermauert wird dies durch den Bericht einer seiner Ex-Freundinnen: Demnach habe der Bruder eine Obsession mit Louis' Homosexualität entwickelt, diese immer wieder besprochen, sie bedauert und als Schande für die Familie verstanden. Er habe sogar gedroht, ihm "die Homosexualität aus dem Leib prügeln" zu wollen, obwohl Louis, für den Bruder unerreichbar, da schon längst in Paris lebte.
Gerade an diesen Stellen wird ersichtlich, inwiefern Louis' Wahrheitssuche anhand von Soziologie und eigener Familiengeschichte an ihre Grenzen stößt. Er selbst nennt sein Schreiben einen Nachbau der Realität im Roman, durch die er seine Wahrheit zutage bringe. Im Fall von "Der Absturz" kommt jedoch das Gefühl auf, dass dieser Nachbau nur stellenweise glückt und die finale Zusammenführung der verschiedenen Elemente nicht aufgeht. So versucht Louis ein facettenreiches Bild des Bruders zu zeichnen, indem er dessen Ex-Freundinnen und die gemeinsame Mutter zu Wort kommen lässt. Neben Szenen der häuslichen Gewalt erzählen diese auch von einer sanften, menschlichen Seite. Der Bruder habe etwa der Tochter einer seiner Ex-Freundinnen von seinem halben Monatslohn Schuhe gekauft, obwohl diese viel zu teuer gewesen seien. In welchem Verhältnis diese Schilderungen zum "Absturz" stehen, bleibt aber unklar.
Auch die Struktur des Buchs verliert sich in vielen losen Enden. Es besteht aus unzähligen Kapiteln, die "Fakten" genannt werden, "Einschübe" und "Bemerkungen". Vor allem die Absätze, in denen Themen angeschnitten werden, die nach wenigen Zeilen aber wieder ins Leere laufen, tragen weniger zur Form als zur Zersplitterung des Buchs bei. An anderen Stellen wiederum erzeugt die Verwendung von Interviews und "Einschüben" den Eindruck einer Materialsammlung, die kuratiert, jedoch nicht ausgewertet worden ist. Ähnlich verhält es sich mit Zitaten von Joan Didion, Michel Foucault oder Sigmund Freud. Was an manchen Stellen sorgfältig in den Text eingearbeitet wurde, erweckt andernorts eher den Anschein einer Annotation als den eines eingewobenen Gedankens.
Die Bücher von Édouard Louis riefen zu Beginn seiner Karriere ein Staunen hervor. Was der junge Autor da an Lebenserzählungen ausbreitete, mit welchen sprachlichen Mitteln er vom Prekariat erzählte, den Versuchen eines jungen schwulen Mannes, sich den Verhältnissen anzupassen, wie er Gewalt analysierte - all das war atemberaubend neu. Acht Jahre später ist daraus, so hat man den Eindruck, eine Masche geworden: Was man in "Der Absturz" vorfindet, ist erneut eine Geschichte seiner Biographie, seiner Familie, der Gewalt. In einem Interview hat Édouard Louis zuletzt gesagt, dass für ihn jetzt das Ende seiner Familiengeschichten gekommen sei, er wolle sich anderen Themen widmen: Freundschaft, Liebe und Sexualität. Man darf gespannt sein und auch ein wenig hoffnungsvoll.
Édouard Louis, "Der Absturz". Aus dem Französischen von Sonja Finck. Aufbau, 222 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.