 Besprechung vom 07.02.2021
Besprechung vom 07.02.2021
So hyper wie lange nicht
Mehr als eine Geschichte: Hengameh Yaghoobifarahs Debütroman "Ministerium der Träume" steht unter Hochspannung.
Zwei Schwestern, Anfang der achtziger Jahre in Lübeck, die jüngere ist gerade eingeschult worden, die andere etwas älter. Ihre Mutter versteinert in Trauer und verzweifelter Selbstbehauptung - weil der Vater, der seine Familie nach Deutschland vorausgeschickt hatte, aber noch in Teheran geblieben ist, hingerichtet wurde. Das haben die drei anderen gerade erfahren, und jetzt sitzt die überlebende Familie Behzadi in einer winzigen Wohnung voller Möbel vom Flohmarkt in Norddeutschland und versucht, irgendwie klarzukommen.
Die Mutter versteckt sich vor dem laufenden Fernseher. Oder hört Musik und weint dabei. Die Schwestern beißen die Zähne zusammen. Einmal dann kommt die ältere, Nasrin, ins Zimmer zur jüngeren, Nushin, die mit billigen, geschenkten Buntstiften Bilder ihrer Familie zeichnet. Und immer wieder die gleichen, geschwungenen Bögen aufs Papier presst. Habt ihr einen neuen Buchstaben gelernt, fragt Nasrin. Was meinst du, antwortet Nushin. "Ich dachte, du hast das M gelernt und übst gerade", sagt Nasrin. "Das sind doch keine Ms!", sagt Nushin, während sie weiter den Stift aufs Papier presst, Bogen um Bogen. "Das sind Vögel!"
Achtundachtzig Seiten sind an dieser Stelle schon im Debütroman von Hengameh Yaghoobifarah vergangen, der "Ministerium der Träume" heißt. Die Geschichte hat bis hierhin schon Ortswechsel (Teheran, Lübeck, Berlin) und Zeitsprünge (1981, 1983, 1984, die Zehnerjahre) erlebt und wird, im Verlauf der dramatischen Ereignisse, noch weitere Stationen sehen: vor allem das Lübeck der frühen Neunziger, als in der gerade wiedervereinten Bundesrepublik rassistische Mordanschläge und Übergriffe auf Migrantinnen und Migranten sich häuften.
Aber in dieser kurzen Szene - zwei geflüchtete Mädchen, die eine zeichnet Zeichen von Dingen, die sie fürchtet, Vögel zum Beispiel, die andere versucht, diese Zeichen zu entziffern und zu verstehen - kommt zusammen, was den Roman ausmacht, antreibt, umtreibt: das Trauma von Flucht, Gewalt und heimatlosem Alltag an einem neuen Ort, der nicht zum Zuhause wird. Dann die Dysfunktionalität einer Familie, die sich aneinanderklammert, obwohl es die Mutter und ihre Töchter in ihrem Schmerz auseinandertreibt, und auch in der Frage, wie sie auf das Land sehen, in das sie geflüchtet sind: Die Mutter fordert Dankbarkeit und Wohlverhalten ein, die Töchter packt immer wieder die Wut der Zurücksetzung.
Und dann, vor allem, und das ist, was diesen Roman beispielhaft macht: eine bis auf Gestalt und Wirkung von Buchstaben reichende Auseinandersetzung mit den Zeichen, die eine Beschreibung der Welt ermöglichen - und mit der Frage, ob die Buchstaben des Alphabets, ob Codes und Idiome und Dialekte dazu noch ausreichen oder nicht permanent erweitert werden müssen, um alle unterschiedlichen Erfahrungen zu erfassen, mitteilbar und entzifferbar zu machen.
Die Antwort gibt Hengameh Yaghoobifarah nicht allein in diesem Roman, sondern mit diesem Roman: der eine Geschichte erzählt und gleichzeitig reflektiert, wie sie erzählt wird. Der mit literarischer Sprache erst mal Verhältnisse öffnet, damit man von ihnen lesen kann, sogar im Lesesessel bei einer Tasse Tee, sozusagen. Eine Buchsprache, die diskriminierende Erfahrungen markiert und dabei überwindet, die anprangert, aber auch eine Handlung erzeugt und zusammenhalten will.
Im Text, der daraus entsteht, arbeiten die Ebenen oft unmittelbar nebeneinander und gegeneinander: Beschreibung von Schauplätzen ("Auf dem Volksfestplatz war Jahrmarkt") und das, was man Jugendsprache nennt ("Wir fanden Volksfest panne, aber irgendwie auch geil"). Songzitate ("If you're looking for devotion, talk to me"). Importierte englische Idiome ("ich war so hyper wie lange nicht") und kommentierende Pointen ("In einer Welt, die in ihrem Kern haram war, konnte kein Leben halal sein. Schweinefleisch hätte trotzdem keiner von uns angerührt. Wir waren auf Adorno hängengeblieben, aber eben nicht konsequent genug."). Metaphorisierung ("Der Klang seiner Stimme kratzte etwas in mir wie ein Rubbellos auf.") und Kolumnismus ("Obst sollte aufhören, sich als Nachtisch zu inszenieren."). Lakonische, bittere Selbstironie ("Wir waren nie die coolen Leute.") gegen die kalte Verachtung der Rassisten ("Augen nach vorne, Kümmelfotze.").
Und das waren jetzt nur einige Zitate aus den Seiten 211 bis 218. Lübeck, 1995: Nasrin, die Erzählerin, ist da noch Teenager und erlebt am eigenen Leib die Konfrontation mit rechtem Terror, die allgegenwärtig in diesem Buch ist, das eine Möglichkeit migrantischer Selbstorganisation gegen diesen Terror durchspielt, in vollem Ernst. Immer wieder flackern Nachrichten von den rassistischen Morden der NSU durch die zurückblickenden Passagen des Romans. Nur ist von der NSU damals noch gar nicht die Rede. Und doch spüren Nasrin, ihre Freundinnen und Freunde die Gefahr rechten Terrors am eigenen Leib. Und beginnen, sich zusammenzuschließen.
Denn während sprachlich so viel in diesem Buch passiert, spitzt sich die Geschichte von Nasrin und Nushin über immer neue Rückblenden hinweg mehr und mehr zu einer Art Thriller zu. Nushin, erwachsen geworden, Mutter geworden, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Wenn es ein Unfall war.
Dieser Roman steht doppelt unter Spannung, einmal, weil seine dramatische Geschichte auf eine Lösung zusteuert, wie war es, wer war es? Und dann, weil er aber mehr erreichen will, als eine Geschichte zu erzählen. Er versucht, das auf dem aktuellen Stand identitätspolitischer Selbstbewusstheit zu tun - und da sich erst seit einiger Zeit diese Art des Erzählens auch in Publikumsverlagen zu etablieren beginnt ("Ministerium der Träume" erscheint bei Blumenbar), erschließt sich der Roman also seine literarische Sprache erst einmal selbst. Er erscheint zeitgleich mit einer Zahl von Neuerscheinungen dieses Frühjahrs, "Identitti" von Mithu Sanyal (Hanser) gehört auch dazu, die, auch wenn man sie nicht vereinnahmen kann oder sie aufeinander verweisen, auf einen Umbruch schließen lassen.
"Ministerium der Träume" ist, wie gesagt, der Debütroman von Hengameh Yaghoobifarah, geboren 1991 in Kiel. Yaghoobifarah gehört zur Redaktion des feministischen "Missy"-Magazins, hat einen Podcast ("Auf eine Tüte") und schreibt eine Kolumne für die "taz". Das Erscheinen des Romans hat der Verlag jetzt um zwei Wochen vorgezogen, denn das Interesse ist groß.
Im vergangenen Sommer hatte Yaghoobifarah mit einer satirisch hart die deutsche Polizei angehenden "taz"-Kolumne eine heftige Kontroverse über Meinungs- und Kunstfreiheit ausgelöst. Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd und den Protesten der amerikanischen "Black-Lives-Matter"-Bewegung gegen Polizeigewalt hatte Yaghoobifarah damals in der "taz"-Kolumne eine Zukunft ohne Polizei imaginiert - wohin aber dann mit all denen, die für sie arbeiten? Im Text landete, als einzige, letzte Option, die arbeitslose deutsche Polizei: auf der Mülldeponie. "Nicht als Müllmensch mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten."
Die darauf explodierende Kontroverse erschütterte nicht nur die "taz", die ihre Lagerdiskussionen um den Umgang mit den identitätspolitischen Positionen (wie darf wer über was schreiben oder darüber urteilen?) nach außen trug: Sie beschäftigte auch die Bundesregierung. Innenminister Seehofer kündigte in der "Bild" an, Strafanzeige wegen Beleidigung und Volksverhetzung zu stellen, tat das aber nach einem Gespräch mit der Kanzlerin doch nicht. Die Verfassungsexperten in Seehofers Ministerium kamen offenbar zum Schluss, dass Yaghoobifarahs Kolumne von der Meinungs- und Kunstfreiheit gedeckt sei. Der Presserat wies Beschwerden gegen den Text später ebenfalls zurück. Bis heute bekommen Yaghoobifarah und die aus Iran eingewanderten Eltern Morddrohungen. Bei Lesungen begleitet Hengameh Yaghoobifarah Personenschutz.
Diese Polizei-auf-den-Müll-Kolumne ist der eine Text, mit dem Yaghoobifarah seit Abdruck identifiziert wird (dass Yaghoobifarah sich kurze Zeit später für das Luxuskaufhaus "KaDeWe" fotografieren ließ, hat dem Ruf nicht geholfen.) Der Roman, der einen Kriminalfall schildert, ist ein anderer Text. Und wer darin nach Stellen sucht, in denen es um die Polizei geht, wird einige finden, in denen ermittelnde Beamte in die Wohnung von Nasrin stapfen, ohne ihre Schuhe auszuziehen, Nasrins Nachnamen immer anders falsch aussprechen und sie mit Theorien über den Tod ihrer Schwester behelligen, die auf Clan-Kriminalität und "Ehrenmord" hinauslaufen - während Nasrin, die Erzählerin des Romans, ihnen dennoch etwas zu essen und trinken anbietet und innerlich bebt und kämpft und sich verkneift.
Nasrin, Anfang vierzig, ist Türsteherin in einer queeren Berliner Bar. ("Was ist denn eine Kwierebar?", wird Filiz, mit der Nasrin damals in Lübeck zusammen war und die ihr helfen wird, das Rätsel um Nushin zu lösen, einmal fragen - comic relief würde der Roman diese Pointe vielleicht selbst nennen.) Nasrin hat nach dem Tod der Schwester ihre Nichte Parvin bei sich aufgenommen. Nasrin vermutet hinter dem Unfall einen Suizid, trauert, leidet, versteht nicht, was ihr entgangen sein könnte, hadert mit dem Schmerz, aber auch mit der Kränkung, dass ihre Schwester sie offenbar nicht in alles eingeweiht haben könnte, dass selbst ihre Teenager-Nichte mehr wissen könnte: Was hat Nushin ihr nicht erzählt? Die Polizei dagegen ermittelt sofort Richtung Milieu-Verbrechen.
Aber je mehr Nasrin über das Leben ihrer Schwester herausfindet, von der sie alles zu wissen glaubte, desto mehr führen die Spuren zurück in die Vergangenheit - nach Lübeck. Parvin, die Nichte, weiß tatsächlich mehr, als sie sagt. Es gibt Geheimnisse in dieser Familie, auch zwischen denen, die sich vertrauen, und die Frage, wie und warum Geheimnisse voreinander verborgen werden und mit welchen Mitteln sie gelüftet werden dürfen, ist zentral. Vertrauen ist, worauf es ankommt.
Vor zwei Jahren hat Yaghoobifarah mit der Journalistin und Schriftstellerin Fatma Aydemir ("Ellbogen") einen Sammelband herausgegeben, dessen Titel einschlägig wurde: "Eure Heimat ist unser Albtraum" (Ullstein) erzählte aus vierzehn Perspektiven vom Leben in und mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Darin hatte Yaghoobifarah einen Text über die Dynamik der Wahrnehmung geschrieben: "Dass ich mich weder als Frau noch als Mann identifiziere, steht mir nicht auf der Stirn geschrieben. Die meiste Zeit lesen andere mich als cis Frau. Und auch Weißsein liegt oft im Auge der Betrachtenden. Etwa dann, wenn bestimmt wird, was vermeintlich ein deutsches Aussehen ausmacht. Natürlich sehen nicht alle weißen Deutschen aus wie das Kind auf der Rotbäckchen-Saftflasche. Doch sobald jemand dunkle Haare hat, die mehr als ein Kammstrich dick sind, die Nase nicht nur ein kleiner runder Knopf ist und die Hautfarbe um eine Nuance von Mayo abweicht, findet ein Prozess statt, der sich Othering im Allgemeinen und Rassifizierung im Konkreten nennt. Blicke scannen dich ab, und du merkst: The kanak is present." Die Albträume aus diesem Buchtitel kehren in "Ministerium der Träume" leitmotivisch wieder. Aber der Roman träumt auch gegen sie an. Und schreibt gegen sie drauflos. Und zieht einen, wie nur die Literatur es mit ihren Mitteln vermag, mit hinein in einen Konflikt, statt dass man ihn nur von außen betrachtet.
TOBIAS RÜTHER
"Ministerium der Träume" von Hengameh Yaghoobifarah ist bei Blumenbar erschienen (384 Seiten
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.













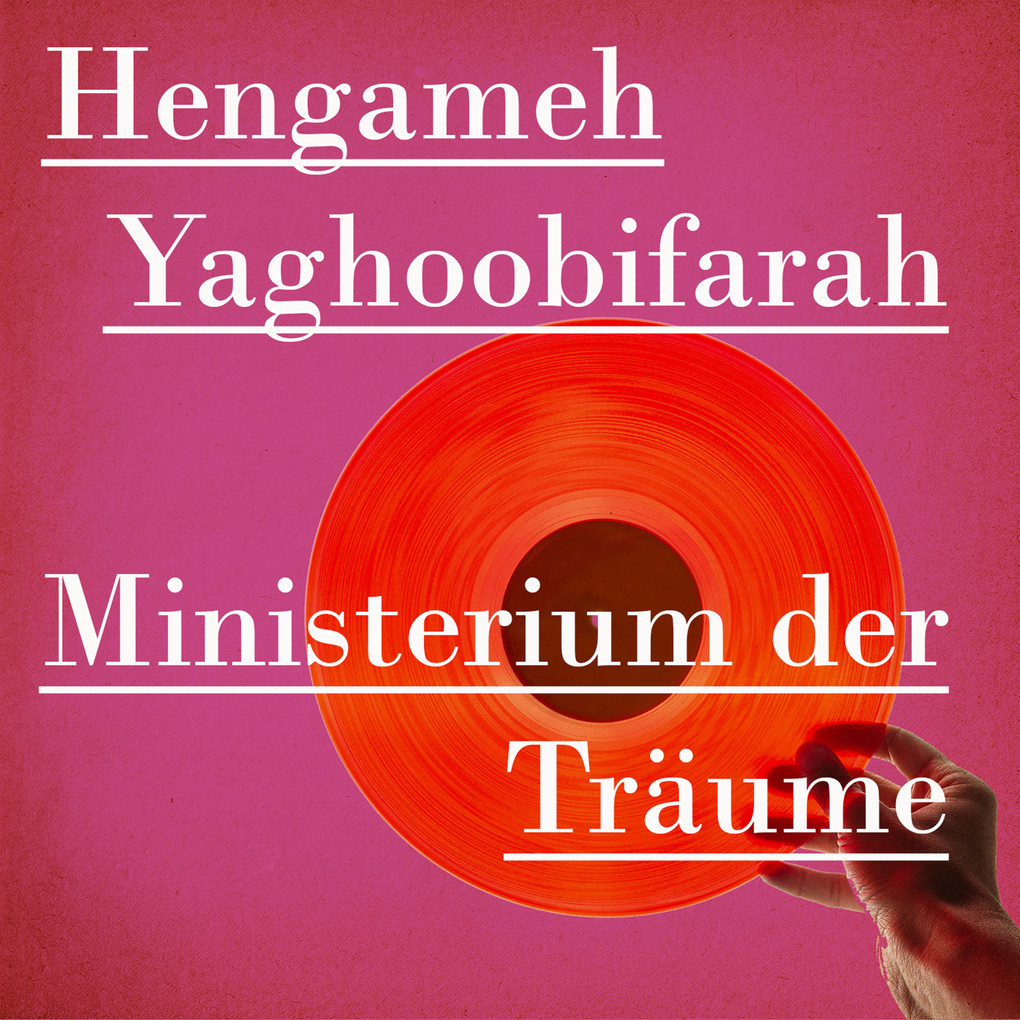
 Besprechung vom 07.02.2021
Besprechung vom 07.02.2021