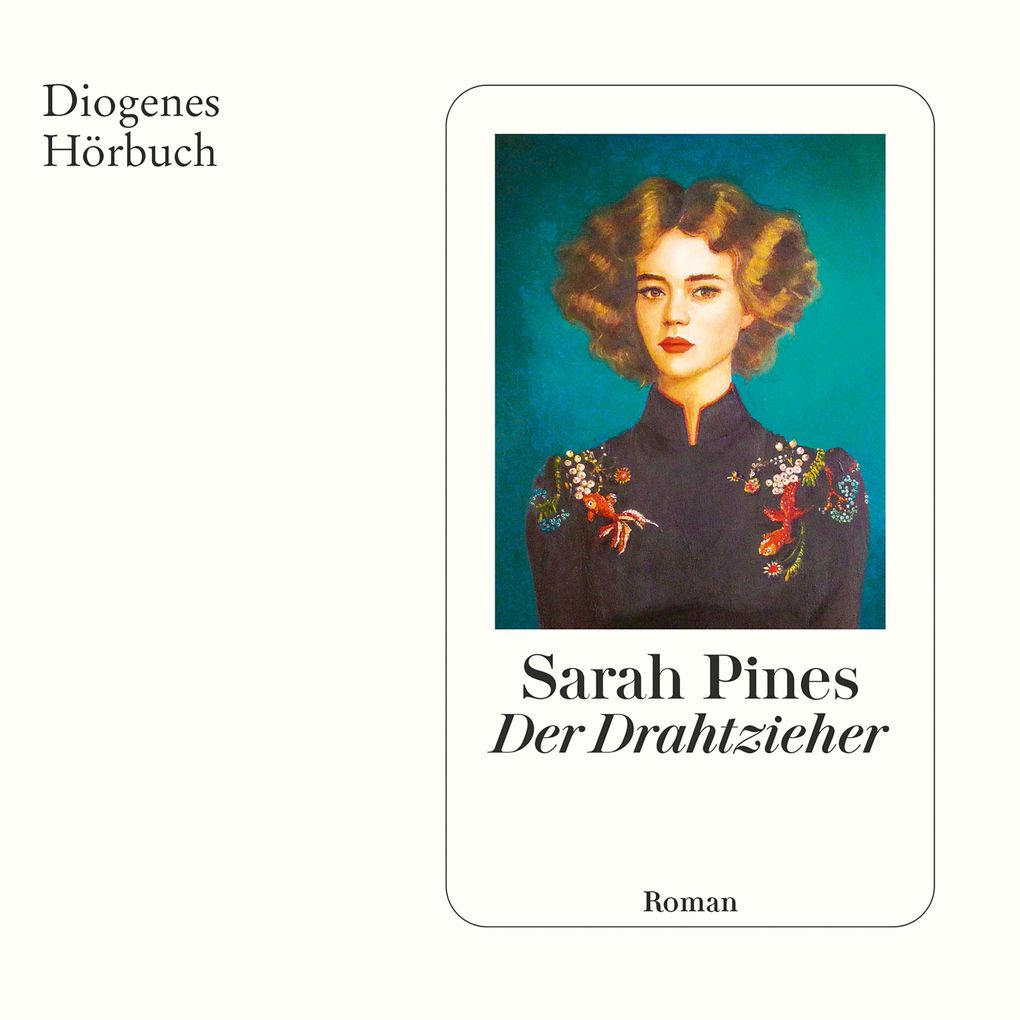
Sofort lieferbar (Download)
Theodor Hugo Hasselt hat Haltung, Wutanfälle und fluktuierende Finanzen. Der Fabrikant aus dem Sauerland soll das eingeschlafene deutsch-britische Eisenbahnprojekt »Vom Kap nach Kairo« wiederbeleben. In Südafrika verliebt er sich rettungslos in seine Cousine Alba und führt sie heim auf sein Landgut in Iserlohn. Doch dort angekommen, will Alba plötzlich Theodors besten Freund Albert, der wiederum mit Marthe verlobt ist, Theodors Jugendliebe und Langzeitgeliebter. Ein Hohelied und ein Abgesang auf die unvergleichlichen Zwanzigerjahre.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. August 2024
Sprache
deutsch
Ausgabe
Ungekürzt
Dateigröße
410,48 MB
Laufzeit
556 Minuten
Autor/Autorin
Sarah Pines
Sprecher/Sprecherin
Lisa Oltsch
Verlag/Hersteller
Produktart
MP3 format
Dateiformat
MP3
Audioinhalt
Hörbuch
GTIN
9783257695632
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 11.01.2025
Besprechung vom 11.01.2025
Der Machtverlust des Drahtfabrikanten
Zerbrochen am Geschlecht: "Der Drahtzieher" von Sarah Pines ist das Protokoll einer Entfremdung
Feminismus, der nicht wehtut, ist keiner. Die Kompromisslosigkeit, mit der im Debütroman der Journalistin Sarah Pines das Patriarchat torpediert wird, braucht wohl keine Begründung in einer Welt, in der sich auch diesseits der Taliban noch genügend Anhänger einer auf Männer geeichten Weltsicht finden. Zudem macht Pines es sich nur auf den ersten Blick leicht, wenn sie einen sexistischen, rassistischen und leicht tyrannischen Patriarchen alter Schule als wenig liebenswerten Protagonisten wählt, und das zu einer Zeit - zwischen den Weltkriegen -, in der auch der Kolonialismus noch blühte ("die Eingeborenen sind fast wie wir"). Es war schließlich zugleich eine Phase des Umbruchs, nicht nur politisch, auch mental und ökonomisch. Firmenpatriarchen sahen sich erstarkenden Gewerkschaften gegenüber; der Welthandel bestimmte zunehmend die Preise.
Der Held des Buchs, Theodor Hasselt, ist der Inhaber einer ererbten, lukrativen Drahtzieherei im Sauerland. Die mit stupend viel Detailwissen beschriebene Stahl- und Kleineisenindustrie war noch der wichtigste Wohlstandsgarant der Region. Einen Tick reicher als die Hasselts sind nur die Essenbecks aus der Stahlbranche. Sie leben gleich nebenan, in der Villa Luft; der Erbe dort heißt Albert. Er und Theodor waren "Schulfreunde, Studienfreunde, Fabrikantenfreunde. Ins Bordell gingen sie auch zusammen." Anders als Albert führt Theodor ein ganz der Tradition verpflichtetes Leben, was ihn zunehmend zu einer Anomalie macht in der (hier hell, dort dunkel) andrängenden Moderne: eine Art Don Quichotte des 20. Jahrhunderts, der noch im 19. zu leben meint.
Schon Theodors Vater hatte sich schwermütig das Leben genommen, und auch Theodor, an dem alles affektiert wirkt, betrachtet eine "Pistole in der oberen Schublade seines Schreibtischs als seine wohl verlässlichste Gefährtin", auch wenn er sich "zu gegebener Zeit erhängen" möchte, denn "so würde sein Körper für den Tod intakt bleiben". Wann diese Zeit ist, deutet der Folgesatz an: "Bald."
Derweil aber gilt es, die Forderungen der frech werdenden Arbeiter abzuwehren (Albert geht anders damit um) und die heimischen Bediensteten samt der eigenen Mutter mit größter Strenge zu behandeln. Cholerische Wutanfälle erleidet der Hausherr, wenn der Tisch nicht makellos gedeckt ist. Dann zerschlägt er das Porzellan: "Wie er die Scherben lieben würde, die nun kämen", heißt es, und: "Theodor fragte sich, ob er die fünftausend, die das Gedeck gekostet hatte, gleich hier vor aller Augen verbrennen sollte, um den Damen der Runde mal eine Vorstellung vom Leben zu geben, ließ es dann aber sein."
Ein einziges Mal nur ist Theodor aus seinem engen Lebenskreis ausgebrochen. Ein Eisenbahnprojekt führte ihn 1925 geschäftlich nach Südafrika, wo er unsicher wirkt, fremd und unterlegen, aber auch erregt von der opulenten Natur. Er kommt bei einem Onkel unter und verliebt sich Hals über Kopf in seine Stiefcousine, wobei er "den Beginn seiner Liebe" festmacht an der Vorstellung, wie er Alba "durchbohrte wie einen Schmetterling". Unverblümt wird der Sex beschrieben, der auch in einer Zeit, in der man darüber nicht redete, so stattgefunden haben wird.
Als prospektive Ehefrau nimmt Theodor Alba mit ins Sauerland - zumal ein Kind im Anmarsch zu sein scheint, was sich als falsch herausstellt (Theodor nennt es später Vortäuschung). Die ihn liebende Marthe sieht Theodor heimlich weiterhin, auch wenn die sich, beleidigt, mit Albert verlobt. Alba wiederum, die die Nebenliebe zu Marthe ahnt, erliegt dem Charme Alberts und hat nun ebenfalls zwei Liebhaber: eine komplizierte, auf Dauer fatale Ménage-à-quatre, aber unter ungleichen Bedingungen, denn auch wenn alle Beteiligten begütert sind, ist der eigentliche Reichtum bei den Männern konzentriert.
Man kann nicht leugnen, dass man es wieder mit dem Zerfall einer Industriellenfamilie zu tun hat, die stellvertretend für ein ganzes Zeitalter steht. Und doch entgeht Pines der "Buddenbrooks"-Falle durch eine konsequente Konzentration auf die intime Psychologie, denn die Handlung besteht im Grunde zur Gänze aus dem Zerfleischen von Alba und Theodor nach einer sehr kurzen Phase der leichtlebigen Verliebtheit. Extrem personal ist der Blick, aber dennoch auktorial kommentierend, indem die Autorin die Ängste, Wünsche und Ansprüche ihrer Figuren unerbittlich - und mit starker Betonung des körperlichen Begehrens - ausstellt. Auch Alba, die sich mit der alten Ordnung arrangiert hat, wird dabei nicht geschont. Anders als sie schafft die moderne Marthe schließlich die Flucht aus ihrer Käfigexistenz nach Paris. Aber die Sympathieverteilung ist eindeutig. Alba ist ein Opfer, und alles an Theodor stößt ab. Er ist fixiert auf Albas Unterwerfung: "Hatte er sie zu sehr laufen lassen?" Sie habe sein "Besitz" zu sein. Immer hasserfüllter denkt er an seine untreue "Trophäen-Frau", nennt sie für sich "Nutte", erniedrigt sie, greift zu Gewalt, will ihr ein ums andere Mal ein Geständnis abringen.
Es handelt sich um das Protokoll einer Entfremdung (ja, auch zwischen den Geschlechtern, aber hier doch vor allem auf den konkreten Fall bezogen). Das ist quälend zu lesen. Und doch so gut und genau beschrieben, so stimmig im Tonfall und in der historischen Verortung, so ungeniert bösartig auch in vielen kleinen Wendungen, dass man nicht aufhören kann, dieser fatalen, entblößenden Entwicklung gebannt zu folgen. So funktioniert die Eifersucht schließlich bis heute, sie macht dumm, blind und ängstlich besitzergreifend; sie wird zur Marter, ausweglos, strudelt im Kreis um eine Kränkung herum. In Verbindung mit einer noch ungebrochen patriarchalen Geschlechterordnung wird daraus eine Metzelei: An Albert beißt sich Theodor die Zähne aus, die Frauen sind bald nur noch Objekte, an denen die Wut ausgelassen werden kann.
Von Beginn an ist klar, dass es sich bei der Erzählung um eine Tragödie handelt, und doch erstaunt es, wie erbärmlich der dekonstruierte Patriarch schließlich dasteht. Die einst Geliebte, die sich körperlich noch hergibt, aber sonst nur statuenhafte Kälte ausstrahlt, hat alle Funktion für Theodor verloren: "Mutter sein wollte sie nicht, seinen Samen in sie senken, um sich durch ihren Körper zu überleben, gelang ihm nicht."
Verwinden aber kann er dieses Scheitern nicht. Seine Macht steht infrage. Zugleich verliert er das Zutrauen in sich selbst. So überdeutlich und emotional diese Anklage ist, sosehr sie auf das kollabierte alte Bürgertum rekurriert: Wer je eifersüchtig war, könnte sich hier und da doch ertappt fühlen. Und vielleicht sogar etwas lernen. OLIVER JUNGEN
Sarah Pines: "Der Drahtzieher". Roman.
Diogenes Verlag, Zürich 2024. 320 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Der Drahtzieher" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









