Bücher versandkostenfrei*100 Tage RückgaberechtAbholung in der Wunschfiliale
NEU: Das Hugendubel Hörbuch Abo - jederzeit, überall, für nur 7,95 € monatlich!
Jetzt entdecken
mehr erfahren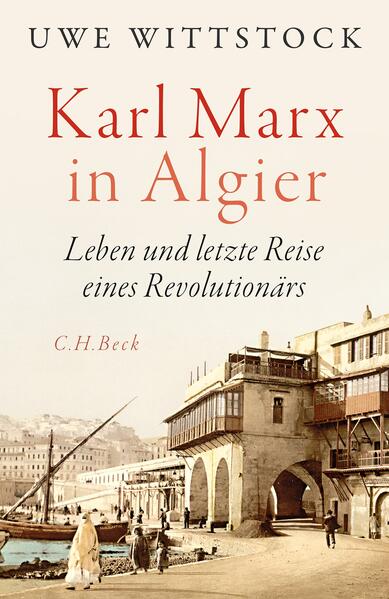
Zustellung: Di, 07.10. - Do, 09.10.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Vom Autor von "Marseille 1940": Die erstaunliche Geschichte von Karl Marx letzter Reise
Am 18. Februar 1882 besteigt Karl Marx in Marseille den Dampfer «Said» und verlässt zum ersten Mal Europa. Den Tod seiner Frau Jenny drei Monate zuvor hat er nicht verwunden. Er ist krank und hofft auf Genesung in Algier. Während er dort die Eindrücke der neuen Kultur auf sich wirken lässt, zieht er unsentimental eine Art Resümee seines Daseins und Wirkens. Uwe Wittstock erzählt lebendig und fesselnd von der letzten großen Reise des großen Denkers und blickt mit ihm zurück auf sein außergewöhnliches Leben.
Als Karl Marx 1882 im Hafen von Algier an Land geht, wird er von einem einstigen sozialistischen Untergrundkämpfer empfangen. Doch von politischem Kampf kann für Marx keine Rede mehr sein. Mit Europa hat er die ideologischen Schlachtfelder hinter sich gelassen, der Arzt hat ihm alle geistigen Anstrengungen verboten. Was bleibt ihm übrig, als sich Erinnerungen hinzugeben? Anhand von teils unpublizierten Quellen schildert Uwe Wittstock die Monate in Algier und beleuchtet zugleich das Leben dieses ebenso oft überhöhten wie vorschnell verdammten Denkers: die wilden Studienjahre in Bonn und Berlin, Marx frühe poetische Ambitionen, seine seltsam bremsende Rolle im Revolutionsjahr 1848, dann das ewige Exil, die Zumutungen der Armut. Warum blieb Marx fast lebenslang politisch isoliert, und wieso ließ er sein Hauptwerk, das Kapital, unvollendet liegen? Am Schluss seiner Zeit in Algier geht Marx zum Barbier und lässt sich seinen Revolutionärsbart abnehmen: Ein später Widerruf?
Am 18. Februar 1882 besteigt Karl Marx in Marseille den Dampfer «Said» und verlässt zum ersten Mal Europa. Den Tod seiner Frau Jenny drei Monate zuvor hat er nicht verwunden. Er ist krank und hofft auf Genesung in Algier. Während er dort die Eindrücke der neuen Kultur auf sich wirken lässt, zieht er unsentimental eine Art Resümee seines Daseins und Wirkens. Uwe Wittstock erzählt lebendig und fesselnd von der letzten großen Reise des großen Denkers und blickt mit ihm zurück auf sein außergewöhnliches Leben.
Als Karl Marx 1882 im Hafen von Algier an Land geht, wird er von einem einstigen sozialistischen Untergrundkämpfer empfangen. Doch von politischem Kampf kann für Marx keine Rede mehr sein. Mit Europa hat er die ideologischen Schlachtfelder hinter sich gelassen, der Arzt hat ihm alle geistigen Anstrengungen verboten. Was bleibt ihm übrig, als sich Erinnerungen hinzugeben? Anhand von teils unpublizierten Quellen schildert Uwe Wittstock die Monate in Algier und beleuchtet zugleich das Leben dieses ebenso oft überhöhten wie vorschnell verdammten Denkers: die wilden Studienjahre in Bonn und Berlin, Marx frühe poetische Ambitionen, seine seltsam bremsende Rolle im Revolutionsjahr 1848, dann das ewige Exil, die Zumutungen der Armut. Warum blieb Marx fast lebenslang politisch isoliert, und wieso ließ er sein Hauptwerk, das Kapital, unvollendet liegen? Am Schluss seiner Zeit in Algier geht Marx zum Barbier und lässt sich seinen Revolutionärsbart abnehmen: Ein später Widerruf?
- Dieses Buch ist die überarbeitete Fassung von "Karl Marx beim Barbier. Leben und letzte Reise eines deutschen Revolutionärs", erschienen 2018
- Dies ist ein wunderbares Buch. Uwe Wittstock wechselt elegant zwischen Biografie und Erzählung, und ihm gelingt das Kunststück, die philosophischen Ideen dieser Zeit mühelos zu erklären." Ferdinand von Schirach
- Fantastisch erzählt von Uwe Wittstock
- Wie Karl Marx zum ersten Mal Europa verließ
- Eine etwas andere Biografie des Denkers, der die Welt veränderte
- "Uwe Wittstock beschreibt Marx Leben und Wirken so lehrreich, klug und spannend wie elegant und leicht von jenen zehn Wochen aus, die er im Frühjahr 1882 in Algier verbrachte." Axel Hacke, Süddeutsche Zeitung
- "Wie Uwe Wittstock das Bedeutende mit leichter Hand erzählt, ist eine große Kunst und für den Leser ein großes Vergnügen." Christine Westermann, WDR 5
Produktdetails
Erscheinungsdatum
14. März 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
249
Autor/Autorin
Uwe Wittstock
Illustrationen
mit 17 Abbildungen
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
mit 17 Abbildungen
Gewicht
403 g
Größe (L/B/H)
221/150/27 mm
ISBN
9783406830723
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Ein Klassiker. "
Leipziger Internet Zeitung, Ralf Julke
Viel mehr als ein Sachbuch, es ist eine höchst unterhaltende Reise durch das Leben des uns allen bekannten Revolutionärs und zugleich dessen letzte Reise Marx bleibt spannend, so wie dieses kluge Buch.
Kölner Stadt-Anzeiger, Elke Heidenreich
Wittstock ist als erfolgreicher Autor fesselnder Sachbücher über das Schicksal deutscher Literaten in der NS-Zeit bekannt.
tz Buchtipp
Wer sich schon immer einmal mit Karl Marx beschäftigen wollte, aber bisher keinen Zugang fand, dem bietet dieses Buch einen exzellenten Einstieg
Main-Echo Zeitung
Literaturgeschichte in lebendig
WELT am Sonntag
Wer sich schon immer einmal mit Karl Marx beschäftigen wollte, dem bietet dieses Buch mit seiner klaren, leichten Sprache einen exzellenten Einstieg.
Allgemeiner Anzeiger, Sibylle Peine
Sein neues Buch ist für mich sein bislang bestes eine reflektierende, kritische und kompakte biografische Skizze des alten Marx mit sehr interessanten ideengeschichtlichen Betrachtungen heiter und leicht wie ein Reiseroman
Der siebte Tag, Nils Minkmar
Das Bestechende an diesem Buch ist, dass es Wittstock gelingt, Marx Reise lebendig und anschaulich darzustellen. Sie erscheint dem Leser wie ein klares Bild vor dem inneren Auge: das Panorama von Algier, der Hafen mit den Fischerbooten, die Bucht . . . Ein originelles und allemal lesenswertes biographisches Werk.
Jungle World, Christian Hofmann
Wittstock verknüpft in seinem eleganten Buch «Karl Marx in Algier» einer überarbeiteten Neuausgabe des 2018 erschienenen «Karl Marx beim Barbier» das Leben mit der Theorie.
NZZ Bücher am Sonntag, Urs Hafner
Leipziger Internet Zeitung, Ralf Julke
Viel mehr als ein Sachbuch, es ist eine höchst unterhaltende Reise durch das Leben des uns allen bekannten Revolutionärs und zugleich dessen letzte Reise Marx bleibt spannend, so wie dieses kluge Buch.
Kölner Stadt-Anzeiger, Elke Heidenreich
Wittstock ist als erfolgreicher Autor fesselnder Sachbücher über das Schicksal deutscher Literaten in der NS-Zeit bekannt.
tz Buchtipp
Wer sich schon immer einmal mit Karl Marx beschäftigen wollte, aber bisher keinen Zugang fand, dem bietet dieses Buch einen exzellenten Einstieg
Main-Echo Zeitung
Literaturgeschichte in lebendig
WELT am Sonntag
Wer sich schon immer einmal mit Karl Marx beschäftigen wollte, dem bietet dieses Buch mit seiner klaren, leichten Sprache einen exzellenten Einstieg.
Allgemeiner Anzeiger, Sibylle Peine
Sein neues Buch ist für mich sein bislang bestes eine reflektierende, kritische und kompakte biografische Skizze des alten Marx mit sehr interessanten ideengeschichtlichen Betrachtungen heiter und leicht wie ein Reiseroman
Der siebte Tag, Nils Minkmar
Das Bestechende an diesem Buch ist, dass es Wittstock gelingt, Marx Reise lebendig und anschaulich darzustellen. Sie erscheint dem Leser wie ein klares Bild vor dem inneren Auge: das Panorama von Algier, der Hafen mit den Fischerbooten, die Bucht . . . Ein originelles und allemal lesenswertes biographisches Werk.
Jungle World, Christian Hofmann
Wittstock verknüpft in seinem eleganten Buch «Karl Marx in Algier» einer überarbeiteten Neuausgabe des 2018 erschienenen «Karl Marx beim Barbier» das Leben mit der Theorie.
NZZ Bücher am Sonntag, Urs Hafner
Bewertungen
am 08.05.2025
Am Ende kommt der Bart ab
Karl Marx war kein angenehmer Mensch. Er war selbstherrlich, herrschsüchtig und rechthaberisch. Die Gesellschaft anderer Menschen, ausgenommen seiner Familie und engen Freunden, war ihm eher unangenehm, Empathie für andere empfand er nicht. Seine journalistischen Texte bezeugten antisemitisches und rassistisches Gedankengut. Auf Wunsch des Vaters begann er ein Jura-Studium, doch sein Interesse galt der Literatur und der Philosophie. Phasenweise war er als Journalist und Redakteur tätig, die meiste Zeit im Leben jedoch ohne Erwerbstätigkeit. Zeit seines Lebens hat er ohne ein schlechtes Gewissen auf Pump und Kosten anderer, vor allem von Friedrich Engels, gelebt, der ihn nach heutigen Maßstäben mit mindestens 500.000 Euro alimentierte. Marx proklamierte die Revolution der Proletarier, kannte aber keine Arbeiter persönlich und verachtete sie sogar. Obwohl selbst ohne Einkommen, lebte er zeitweise feudal, mit Standesdünkel und Dienstmädchen. Das Ehepaar Marx konnte nicht besonders gut mit Geld umgehen.
Eingebettet in die 10 Wochen eines Aufenthalts in Algier, der zur Erholung gedacht war, rekapituliert Wittstock Karl Marx Leben.
1882 verbrachte Karl Marx (1818 - 1883) knapp drei Monate zur Erholung in Algier. Viel Freude hatte er dort nicht, denn das Wetter war schlecht, und gesund wurde er auch nicht. Deshalb bleiben auch die Korrekturfahnen für die überarbeitete dritte Auflage des ersten Teils seines Lebenswerks Das Kapital, erstmals erschienen 1867, ungelesen. Friedrich Engels wird das später für ihn erledigen, so wie er auch aus Marx nachgelassenen Fragmenten und Manuskripten die Teile 2 und 3 des Kapital formulieren wird. Karl Marx war Perfektionist, er wurde mit seinen Zeitungsartikeln und eben auch mit dem Kapital einfach nicht fertig, weil er seine Texte wieder und wieder überarbeitet hat. Zugleich war er ein unermüdlicher Leser, jede wirtschaftliche und philosophische Veröffentlichung las er, um die Erkenntnisse daraus in seine Texte einfließen zu lassen, was seine Scheu, ein Manuskript aus den Händen zu geben, erklärt. Teil I des Kapital war eigentlich bereits 1848 fertig. Als es 1868 lang erwartet endlich erschien, war es bereits kurz davor, sich selbst überlebt zu haben, was Marx laut Wittstock auch bewusst gewesen sein muss. Womöglich hat er sich auch deshalb mit den Teilen II und III nicht beeilt.
Die Grundlage seiner Theorie: die ökonomischen Verhältnisse prägen das Denken der Menschen und bestimmen den Gang der Geschichte. Die ökonomischen Strukturen bilden zusammen mit den gesellschaftlichen Institutionen den Überbau einer Gesellschaft. Wenn ein wesentlicher Wandel in den Produktionsverhältnissen eintritt, entsteht gesellschaftlicher Veränderungsdruck, und dann ändert sich auch der Überbau. Soweit korrekt. Mit seiner These, dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, wurde er zum Vater der modernen Soziologie. Aber das konnte er damals nicht wissen. Womit er nicht Recht hatte: die Arbeiter intendierten nicht, die Herrschaft zu übernehmen. Sie wollten - und wollen bis heute - lediglich, dass es ihnen wirtschaftlich und gesellschaftlich besser geht, dass sie weniger abhängig sind. Aber das konnte Marx sich vielleicht auch gar nicht vorstellen, denn die Welt der Arbeiter war ihm im Grunde fremd, er schrieb als Gelehrter über sie, aber er lebte nicht in ihr. Trotz seiner Armut war er immer bemüht, die Fassade einer bürgerlichen Existenz aufrechtzuerhalten. Er war ein kluger Kopf, aber ein Heuchler, arbeitsscheu, nicht lebensfähig, seiner Familie gegenüber gewissenlos. Wenn man ganz hart mit ihm ins Gericht geht, kann man ihm die Schuld geben am Tod von vieren seiner sieben Kinder, die Opfer der katastrophalen hygienischen Lebensverhältnisse und schlechter Ernährung wurden, als die Familie völlig verarmt in London lebte. Auch seine Frau Jenny und ihn selbst haben diese Umstände chronisch krank gemacht, und trotzdem hat er es nie mit Arbeit gegen Geld versucht. Mitte der 60er Jahre kam er in den Genuss eines stattlichen Erbes, von dem die Familie fünf Jahre gut hätte leben können, doch das Geld reichte nicht einmal ein Jahr. Schwer zu glauben, dass so ein kluger, wirtschaftsphilosophisch denkender Mann nicht in der Lage war, seine eigene Existenz zu gestalten.
In vielen kleinen, detailreichen und oft unterhaltsam zu lesenden Episoden erzählt Wittstock Marxens Leben. Dass er sich dabei nicht auf seinen Schaffensprozess beschränkt, sondern anhand von Quellen, teilweise bislang unveröffentlichten Briefen und Schriften, diese ganzen familiären, privaten und charakterlichen Details einarbeitet, hat für mich das Buch besonders lesenswert gemacht. Es mag sein, dass es für ausgewiesene Marx-Kenner auf der wissenschaftlichen Ebene nichts Neues liefert, doch mich hat es trefflich unterhalten und mir auch Wissenszuwachs beschert.
Es ist ein wenig anders konzipiert als Wittstocks gefeierte Werke Februar 1933 und Marseille 1940, weil es nicht so ausgeprägt episodenhaft, sondern geradliniger erzählt ist. Die Rahmenhandlung, welche die Biografie immer wieder unterbricht, ist Marxens 10-wöchiger Aufenthalt in Algier, der etwa ein Drittel des Buchumfangs ausmacht. In diesen Passagen kommt man dem Mittsechziger sehr nahe, weil er seine Gedanken teilt. Auch ist er hier ein netterer Mann, als im biografischen Teil von mir herausgelesen.
Das Buch ist bereits im im Karl-Marx-Jahr 2018, parallel zu etlichen anderen Marx-Biografien, im Verlag Blessing schon einmal erschienen, damals unter dem Titel Karl Marx beim Barbier. Denn Marx hatte sich in Algier kurz vor seiner Abreise von seiner ikonischen Haarpracht und seinem markanten Bart getrennt. Ob er sich damit von seinem Werk, von seinen Theorien verabschiedet hat? Den alten Bart abgeschnitten? Den Revoluzzer aufgegeben? Das bleibt Spekulation.
Bislang hatte ich nur Texte von Marx und journalistische Arbeiten über ihn gelesen, alles zwar schon vor längerer Zeit, aber komplett fremd war er mir nicht. Dies ist meine erste Biografie über Marx, die ich gerne weiter empfehle.
Uwe Wittstock, geboren 1955 in Leipzig, hat Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaft studiert. Als Journalist schrieb er für die FAZ, Die Welt und den Focus, war leitender Lektor für deutschsprachige Gegenwartsliteratur im S. Fischer-Verlag und Mitherausgeber der Literaturzeitschrift Neue Rundschau. Seit 2017 ist er freier Schriftsteller.
am 12.04.2025
Der Bart des Propheten
Das letzte Foto, das es von Karl Marx gibt, hat der algerische Fotograf Dutertre 1882 aufgenommen. Der schwerkranke Marx hatte sich kurz vor seiner Abreise aus Algier fotografieren lassen und war unmittelbar darauf zum Barbier nebenan gegangen, um sich seine berühmte Haarpracht und den Bart stutzen zu lassen.
Uwe Wittstock fragt sich in seinem Buch, warum sich Marx den legendären Bart abnehmen ließ, ein Markenzeichen aller Revolutionäre des 19. Jahrhunderts. Er spekuliert, "die eigenen Zweifel an seinen politischen Prognosen [seien] zu groß geworden", die Fotografie vor der Rasur habe sein Selbstbild "gewissenhaft konservieren" die Rasur die tiefgreifende Veränderung ausdrücken sollen. Nun ja, vielleicht war das so. Uwe Wittstock versucht das mit Stellen aus einem Brief an Engels zu belegen. Vielleicht war er aber auch nur ein todkranker, einsamer, melancholischer Mann, der seinen erfolglosen Erholungsaufenthalt in Algier mit einem radikalen Zeichen abschließen wollte. Der große Mann mit "Prophetenbart"wollte er nicht mehr sein. Wie auch immer.
Die radikale Veränderung des Äußeren dient auf alle Fälle als Aufhänger und als Bindeglied zwischen den beiden Teilen des Buches. Zum großen Teil ist es Biographie mit Lebensstationen, politischem und gesellschaftlichem Hintergrund, grundlegenden Aussagen zu den politischen Theorien von Marx. Zu einem kleineren Teil aber auch romanhafte, szenische Darstellung der Reise nach Algier. Zu Beginn sind die beiden Teile noch eng miteinander verbunden, später wechseln sie sich einfach ab. Zwei Bücher in einem. Beeindruckend für mich ist vor allem der erzählende Teil. Die Biographie: immerhin Bildungslücken geschlossen.
Nach den so hervorragenden Büchern "Februar 33" und "Marseille 1940" ein bisschen enttäuschend. Erstmals erschienen ist es im Marx-Jahr 2018 unter einem ähnlichen Namen bei Blessing und nach Aussagen des Autors in der Flut der Marx-Biographien untergegangen. Nach dem Erfolg der beiden anderen Bücher wurde es bei C.H. Beck in einer revidierten Fassung 2025 wieder aufgelegt.
Ich wünsche mir von Uwe Wittstock, der Zeitgeschichte so hervorragend erzählen kann, eine Art Fortsetzung von "Marseille 1940". Wie ging es weiter mit den Geretteten in den USA, Mexiko und anderswo?









