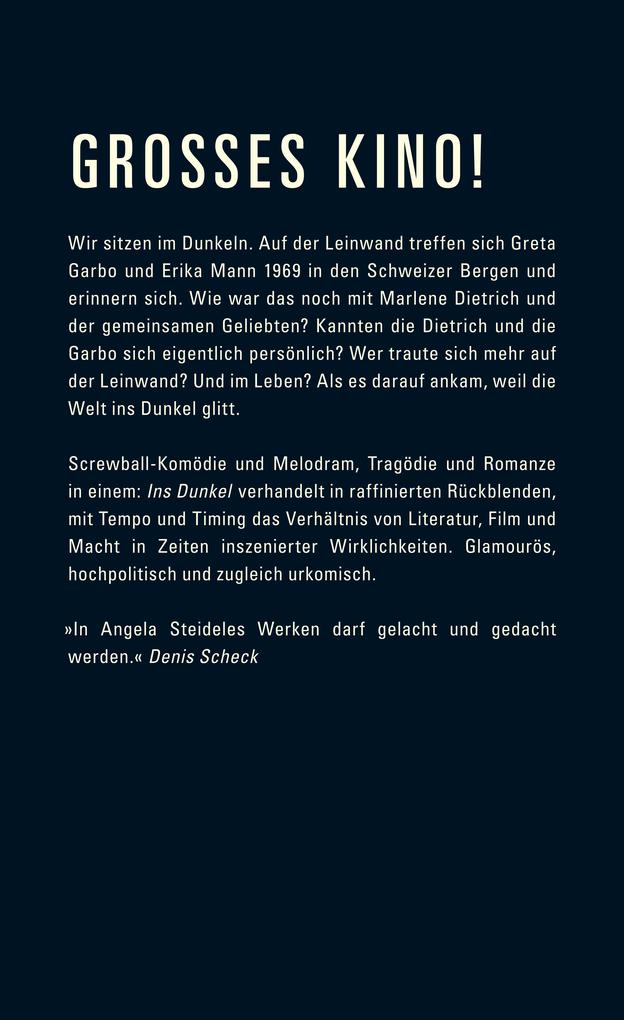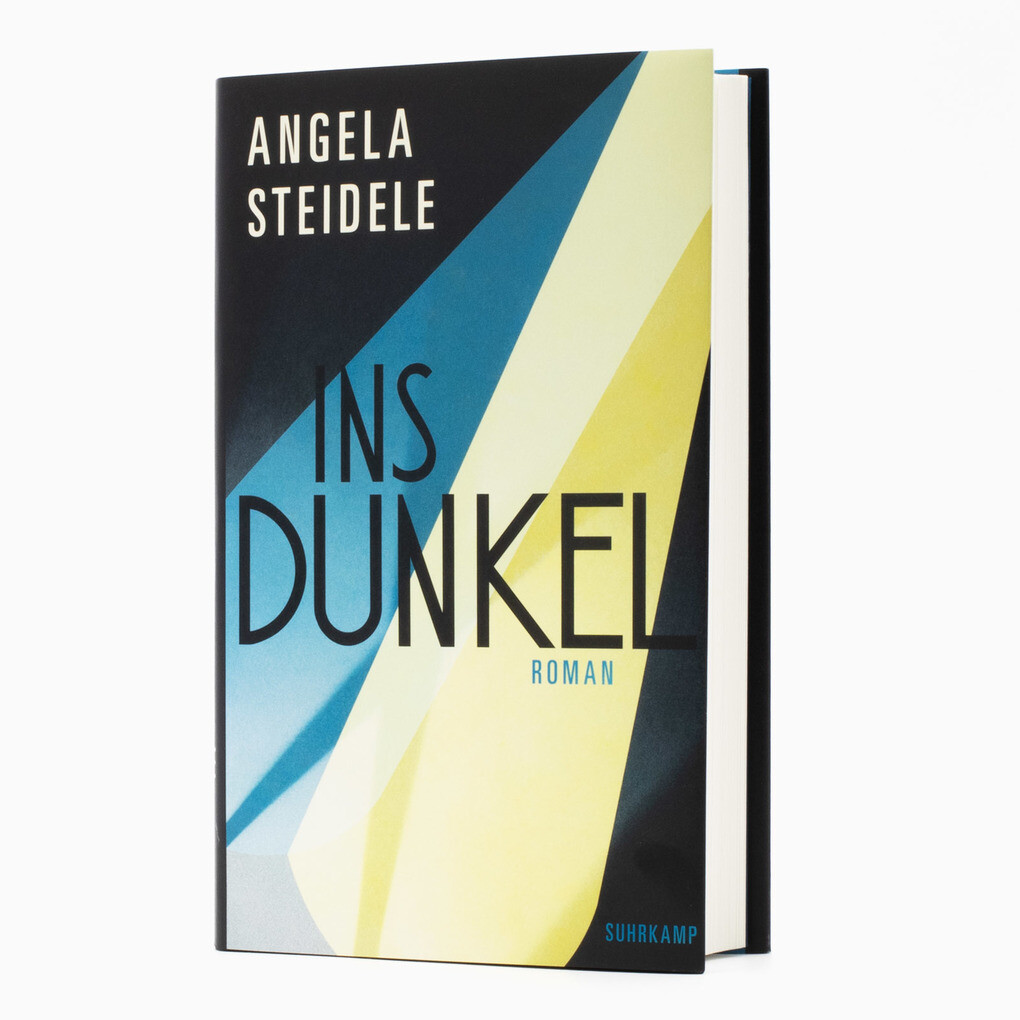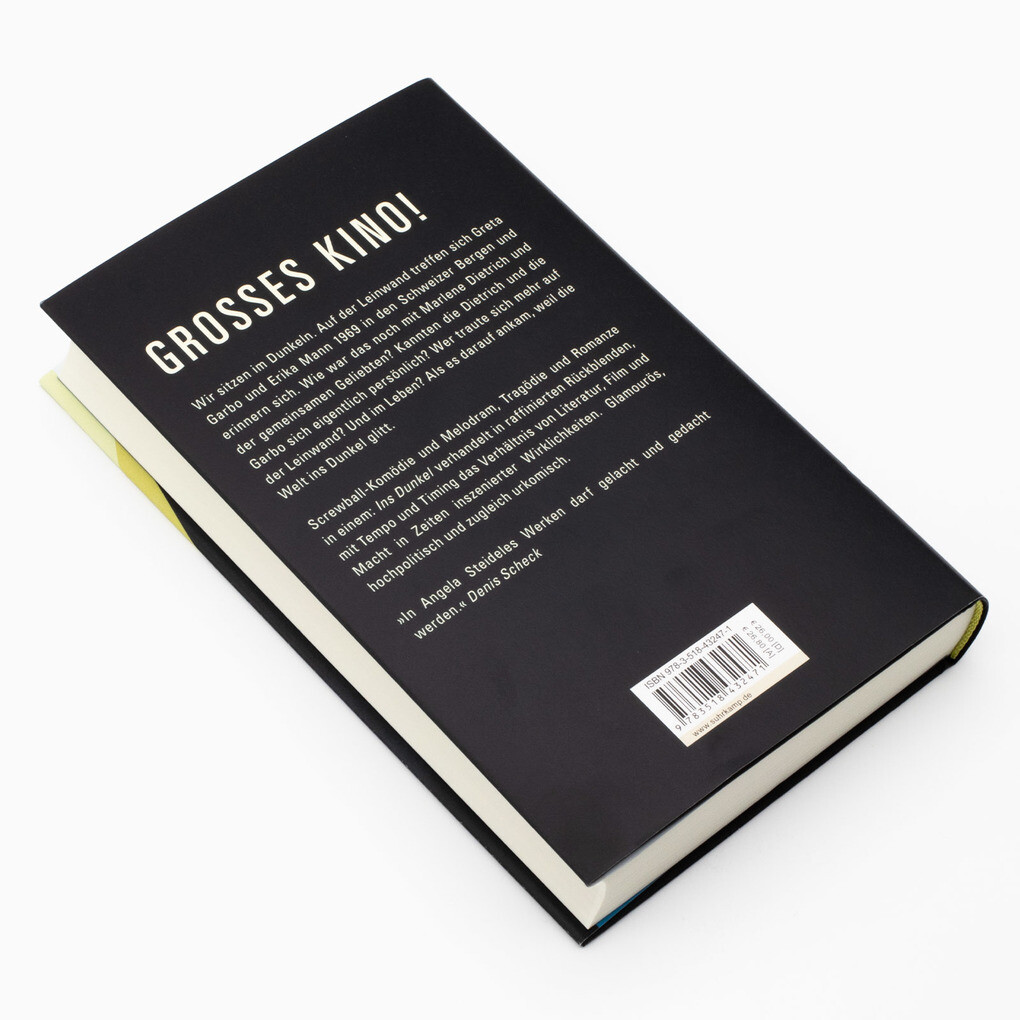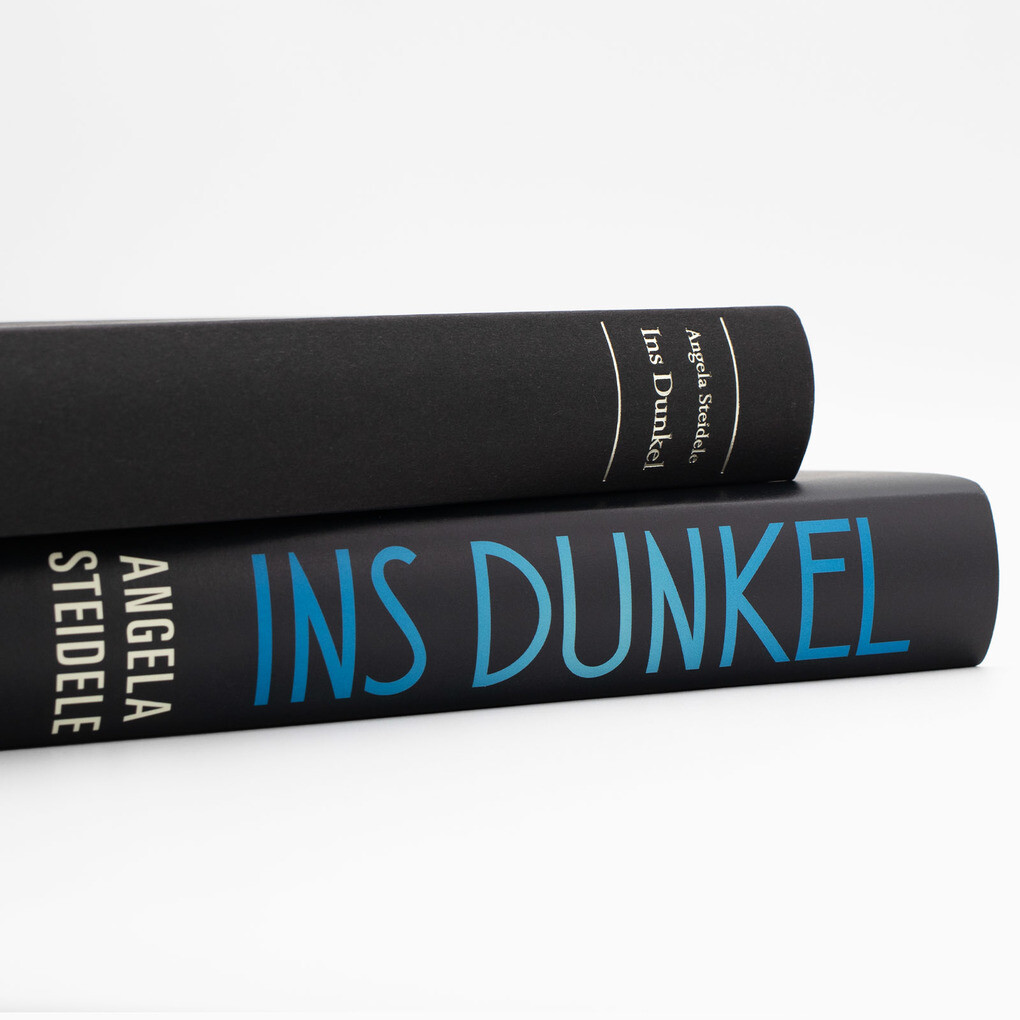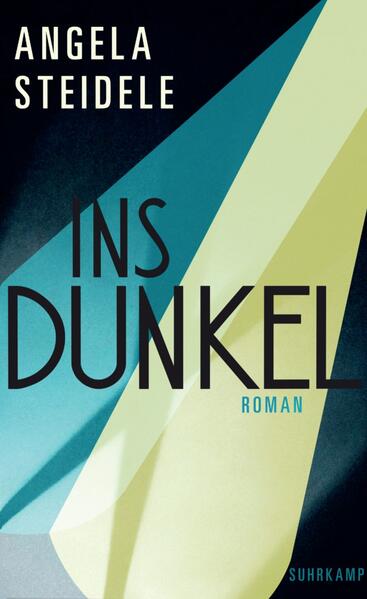
»Voller Intrigen, Liebe, Leidenschaft, voller Neid und Bosheit und Sehnsucht . . . Großartig! « Elke Heidenreich
Ins Dunkel ist Screwball-Komödie und Melodram, Tragödie und Romanze in einem: ein Roman als Film, glamourös und hochpolitisch. In raffinierten Rückblenden, mit Tempo und Timing verhandelt er das Verhältnis von Literatur, Film und Macht in Zeiten inszenierter Wirklichkeiten.
Eine Liebeserklärung an das Kino
Wir sitzen im Dunkeln. Auf der Leinwand treffen sich Greta Garbo und Erika Mann 1969 in den Schweizer Bergen und erinnern sich. Wie war das noch mit Marlene Dietrich und der gemeinsamen Geliebten? Als der Film den Nerv der Zeit traf und die Deutschen Hollywood und ganz Amerika durcheinanderwirbelten. Mit Erika Manns antifaschistischem Kabarett Die Pfeffermühle, während die ganze Welt ins Dunkel glitt? Mit der Zensur nach 1933 auch in den USA? Ach - und wie gut kannten sich eigentlich Greta Garbo und Marlene Dietrich? Wer traute sich mehr auf der Leinwand? Und im Leben?
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ins Dunkel ist ein buchstäblich vielstimmiger Roman. Fast möchte man sagen: Ein Film für die ganze Familie. Bestens ausgeleuchtet. Reich an Perspektiven. Sorgfältig geschnitten. Mit einer Vorliebe für Nahaufnahmen. Dazu ein starker Fokus auf die Aktualität. « Martin Oehlen, Frankfurter Rundschau
». . . Angela Steidele verwebt in ihrem raffinierten Roman Ins Dunkel die Leben von Erika Mann, Marlene Dietrich und Greta Gabo. « Madame
»Ins Dunkel kann man auch als eine feministische Bilanz des Kampfs um die Gleichstellung im US-Kino lesen. . . . So verknüpft dieses Buch Film- und Gleichstellungsgeschichte mit vergnüglichen Episoden aus einer Welt, die erst zwei Generationen zurückliegt, aber unendlich weit entfernt erscheint. « Rolf Hürzeler, kulturtipp
»Ins Dunkel ist damit auch ein sympathisches Gegenstück zu Daniel Kehlmanns Bestseller Lichtspiel ein durchweg unterhaltsamer Zeitroman und ein intelligentes Lesevergnügen. « Deutschlandfunk
»Eine Roman-Doppelbiografie, die sich liest, als säße man im Kinosaal. « FOCUS
»Mit akribisch recherchierten Fakten und den Mitteln des Films erzählt die in Köln lebende Autorin vom Was wäre, wenn [Ein] grandios unterhaltsame[r] Roman. « Thomas Hummitzsch, republik. ch
»[Angela Steidele schreibt] großartige Romane über ebenso großartige historische Frauen. « Deutschlandfunk Kultur
»Ins Dunkel ist Angela Steideles feministische Antwort auf Thomas Manns Der Zauberberg . « SWR
»Der Roman ist nicht nur eine ungewöhnliche und gelungene spielerisch-literarische Kinofantasie, sondern dreht sich auch im die grundsätzliche Frage ob und wie Erinnerungen verlässlich sein können. « Manuela Reichart, WDR
»Ins Dunkel von Angela Steidele. Ein Roman wie ein Hollywoodfilm hochpolitisch und zugleich urkomisch. « Textor
 Besprechung vom 22.08.2025
Besprechung vom 22.08.2025
Augen für die Wangenknochen
Aus der Spelunke auf die große Leinwand: In ihrem Roman "Ins Dunkel" erzählt Angela Steidele filmisch von Marlene Dietrich und Greta Garbo
Ikonen sind Oberfläche", warnte Angela Steideles Literaturagentin die Biographin. Sollte heißen: Pass auf, die Gefahr ist groß, dass du darauf ausgleitest. In ihrer Danksagung am Ende ihres Romans "Ins Dunkel" erwähnt Steidele diese gut gemeinte Warnung. Aber nicht, um sie trotzig in den Wind zu schlagen. Im Gegenteil. Gerade weil nach der Lektüre unumstößlich klar geworden sein dürfte: Man kann über die Dietrich und die Garbo nicht authentisch schreiben. Überhaupt kann nur das über sie geschrieben werden, was einerseits gewusst werden kann durch Originaldokumente und andererseits kolportiert wurde durch Zeitzeugen, was aber schon eine erste Ableitung von Verzerrung ist.
Da wären die Memoiren von Mercedes de Acosta bis Salka Viertel, aus denen sich zitieren ließe. Außerdem ist das alles ja auch und vor allem Kinogeschichte. Das heißt: Projektionen, die Millionen erreicht haben, verstellen den Blick auf das Private. Zuletzt legt die Biographin noch ihren eigenen Kram ins Geschehen. Was interessiert sie an ihrem Stoff? Was nimmt sie auf, was legt sie weg?
In ihrer "Poetik der Biografie" erinnerte Angela Steidele 2019 an Aristoteles' Poetik, in der es heißt, der Geschichtsschreiber und der Dichter unterschieden sich dadurch, dass "der eine das wirklich Geschehene mitteilt, der andere hingegen, was geschehen könnte". Schon in der Antike wurde diese Trennung verworfen. Zum Beispiel von Plutarch, dem renommiertesten Biografen seiner Zeit.
Wie soll man aber das einordnen, was die zu Biographierenden machen? Was haben sie uns zu sagen und warum? Immer steht der Biograph in einem schlechten Licht. Entweder neigt er, wie nachfolgende Ausbesserungsbiographen herausfinden, zur Zensur, oder er ist verliebt in seinen Gegenstand, was ihn blind macht wiederum für dessen blinde Flecken. Man möchte unter diesen Umständen keine Biographin sein! Es sei denn, man macht aus den blinden Flecken eine eigene Kunstform. So wie Angela Steidele.
Waren es in ihrem Roman "Aufklärung" zwei von der Geschichtsschreibung ausgeklammerte Blaustrümpfe des achtzehnten Jahrhunderts (Dorothea Bach und Luise Gottsched, Bachs Tochter und Gottscheds Ehefrau), so sind es jetzt die zwei Ikonen der frühen Kinogeschichte: Marlene Dietrich und Greta Garbo. Und weil es sich um Leinwandheldinnen handelt, wählt Steidele als Biographin die Sprache ihres Mediums.
Ihre Geschichte beginnt in einem Kino. Wir, das heißt das lesende Publikum, sitzen im Dunkeln. Die Autorin projiziert ihre Assoziationen, ihre Rechercheergebnisse, ihre Dokumente und Skizzen auf eine Leinwand, auf der wir dann Folgendes zu sehen bekommen: Greta Garbo und ihre lebenslange Freundin (nicht Geliebte!), die Drehbuchautorin Salka Viertel, sitzen zusammen im schweizerischen Klosters. Sie unterhalten hier so etwas wie eine Teestundenfreundschaft und reden über die guten, wie auch die schlechten alten Zeiten. Wir schreiben das Jahr 1969.
Schnell kommt danach die Kinomontage zum Einsatz. Zack springt das Bild ins Berlin des Jahres 1924, wo sich Klaus und Erika Mann, eine blutjunge Schwedin namens Greta, ein junges Bühnentalent namens Marlene und noch ein paar andere Personen der Zeitgeschichte bei Tango, Travestie und Moët & Chandon zum ersten Mal begegnen. Die Dietrich und die Garbo, wie man die beiden Schauspielerinnen bald nur noch nennen wird, beäugen sich in nicht ganz ungeschlechtlicher Manier.
Das wichtigste Personal des Romans wird in dieser Spelunke der Goldenen Zwanziger einmal vorgestellt. Wie in einer Regieanweisung. Wer steht wo mit wem und sagt was, tauscht welche verräterischen Blicke oder Informationen mit wem aus? Klaus Mann ist ein talentierter Angeber und gibt sich als Rebell: "Mit eisernem Willen, geschlossenen Augen und Phantasien von dem Zwillingsbruder unserer Mutter hat unser Vater sechs Kinder gezeugt." Schwester Erika ist mit Freundin Pamela Wedekind unterwegs, hat aber ansonsten auch Augen für die hohen Wangenknochen der jungen Schauspielerinnen.
Steidele, die seit Jahrzehnten zur lesbischen Kulturgeschichte forscht und schreibt, setzt auch in diesem Buch ihren persönlichen Akzent. Es geht also viel um die Blicke der Frauen füreinander. Wir sind, was das betrifft, schnell im Bilde. Und werden gelegentlich von der Erzählerin mit einem beherzten "wir" auf unseren Zuschauerrängen abgeholt: "Wir sehen, es arbeitet in Marlene."
Seite um Seite gesellt sich ein neuer Zeuge der Filmgeschichte zu unserer Champagnergesellschaft, in der mächtig gewerkelt wird an den künstlerischen und politischen Ideen der Zeit. Rudilein, Marlenes Feigenblattehemann. Gustaf Gründgens, Erikas Feigenblattehemann. Oder Mercedes de Acosta, die bei Steidele zu Garbos Geliebter wird, obwohl es dafür wohl in der Garbo-Forschung keine Evidenzen gibt. Natürlich spazieren berühmte Regisseure wie Ernst Lubitsch oder Friedrich Wilhelm Murnau, der übrigens auch queer war, über die Leinwand.
Was ist nun aber die Handlung dieses halberfundenen Reigens von Personen der Zeitgeschichte? In erster Linie geht es um das, was die Welt des Kinos zwischen Faschismus, Exil und Reeducation bestimmt hat. Es geht um Filmpremieren und Drehs, um das intellektuellenfeindliche und prüde System Hollywood, um Juden in Kalifornien, um Widerstand und Mitläufertum, um entgrenzte Liebe und um Abhängigkeiten. Wobei Steidele ihre Themen oft so ausbuchstabiert, dass man sich manchmal bei der Bundeszentrale für politische Bildung wähnt. "Ich fand ja den Beitrag von Fritz Bauer zu deinem Prozess sehr klug. Du weißt, der Chefankläger im Auschwitz-Prozess." Das sagt Salka Viertel zu Erika Mann. Die kämpft 1969 gerade für ihren Bruder Klaus im Fall "Mephisto" gegen Gustaf Gründgens, der sich im Roman über einen Faschismus-Gewinnler wiedererkannt hatte und Persönlichkeitsrechte geltend machte.
Der Hang zum Lehrstück ist ein leider nicht zu übersehendes Minus des Buchs, das einen aber doch nicht davon abhält, mit ihm seinen Spaß zu haben. Das liegt daran, dass man natürlich mit dem Personal irgendwie vertraut zu sein scheint - mit seinen Kunstwerken und Haltungen, seinen Marotten und Tragödien. Aber auch daran, dass Steidele alles in einer Weise arrangiert, die neue Konstellationen ermöglicht. So heißt es einmal über den Widerstand der Erika Mann: "Du bist eine Kriegsgewinnlerin, wie Marlene Dietrich." Erst über ihren Widerstand ist Erika nämlich zur intellektuellen Ikone geworden, was ihr als Kabarettistin im München der Dreißiger nicht gelungen war.
"In einer Autobiografie kann man nie die ganze Wahrheit sagen, das lässt die Wirklichkeit ja gar nicht zu", sagt Erika zu ihrer Freundin Salka, die eine Autobiographie namens "The Kindness of Strangers" geschrieben hat, in der auch die Garbo vorkommt. So ist es. Weswegen dieses Buch gar nicht erst den Versuch unternimmt, die ganze Wahrheit zu sagen. Der Rest ist gut erfunden. Und zwar von Angela Steidele, die zwei Mal in ihrem Roman einen eigenen Auftritt hat: "Ich hatte den Eindruck, dass sie mir gar nicht zuhört. Oder mich falsch versteht", berichtet die Dietrich einmal der Garbo. Die Biographin hatte sie zuvor in Paris in ihrer Wohnung überfallen. "Sie ist ganz besessen davon, ob wir zwei uns kennen." Auf Oberflächen kann man sich eben prima spiegeln. KATHARINA TEUTSCH
Angela Steidele: "Ins Dunkel". Roman.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 356 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.