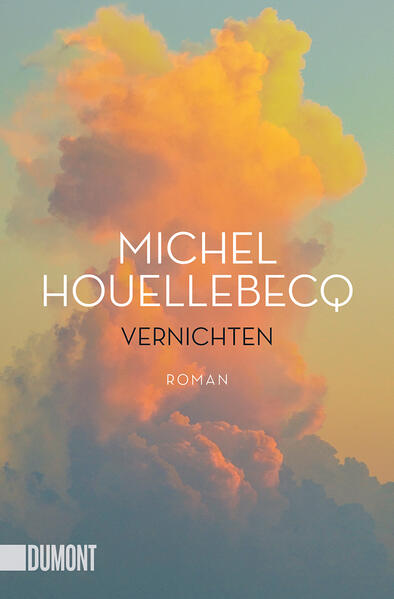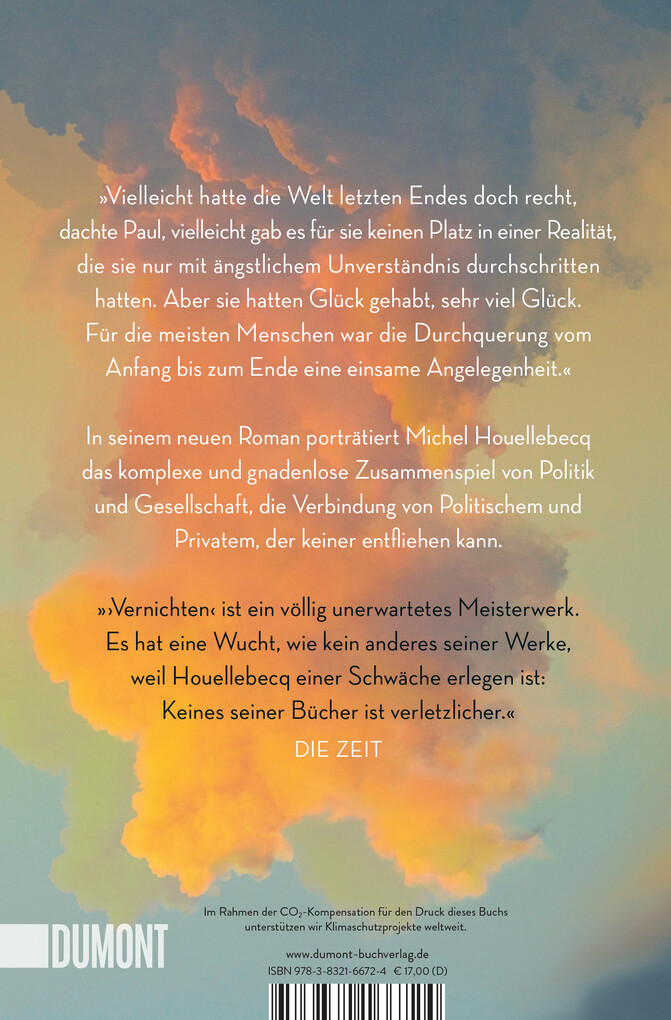Besprechung vom 02.08.2025
Besprechung vom 02.08.2025
In Bewunderung Houellebecqs
Es ist gar nicht so leicht, grün zu sein: Sylvie Schenks Roman "In Erwartung eines Glücks"
Man müsse der Sache misstrauen, warnten französische Literaturkritiker vor Michel Houellebecqs Lebensbilanzroman "Anéantir", der 2022 unter dem Titel "Vernichten" auf Deutsch erschienen war. Houellebecq lieferte in diesem Roman um den krebskranken Ministerialbeamten Paul Raison zwar immer noch verlässlich Pornographie, Politik und Philosophie, aber er schlug auch ungewohnt zartfühlende Töne an. Sein Protagonist beschäftigt sich mit der Metaphysik des Alters. Sein Kritiker Johan Faerber hingegen beschäftigte sich mit der Metaphysik des alten Schriftstellers: "Er nutzt die Metaphysik, das Alter und den Tod lediglich als Erzählmethode", rumpelte der Chefredakteur von "Diacritik".
Die Unterstellung, Michel Houellebecq sei nur ein Trittbrettfahrer jenes Lebensalters, aus dessen Warte alles irgendwie bedeutsam klinge, war nicht gänzlich von der Hand zu weisen. Mit gleichem Recht aber könnte man jetzt mit Sylvie Schenks Romanheldin Irène, einer Leserin von "Anéantir", auch einwenden: "Irène kannte es von vielen bekannten Schriftstellern, dass sie sich am Ende ihres Lebens nur noch wiederholten, das gleiche Buch in Schleifen schrieben und dabei immer schwächer und unsichtbarer wurden." Das heißt: Alter, Krankheit und Tod sind - egal wie sie bearbeitet werden - die epischen Gefahrenzonen der Literatur, in denen auch gestandene Romanciers ihren Autorentod sterben können.
Als Meisterin literarischer Selbsterkundungen geht Sylvie Schenk das Problem des Altersromans deswegen äußerst frontal an: Die 1944 in Chambéry geborene Autorin war mit ihrem Roman "Maman" für den Deutschen Buchpreis nominiert. Wie Schenks vorherige Romane auch war "Maman" der Versuch, die Prägungen seiner Figuren zu rekonstruieren und ihre Lebensprobleme autobiographisch zu reflektieren. "In Erwartung eines Glücks" ist die Abrundung dieser literarischen Selbstbefragung. Dabei hilft Houellebecq, dessen Altersroman Irène im Krankenhaus wie einen Teddybären im Arm hält, wenn sie nicht gerade darin liest.
Ins Aachener Spital hat ein Freund die noch nicht lang verwitwete Schriftstellerin gebracht. Diagnose: Hirnhautentzündung. Irène muss liegen. Und nachdenken. Nachdenken über ihren verstorbenen Ehemann Johann, einen sensiblen Deutschen. Beide konnten sich in der Sprache des anderen gut vor sich selbst verstecken. "Beide wollten einen Jemand aus dem Ausland heiraten. In der Hoffnung, das Gefühl des Fremdseins in sich selbst zu löschen."
Und dennoch bleiben sie allein auf ihre Weise: Johann, der Schweigsame; Irène, die Temperamentvolle. "Sie fragte sich zum hundertsten Mal, was eine lange Ehe bedeutete. Einen langsamen Schiffbruch, der bei vermögenden Menschen im Robinson-Club enden konnte?" Nein, so war es bei ihnen nicht gewesen. "So friedlich war es, das Liegen und das Lesen, der knappe Austausch, die Landschaft, die unaufgeregte Zufriedenheit des Alters."
Im Krankenhaus begegnet Irène ein Patient im grünen Morgenrock, den sie Froschmann nennt und dem sie Briefe an Johann zusteckt. Die Idee der Figurenüberblendung kommt einem zu Beginn noch abgeschmackt vor, doch bald begreift man, dass Grün nicht nur die Farbe der Hoffnung ist, sondern auch, dass Frösche quaken. Ganz im Gegensatz zum verstorbenen Johann, der sich in ein unergründliches Schweigen zurückgezogen hatte.
Die drei Ehen des Froschmanns interessieren Irène brennend. Woran sind sie gescheitert? Wie sich herausstellt, daran, dass die Frauen immer zu viel wollten und dass sie darüber irgendwie unliebenswürdig wurden. "'Zu viel schwätzen hindert, dass man seine Worte auswählt', schwätzte der Mann weiter", heißt es im Roman, und Irène fragt sich: War auch sie eine dieser Frauen gewesen, deren Wollen den Mann zum Schweigen gebracht hatte? "Sie hoffte aber noch immer, dass ihr Mann endlich mit ihr sprechen würde, und nicht nur über die Einkaufsliste. Sie hoffte es viele, viele Jahre lang. Die Hoffnung starb nie. Er aber."
Erforschte "Maman" noch die Gründe für das Verstummen der eigenen Mutter, die vermutlich das Kind einer Prostituierten gewesen war, geht es jetzt darum, das Verstummen des Ehemanns zu verstehen. Und so wie Paul Raison, der houellebecqsche Romanheld, im Angesicht seiner Krankheit - ausgerechnet Mundkrebs! - Frieden mit der Institution einer Ehe macht, erkennt Irène, dass sie ihr Leben trotz aller unerfüllten Sehnsüchte doch zusammen mit Johann gestaltet hat. Paul Raison wird für Schenk über diese ebenso triviale wie triftige Erkenntnis zum Lebensabschnittspartner: "Ja, sie war der kleine Kobold in seiner Tasche, sie hatte sich in sein Leben infiltriert, folgte ihm ins Gewächshaus des Elternhauses, als er mit dem gelähmten Vater im Rollstuhl still den Sonnenuntergang bewunderte, beide in einer liebevollen Ekstase geeint; sie begleitete ihn zum Wirtschaftsminister, Bruno, als er dessen Chancen für die Präsidentschaftswahl abwog; sie hielt seinen Kopf zwischen ihren Händen, als ihm zwei Weisheitszähne herausoperiert wurden, sie stärkte ihm den Rücken, als er beim Chirurgen die Amputation der Zunge ablehnte."
Houellebecqs Buch taucht im Roman immer wieder auf, es wechselt in die Hände der Zimmergenossin, eines vermeintlich todkranken muslimischen Mädchens, das sich von Irène die besten Sexstellen aus "Vernichten" vorlesen lässt. Erst ganz am Schluss wird Sylvie Schenk in einer gelungenen Pointe auflösen: Die Krankheit markiert keinen Endpunkt, sondern sie schlägt eine Bresche hinein ins Leben.
Sylvie Schenk hat in diesem Spätwerk viel untergebracht. Sie collagiert Briefe, Gedichte, Lektüren, Rückblicke, Phantasien und Träume zu einer Meditation über das Glück, zu dem das Lesen unbedingt dazugehört. Auch das Lesen eines altersmilden Houellebecqs, dem die meisten Kritiker die versöhnlichen Töne nicht abgenommen haben. Sylvie Schenk aber schon. KATHARINA TEUTSCH
Sylvie Schenk: "In Erwartung eines Glücks". Roman.
Hanser Verlag,
München 2025.
176 S. geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.