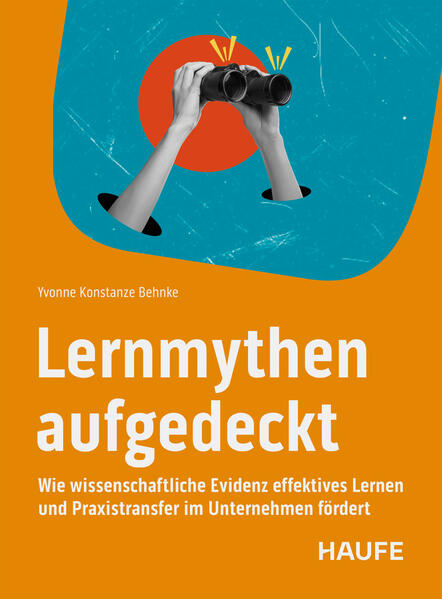Beim Cover dieses Buches stolpere ich sofort über den Untertitel, der mich aber gleichzeitig auch sehr neugierig macht. Wird Yvonne Konstanze Behnke im Rahmen der wissenschaftlichen Evidenz auf die mir so wichtige Triangulation der Evidenzbasierung eingehen? Werden konkrete Beispiele und Methoden bezüglich Praxistransfer formuliert und integriert?
Schnell ist meine angestrebte Detektivmanier, dieses Buch kritisch unter die Lupe zu nehmen, vergessen. Einerseits, weil ich beim Inhaltsverzeichnis sofort bei den Neuromythen hängen bleibe, weil mich dessen Inhalte im Rahmen der Neurodidaktik schon immer fesselten. Ich musste mich regelrecht dazu zwingen, nicht gleich auf Seite 117 vor zu blättern, um mich von neuen Neuromythen berieseln zu lassen. Gott sei Dank folgt gleich nach dem Inhaltsverzeichnis ein Lernmythenradar ein Lernerfolgstest zum Einstieg. Ich liebe Quizze und Rätsel, weil für mich im Rahmen des Constructive Alignment bei eigenen Lehrveranstaltungen das spielerische Integrieren von Vorwissen sehr wichtig und auch für mich selbst als kontinuierliche Lernende auch sehr effektiv ist.
22 Fragen zu unterschiedlichen Lernmythen, das sollte eigentlich ein Klacks für mich sein, da ich ja Yvonne Konstanze Behnkes Lernmythen-LinkedIn-Beiträge genauestens mitverfolge, einen Teil ihrer Weiterbildungen besuche und auch schon persönlich mit ihr im Kontakt war. Ich scheiterte aber beim Lernmythos «Übung macht den Meister». Wiederholung ist doch für die Elaboration, die Konsolidierung respektive für die konstante Verknüpfung neuer Synapsenverbindungen so wichtig? Stütze ich also meine Lehre seit 22 Jahren auf einem Mythos? Wieder muss ich mich zwingen, nicht gleich auf diesen Lernmythos vorzublättern...
Es folgt die Beschreibung der klassischen Verwechselung von Kausalität und Korrelation bezüglich Lerntheorien und -hypothesen. Leider ist diese Verwechslung einer der häufigen Biases bei der Interpretation von Resultaten für den Transfer in die Praxis auch bei den angewandten Gesundheitswissenschaften. Yvonne Konstanze Behnke benennt den Mythos Lerntypen als «Zombie» unter den Lernmythen, welcher auch mir immer noch ein riesiger Dorn im Auge ist. Deshalb erachte ich die differenzierte Klärung von verschiedenen Biases als sehr wichtig. Speziell gefiel mir der Verweis auf den Pygmalioneffekt in der Bildung auch Rosenthaleffekt genannt weil die selbsterfüllende Prophezeiung ein wichtiges Argument zur Falsifizierung der hartnäckigen Lerntypenhypothese darstellt.
Methodisch erachte ich die klare Strukturierung mit immer gleicher Reihenfolge der Kapitel als sehr lernförderlich. Yvonne Konstanze Behnke folgt hier dem passenden Sprichwort: «teach what you pray». Die Quellenverweise direkt nach jedem Kapitel motivieren mich für eine vertiefte Literaturrecherche zu gewissen Lernhypothesen. Die Lernmythencheckliste am Schluss des Buches, welche der eigenen Analyse und Erkennung von Lernmythen dient, schliesst das so wichtige Construcitve Alignment perfekt ab. Ich vermisste einzig den Verweis auf die wichtigste motivationspsychologische Quelle, die Arbeit von Deci&Ryan (2008), in welcher auf die Wichtigkeit von Autonomie, Kompetenz und Eingebundenheit beim Lernen eingegangen wird.
Vielen Dank, Yvonne Konstanze Behnke, dass du mit deinem Buch präzise aufzeigst, wie 22 Mythen evidenzbasierte Lernstrategien verhindern können, oder warum «Vergessen» auch zum Lernen gehört. Du hast mich auch überzeugt, den Mythos «Übung macht den Meister», über welchen ich beim Lernmythenradar beim Einstieg stolperte, viel differenzierter zu betrachten und zu hinterfragen. Ich möchte mit dieser Buchrezension alle Lehrenden - von der Grundschule bis in die Hochschule motivieren, dieses Buch zu kaufen, damit Lehrveranstaltungen nicht mehr auf vorschnell verifizierten Grundlagen und Theorien aufbauen.