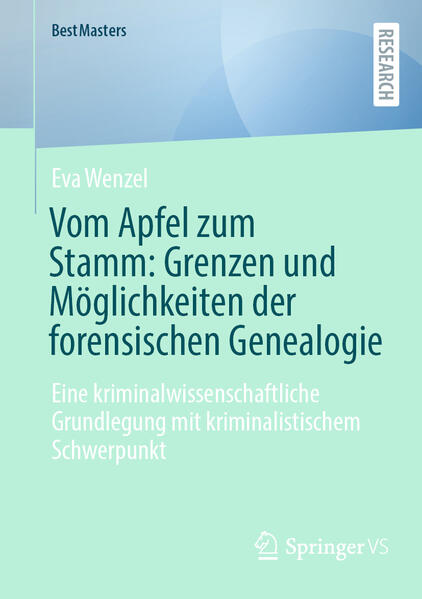
Obwohl die DNA-Analyse seit der Entdeckung des genetischen Fingerabdrucks große Fortschritte gemacht hat, bleiben immer noch etwa zwei Drittel aller Spuren in der DNA-Analyse-Datei, der nationalen DNA-Datenbank, ohne Treffer. Diese erhebliche Menge nicht zuordenbarer Spuren lässt eine wissenschaftlich-forensische sowie auch aus Sicht der Opfer schwerwiegender Straftaten eine evidente kriminalwissenschaftliche Lücke erkennen. Seit 2017 wird daher über neue Ansätze wie die forensische Genealogie diskutiert. Diese Methode kombiniert die klassische DNA-Analyse mit genealogischen Verfahren und kann beispielsweise dabei helfen, unbekannte Tote zu identifizieren oder ungelöste Fälle aufzuklären. Hierzu wird das fragliche DNA-Material mit Daten aus genealogischen DNA-Datenbanken abgeglichen, die keinen primär strafprozessualen Zweck verfolgen. Der Einsatz genetischer Daten aus solchen Datenbanken eröffnet neue Ermittlungsansätze, wirft jedoch auch Fragen auf: Welche gesetzlichen Regelungen gelten für die forensische Genealogie in Deutschland? Ist ihre Anwendung ethisch vertretbar? Wie steht es um den Datenschutz? Gibt es in Deutschland überhaupt genügend verfügbare genetische Datensätze, um diese Methode erfolgreich anzuwenden?
Inhaltsverzeichnis
Einleitende kriminalwissenschaftliche Grundlegung. - Forensische Grundlagen. - Datenschutz und andere rechtliche Regelungen für den FIGG-Einsatz. - Ethische Bedenken und Öffentlichkeitsarbeit. - Nutzen der FIGG in anderen Ländern. - Abwägung des Nutzens der FIGG in Deutschland. - Fazit und Ausblick.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Vom Apfel zum Stamm: Grenzen und Möglichkeiten der forensischen Genealogie" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









