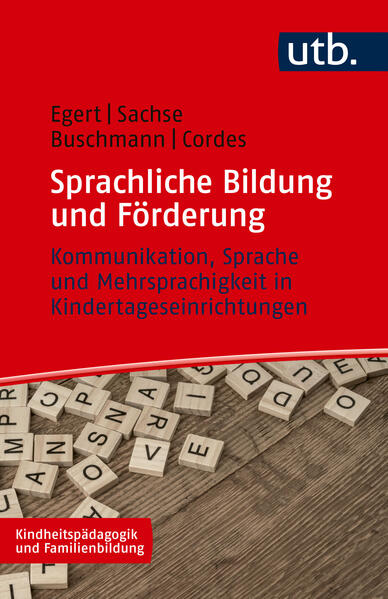
Zustellung: Fr, 04.07. - Mo, 07.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Dieser Band vermittelt praxisnah die Grundprinzipien sprachlicher Bildung und Förderung, Wissen über Sprachentwicklung, Sprach- und Sprechstörungen sowie Beobachtungs- und Dokumentationsprozesse. Ein besonderes Augenmerk liegt auf Mehrsprachigkeit, der Nutzung digitaler Medien für gelingende Interaktionen und Elternarbeit.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 13
Teil I
2 Ein erster Überblick zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung 21
2. 1 Die Bedeutung von Sprache als Schlüsselkompetenz 22
2. 2 Aktuelle Trends und Herausforderungen der sprachlichen Bildung und Förderung in Kindertageseinrichtungen 24
2. 2. 1 Gesetzliche Verankerung sprachlicher Bildung und Förderung in der Kindertageseinrichtung 24
2. 2. 2 Aktuelle Initiativen und Förderbestrebungen 26
2. 2. 3 Entwicklung von additiven Sprachförderprogrammen hin zu ganzheitlichen Konzepten 31
2. 3 Paradigmenwechsel und aktueller Stand der Sprachförderdiskussion 35
3 Qualität und Quantität sprachlicher Bildung und Förderung 38
3. 1 Qualität und Quantität sprachlicher Anregung in Kindertageseinrichtungen 39
3. 2 Untersuchung sprachlicher Anregungsqualität und renommierte Ratingverfahren 45
3. 3 Qualität der linguistischen Responsivität 49
3. 4 Steigerung der Qualität von FachkraftKind Interaktionen und kindliche Sprachentwicklung 51
4 Sprachentwicklung und die Bedeutung der sprachlichen Umwelt 57
4. 1 Linguistische Grundbegriffe 58
4. 2 Warum wir sprechen lernen Vorläuferfähigkeiten des Kindes und Umweltbedingungen 62
4. 3 Kindgerichtete Sprache 66
4. 4 Sprachentwicklung im Überblick 68
4. 4. 1 Frühe (vorsprachliche) Entwicklungen, Vorbereitung auf die Sprachproduktion 68
4. 4. 2 Überblick über Meilensteine der Sprachentwicklung 70
5 Sprachliche Auffälligkeiten und Störungen 78
5. 1 Variabilität in der Sprachentwicklung Verschieden sein ist normal 79
5. 2 Überblick über Auffälligkeiten der Sprachentwicklung 80
6 Mehrsprachigkeit 86
6. 1 Begrifflichkeit und Definitionen 87
6. 2 Unterschiedlichkeit von Sprachen Herausforderungen beim Erlernen der deutschen Sprache 89
6. 3 Mehrsprachige Sprachentwicklung 92
6. 4 Mehrsprachigkeit in der Kindertagesstätte 97
7 Erfassung sprachlicher Leistungen im Alltag einer Kindertagesstätte 103
7. 1 Überblick über Ansätze zur Erfassung sprachlicher Leistung und sprachlicher Auffälligkeiten 104
7. 2 Vorgehensweise in der Praxis 107
8 Sprachförderung 109
8. 1 Begriffliche Grundlagen und Ausdifferenzierung 110
8. 2 Diagnosegeleitete Sprachförderung 124
8. 2. 1 Transfer zwischen Sprachstand und Sprachförderung 124
8. 2. 2 Datenbasierte Förderentscheidung 127
8. 2. 3 Stufeninterventionsmodelle und Mehrkomponentenförderung 133
8. 2. 4 Zirkuläre Fallarbeit 138
8. 3 Evidenzbasierte Sprachförderung 142
8. 3. 1 Wirksamkeit additiver Kleingruppenangebote und Erklärungsansätze für das
Ausbleiben der Fördereffekte 145
8. 3. 2 Wirksamkeit alltagsintegrierter und
interaktionsbasierter Sprachförderung sowie effektive Qualifizierung 149
8. 3. 3 Sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern und erfolgversprechende Ansätze 153
8. 3. 4 Stolpersteine und Praxisimplikationen wirksamer Sprachförderung 157
Teil II
9 Kommunikation und Interaktion 165
9. 1 Kommunikations und Interaktionsstile von Kindern und Erwachsenen 167
9. 2 Sprachanregende Grundhaltung 173
9. 3 Gezielter Einsatz von Sprachlehrstrategien 175
9. 4 Gezielter Einsatz sprachmotivierender Fragen 177
9. 5 Sprachförderliche Interaktionen beim Betrachten oder Vorlesen von Büchern 181
9. 5. 1 Dialogische Bilderbuchbetrachtung 181
9. 5. 2 Dialogisches Lesen 184
9. 5. 3 Fragen stellen beim Vorlesen 186
9. 5. 4 Wirksamkeit der Schulung von Fachkräften im Dialogischen Lesen 187
9. 6 Interaktionen unter erschwerten Bedingungen: Kinder mit verzögertem oder auffälligem Spracherwerb 188
10 Räumlich-materielle Umgebung und Situationsgestaltung 192
10. 1 Die Bedeutung der räumlichmateriellen Ressourcen bei sprachbildenden und fördernden Prozessen 194
10. 1. 1 Sichtbarkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Materialien als Qualitätsindikator 196
10. 1. 2 Didaktisches Dreieck und Aufmerksamkeitsfokus 197
10. 2 Lärmpegel, räumlichmaterielle Bedingungen und
Sprachhandeln sind entscheidend für das Sprach und Hörverständnis 198
10. 3 Räumlichmaterielle Gelingensbedingungen und Sprachhandeln zur Förderung
Sprachproduktiver Leistungen 205
10. 4 Binnenorganisation und sprachliche Bildung in der Einzel und Gruppensituation 211
11 Unterstützung sprachlichen Lernens mit digitalen Medien 217
11. 1 Aufwachsen mit digitalen Medien und der Einsatz digitaler Medien in Kindertageseinrichtungen 218
11. 2 Potenziale digitaler Medien zur Unterstützung sprachlichen Lernens 222
11. 2. 1 Befunde zum Unterstützungspotenzial aus Praxis und Wissenschaft 222
11. 2. 2 Vorgehen bei der Konzeption von Aktivitäten zur sprachlichen Unterstützung mit digitalen Medien 227
11. 3 Digitale Medien mit Inhaltsrahmen sprachunterstützend einsetzen: Dialogisches Lesen digitaler Bilderbücher 230
11. 4 Digitale Medien mit Gestaltungsrahmen sprach
unterstützend einsetzen: Entwicklung eines StopMotionFilms 243
11. 5 Fazit der Potenziale digitaler Medien zur sprachlichen Bildung und Förderung 247
12 Zusammenarbeit mit den Eltern: Sprachliche Bildung über Bildungsorte hinweg gestalten 249
12. 1 Die Eltern von Beginn an informieren und einbeziehen 252
12. 1. 1 Die Kita gestalten 252
12. 1. 2 Das Aufnahme/Anmeldegespräch gemeinsam mit der Sprachfachkraft 254
12. 1. 3 Eingewöhnungsphase Vorbild sein 254
12. 1. 4 Eingewöhnungsphase Brücken bauen 255
12. 1. 5 Elternabende zur alltagsintegrierten (mehr)sprachlichen Bildung 257
12. 1. 6 Erfolgreiche Projekte zur Partizipation der Eltern 261
Literatur 264
Teil I
2 Ein erster Überblick zur sprachlichen Bildung und Sprachförderung 21
2. 1 Die Bedeutung von Sprache als Schlüsselkompetenz 22
2. 2 Aktuelle Trends und Herausforderungen der sprachlichen Bildung und Förderung in Kindertageseinrichtungen 24
2. 2. 1 Gesetzliche Verankerung sprachlicher Bildung und Förderung in der Kindertageseinrichtung 24
2. 2. 2 Aktuelle Initiativen und Förderbestrebungen 26
2. 2. 3 Entwicklung von additiven Sprachförderprogrammen hin zu ganzheitlichen Konzepten 31
2. 3 Paradigmenwechsel und aktueller Stand der Sprachförderdiskussion 35
3 Qualität und Quantität sprachlicher Bildung und Förderung 38
3. 1 Qualität und Quantität sprachlicher Anregung in Kindertageseinrichtungen 39
3. 2 Untersuchung sprachlicher Anregungsqualität und renommierte Ratingverfahren 45
3. 3 Qualität der linguistischen Responsivität 49
3. 4 Steigerung der Qualität von FachkraftKind Interaktionen und kindliche Sprachentwicklung 51
4 Sprachentwicklung und die Bedeutung der sprachlichen Umwelt 57
4. 1 Linguistische Grundbegriffe 58
4. 2 Warum wir sprechen lernen Vorläuferfähigkeiten des Kindes und Umweltbedingungen 62
4. 3 Kindgerichtete Sprache 66
4. 4 Sprachentwicklung im Überblick 68
4. 4. 1 Frühe (vorsprachliche) Entwicklungen, Vorbereitung auf die Sprachproduktion 68
4. 4. 2 Überblick über Meilensteine der Sprachentwicklung 70
5 Sprachliche Auffälligkeiten und Störungen 78
5. 1 Variabilität in der Sprachentwicklung Verschieden sein ist normal 79
5. 2 Überblick über Auffälligkeiten der Sprachentwicklung 80
6 Mehrsprachigkeit 86
6. 1 Begrifflichkeit und Definitionen 87
6. 2 Unterschiedlichkeit von Sprachen Herausforderungen beim Erlernen der deutschen Sprache 89
6. 3 Mehrsprachige Sprachentwicklung 92
6. 4 Mehrsprachigkeit in der Kindertagesstätte 97
7 Erfassung sprachlicher Leistungen im Alltag einer Kindertagesstätte 103
7. 1 Überblick über Ansätze zur Erfassung sprachlicher Leistung und sprachlicher Auffälligkeiten 104
7. 2 Vorgehensweise in der Praxis 107
8 Sprachförderung 109
8. 1 Begriffliche Grundlagen und Ausdifferenzierung 110
8. 2 Diagnosegeleitete Sprachförderung 124
8. 2. 1 Transfer zwischen Sprachstand und Sprachförderung 124
8. 2. 2 Datenbasierte Förderentscheidung 127
8. 2. 3 Stufeninterventionsmodelle und Mehrkomponentenförderung 133
8. 2. 4 Zirkuläre Fallarbeit 138
8. 3 Evidenzbasierte Sprachförderung 142
8. 3. 1 Wirksamkeit additiver Kleingruppenangebote und Erklärungsansätze für das
Ausbleiben der Fördereffekte 145
8. 3. 2 Wirksamkeit alltagsintegrierter und
interaktionsbasierter Sprachförderung sowie effektive Qualifizierung 149
8. 3. 3 Sprachliche Förderung von mehrsprachigen Kindern und erfolgversprechende Ansätze 153
8. 3. 4 Stolpersteine und Praxisimplikationen wirksamer Sprachförderung 157
Teil II
9 Kommunikation und Interaktion 165
9. 1 Kommunikations und Interaktionsstile von Kindern und Erwachsenen 167
9. 2 Sprachanregende Grundhaltung 173
9. 3 Gezielter Einsatz von Sprachlehrstrategien 175
9. 4 Gezielter Einsatz sprachmotivierender Fragen 177
9. 5 Sprachförderliche Interaktionen beim Betrachten oder Vorlesen von Büchern 181
9. 5. 1 Dialogische Bilderbuchbetrachtung 181
9. 5. 2 Dialogisches Lesen 184
9. 5. 3 Fragen stellen beim Vorlesen 186
9. 5. 4 Wirksamkeit der Schulung von Fachkräften im Dialogischen Lesen 187
9. 6 Interaktionen unter erschwerten Bedingungen: Kinder mit verzögertem oder auffälligem Spracherwerb 188
10 Räumlich-materielle Umgebung und Situationsgestaltung 192
10. 1 Die Bedeutung der räumlichmateriellen Ressourcen bei sprachbildenden und fördernden Prozessen 194
10. 1. 1 Sichtbarkeit, Verfügbarkeit und Zugänglichkeit von Materialien als Qualitätsindikator 196
10. 1. 2 Didaktisches Dreieck und Aufmerksamkeitsfokus 197
10. 2 Lärmpegel, räumlichmaterielle Bedingungen und
Sprachhandeln sind entscheidend für das Sprach und Hörverständnis 198
10. 3 Räumlichmaterielle Gelingensbedingungen und Sprachhandeln zur Förderung
Sprachproduktiver Leistungen 205
10. 4 Binnenorganisation und sprachliche Bildung in der Einzel und Gruppensituation 211
11 Unterstützung sprachlichen Lernens mit digitalen Medien 217
11. 1 Aufwachsen mit digitalen Medien und der Einsatz digitaler Medien in Kindertageseinrichtungen 218
11. 2 Potenziale digitaler Medien zur Unterstützung sprachlichen Lernens 222
11. 2. 1 Befunde zum Unterstützungspotenzial aus Praxis und Wissenschaft 222
11. 2. 2 Vorgehen bei der Konzeption von Aktivitäten zur sprachlichen Unterstützung mit digitalen Medien 227
11. 3 Digitale Medien mit Inhaltsrahmen sprachunterstützend einsetzen: Dialogisches Lesen digitaler Bilderbücher 230
11. 4 Digitale Medien mit Gestaltungsrahmen sprach
unterstützend einsetzen: Entwicklung eines StopMotionFilms 243
11. 5 Fazit der Potenziale digitaler Medien zur sprachlichen Bildung und Förderung 247
12 Zusammenarbeit mit den Eltern: Sprachliche Bildung über Bildungsorte hinweg gestalten 249
12. 1 Die Eltern von Beginn an informieren und einbeziehen 252
12. 1. 1 Die Kita gestalten 252
12. 1. 2 Das Aufnahme/Anmeldegespräch gemeinsam mit der Sprachfachkraft 254
12. 1. 3 Eingewöhnungsphase Vorbild sein 254
12. 1. 4 Eingewöhnungsphase Brücken bauen 255
12. 1. 5 Elternabende zur alltagsintegrierten (mehr)sprachlichen Bildung 257
12. 1. 6 Erfolgreiche Projekte zur Partizipation der Eltern 261
Literatur 264
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. Juni 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
296
Reihe
Kindheitspädagogik und Familienbildung, 6
Autor/Autorin
Anke Buschmann, Anne-Kristin Cordes, Franziska Egert, Steffi Sachse
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
13 SW-Abb., 23 Tabellen
Gewicht
272 g
Größe (L/B/H)
181/118/20 mm
ISBN
9783825258375
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Aus: ekz-Infodienst Brigitte Krompholz-Roehl KW 32/2024
[ ] Gut strukturiert, geeignet, sich mit den verschiedenen Konzepten, Strategien und Methoden zur sprachlichen Bildung auseinanderzusetzen und zu lernen. Auch die Unterstützung sprachlichen Lernens mit digitalen Endgeräten und die Nutzung digitaler Medien als Konzept und Strategie für gelingende Interaktion und Elternarbeit wird berücksichtigt. [ ]
Aus: bibliomaniacs A. Berreßem 26. 08. 2024
[ ] Zusammengefasst ist Sprachliche Bildung und Förderung ein umfassendes Werk, das sich mit den vielen Facetten der Sprachförderung in der frühen Kindheit auseinandersetzt. Es bietet sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Tipps, wie Kinder beim Spracherwerb unterstützt werden können von der täglichen Kommunikation über gezielte Fördermaßnahmen bis hin zur Einbindung digitaler Medien und der Zusammenarbeit mit den Eltern.
Ein äußerst praxisnahes und informatives Buch, das die wichtigsten Aspekte der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen klar und verständlich vermittelt. Besonders hilfreich für Erzieher und pädagogische Fachkräfte!
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Sprachliche Bildung und Förderung" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.

















