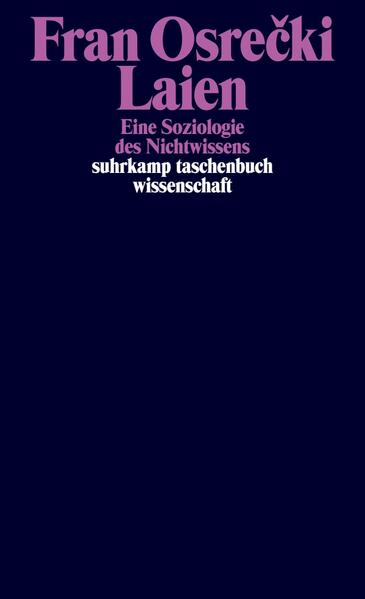Besprechung vom 02.10.2025
Besprechung vom 02.10.2025
Nichtwissen ist Macht
Ignoranz als Treibstoff moderner Gesellschaften: Fran Osreckis soziologische Erkundung des Laien
Um als Patient, als Konsument oder als Wähler nicht übers Ohr gehauen zu werden, müsse man gut informiert sein, noch bevor man einer Operation zustimmt, einen Computer kauft oder sein Kreuz bei einer bestimmten Partei macht. Wissen ist Macht - so lautet eine altbekannte, weil unmittelbar einleuchtende Alltagsregel. Ihr folgt meist auch jener Teil der Soziologie, der sich mit dem Charakter von Alltagsrollen befasst. Dort untersucht man gern den zivilgesellschaftlich engagierten Bürger, den medizinisch vorgebildeten Patienten oder den moralischen Käufer, weil diese Rollen das Machtgefälle zwischen Laien und Experten aufzubrechen scheinen.
Dasselbe gilt umgekehrt auch für das Objekt der Kritik: Die Gesundheitspolitik will den Supermarkteinkäufer, der, ohne nachzudenken, zur Tiefkühlpizza greift, mittels Lebensmittelampeln über Fettgehalte aufklären, die Wissenschaft den Studienteilnehmer in die Zwecke ihrer Untersuchung einweihen und das Bildungssystem dem Wähler am besten ein Leben lang "Medienkompetenz" beibringen, damit er vorurteilsfrei politische Entscheidungen treffen kann. Immerzu soll der einfache Bürger aufgeklärt und ermächtigt werden.
Gegen "Laienidealisierungen" wie diese hat Fran Osrecki, Professor für Allgemeine Soziologie an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht, nun eine Abhandlung verfasst, die der allgemeinen Hochschätzung des Engagements und Informiertseins eine "Soziologie des Nichtwissens" entgegensetzt. Was, so fragt das Buch, hat es damit auf sich, dass die Passivität der meisten Menschen stets als Problem- statt als Normalfall behandelt wird? Osrecki erhebt damit einen Anspruch, der weit über das hinausgeht, was der schlichte Titel "Laien" vermuten lässt: Es geht um die grundsätzliche Frage, ob die Inklusionstendenz moderner Gesellschaften gleichzeitig eine Zunahme der allgemeinen Partizipation bedeuten muss.
Laien, so das systemtheoretische Argument Osreckis, sind das Gegenstück zur modernen Professionalisierung. Wenn das allgemeine Bildungsniveau steigt und mehr Menschen einen spezialisierten Beruf ergreifen, dann ist das nur eine Seite der Medaille. Ärzte und Anwälte kann es nur dort geben, wo es auch Patienten und Klienten gibt. Der Sportjournalist kommt nicht ohne Sportfans aus, der Galerist nicht ohne Kunstpublikum. "Ohne breite Publika keine ausdifferenzierten Funktionssysteme", heißt es im Buch lapidar.
Statt, wie noch einige Klassiker des Fachs, das aus solchen Laien bestehende Massenpublikum als potentiellen Mob zu fürchten, dominiere seit der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, so Osrecki, allerdings die umgekehrte Sorge: Wie könnte der einfache, uninformierte Bürger dem Experten auf Augenhöhe begegnen? Man müsse ihn aufklären, ermächtigen, eine Stimme verschaffen, so die übliche Antwort. Die passive Einbeziehung immer größerer Bevölkerungskreise in die Funktionssysteme der Politik, des Wohlfahrtstaates, des Bildungs- und Gesundheitssystems solle mit einer Zunahme an aktiver Partizipation kompensiert werden.
Doch ist das überzeugend? Der gut informierte Laie, so wendet Osrecki dagegen ein, ist dem Experten oft genug sogar stärker ausgeliefert als der ahnungslose, weil er sich auf die Kriterien und Wissensbestände des Fachs bereits eingelassen hat. Und der Kläger in einem Gerichtsverfahren hat sich im Laufe des Prozesses so sehr an die Verfahren des Rechtssystems gebunden, dass es ihm schwerfällt, nach vielen Wochen und Monaten juristischer Argumentation dem Urteil mit dem Verweis auf sein privates Ungerechtigkeitsgefühl zu widersprechen. Wissen, so könnte man zusammenfassen, ist oft genug Ohnmacht, weil es den Laien zur Voranpassung an sein Gegenüber zwingt.
Wie die Inklusion von Laienpublika in eine funktional differenzierte Gesellschaft ohne Partizipation gelingen kann, bildet den Hauptgegenstand des Buches. Dass Ärzte für Gesprächstherapeuten gehalten werden, Konsumenten übers Wetter plaudern wollen, Mandanten Recht und Gerechtigkeit verwechseln und Straßenpolizisten Auskunft über den Zugfahrplan geben sollen, kommt ja häufig genug vor, um daran zu zweifeln, dass ahnungslose Laien ein unproblematisches Publikum bilden.
Osrecki argumentiert, dass vor allem die Überdeterminierung der eigenen Rolle ein "funktionssystemadäquates" Laienverhalten herbeiführt. Das heißt, "Personen sind Trägerinnen nicht nur einer Rolle, sondern von mehreren, die untereinander aber oft inkompatibel sind". Man ist Katholik und Konsument, Arbeiter und Erbe, Familienmensch und Kollege zugleich. Weil das so ist, können Laienpublika die Funktionssysteme nur bedingt mit ihren privaten Befindlichkeiten traktieren. Denn sie tragen ihre unpassenden Orientierungen nicht konsequent an das jeweilige System heran. Der Patient will mal über die Politik und mal übers Wetter plaudern, und gerade deswegen kann er den Arzt nicht dazu verpflichten, ihn auf politisch bestimmte Weise zu behandeln. Er ist zu flatterhaft, um die Kriterien des politischen Systems dem Gesundheitssystem aufzuzwingen.
Die Unwissenheit und Inkonsequenz des modernen Menschen, so darf man nach Lektüre von "Laien" schlussfolgern, sind eigentlich glückliche Zufälle. Sie ermöglichen die Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme. Den modernen Profisport gibt es etwa nur deshalb, weil das Publikum keine konsistenten Rollen mehr einnimmt - etwa als Arbeiterschaft einer örtlichen Industrie einen lokalen Arbeitersportverein erwartet, der aus Betriebsangehörigen besteht und sich an den Kriterien außerbetrieblicher Freizeitgestaltung orientiert. Weil das Publikum mal dieses, mal jenes will, im Ganzen keine konsequenten Erwartungen aus der Arbeitswelt an das Sportsystem heranträgt, können die Verbände das sportliche Geschehen ganz am Kriterium der Leistung ausrichten. Autonomisierung und Ignoranz bedingen einander.
Das Buch überzeugt mit seinem systematischen Vorgehen, das, anders als andere soziologische Neuerscheinungen, erfreulicherweise nicht auf eine große zeitdiagnostische Pointe aus ist. Der abwägenden Argumentation will man schon deswegen gern folgen, weil sie üblichen Intuitionen widerspricht. Doch sobald der Soziologe sich dem politischen System zuwendet, wird die sonst so einleuchtende These fragwürdig, ja sogar widersinnig.
Für Osrecki profitiert auch die Politik von der Inkonsequenz und dem Nichtwissen der Wähler. Genauer gesagt: So wie der professionelle Sport oder die moderne Konsumwirtschaft gewinne das politische System auf diese Weise an Autonomie. In stark "versäulten" Gesellschaften dagegen, zu denen in der Nachkriegszeit bis zu einem gewissen Punkt auch die Bundesrepublik gehörte, lägen die Dinge anders: Wenn soziale Großgruppen - Arbeiter, Bürgertum, Landbevölkerung - nicht nur statistische Aggregate, sondern Klassen für sich bilden, das heißt mit einem kollektivem Bewusstsein handeln und mit eigenen, die gesamte Lebensbiographie prägenden Organisationen ausgestattet sind, verlaufe die Politik relativ überraschungsarm.
"Auseinandersetzungen im politischen System", so die zweifelhafte These, "sind dann exakte Kopien der Auseinandersetzungen außerhalb des politischen Systems." Die Parteien könnten sich ihrer angestammten Wähler sicher sein, hätten aber gerade deshalb extrem wenig Spielraum, eigene Themen zu setzen oder andere Wählerreservoires anzuzapfen. Die Atomisierung der Gesellschaft, das Herauslösen des Einzelnen aus festen, dauerhaften und konsistenten Bindungen an ein Milieu, eine Konfession oder eine Klasse wirke deshalb wie ein Befreiungsschlag - auch für die hauptamtlichen Politiker.
"Parteien wissen nicht, wie sich das Publikum verhalten wird, weil das Publikum seinerseits nicht weiß, wie es seine rollenvermittelten Interessen, Anliegen und Präferenzen sachlich und zeitlich konzise zur Grundlage der Wahlentscheidung machen soll." So lockern sich die Bande der anderen gesellschaftlichen Teilsysteme mit der Politik, die dadurch an Selbständigkeit gewänne.
Doch ist das wirklich ein Autonomiegewinn? Eine Politik, die um flatterhafte Wähler buhlen muss, hat höchstwahrscheinlich einen geringen Zeithorizont. Sie muss kurzfristige Erfolge versprechen, um auf dem Wählermarkt zu reüssieren, weil ihr keine Stammwählerschaft zur Verfügung steht, die langfristige Reformen mittragen würde. Und dem politischen System dürfte es kaum besser gelingen, kollektiv verbindliche Entscheidungen zu treffen, wo die anderen Funktionssysteme versagen, wenn launenhafte Wähler den Ton angeben, anstatt in Gewerkschaften, Kirchen und Handelskammern organisierten Großgruppen.
Für Osrecki ist der traditionelle Korporatismus europäischen Typs ein Hemmnis funktionaler Differenzierung. Dass die Integration einer modernen Gesellschaft besser gelingt, wenn sie über intermediäre Institutionen verfügt, die die große Kluft zwischen Politik und Gesellschaft verringern, kommt ihm nicht in den Sinn. Denkbar ist es, dass der Sieg der nicht wissenden Laien einen sportlicheren Sport und eine wirtschaftlichere Wirtschaft hervorgebracht hat. Eine politischere Politik, deren Freidrehen wir womöglich schon erleben, könnte sich jedoch als genau der Albtraum erweisen, den man sich - ganz alteuropäisch - darunter üblicherweise vorstellt. OLIVER WEBER
Fran Osrecki: "Laien". Eine Soziologie des Nichtwissens.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025.
336 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.