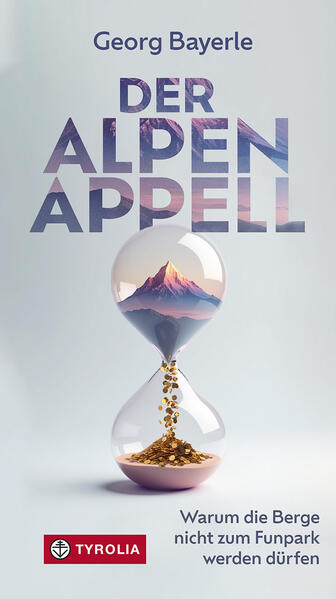Besprechung vom 14.09.2025
Besprechung vom 14.09.2025
Der Berg ruft zurück
Zynisch formuliert war der Zeitpunkt für dieses Buch perfekt: Kurz vor dem Erscheinungstermin zerstörte eine Eis- und Gerölllawine das Schweizer Bergdorf Blatten. "Früher waren das singuläre Ereignisse", schreibt Georg Bayerle, der Autor des Buches. "Heute wird die Gefahr zum Dauerzustand in den Alpen." Der Alpin-Journalist tritt mit "Der Alpen-Appell" als Mahner auf, er untersucht das immer fragiler werdende Ökosystem, hinterfragt die Wachstumsspirale der Erschließungen, die auch im Sommer aus den Alpen eine "dauerbespielte Plattform der Spaß- und Unterhaltungsindustrie" mache: Funparks wie der "Area 47" im Ötztal, der Sommer-Funpark in Serfaus-Fiss-Ladis mit zeitweise sommerlichem Kunstschnee und durchorganisierte Mountainbike-Trails in vielen Alpentälern.
Mahner gab es schon länger, aber das große Umdenken lässt weiter auf sich warten. Bayerle hat die "Rufer in der Wüste", so ein Kapitel, alle gelesen, Hans Haid, Werner Bätzing und den Fotografen Lois Hechenblaikner, nun fügt er seinen Appell hinzu. Über den wegweisenden Alpenplan aus Bayern, der Schutzzonen ausweist und 50 Jahre alt ist, schreibt Bayerle, dieser wäre "heute in dieser kompromisslosen Form undenkbar". Er benennt positive Beispiele wie die Bergsteigerdörfer, die auf gebremsten Wintertourismus ohne große Liftanlagen setzen, das stille Villgratental oder Vorarlberg, wo man dem Balkon-Barock des Alpen-Disney-Stils eine zeitgemäße Holzarchitektur entgegensetzt.
Doch auch wenn er sich vornimmt, es nicht zu tun, romantisiert Bayerle das Leben in den Alpen. Es gebe eine besondere Mentalität jener Menschen, die "sehr nah und unverfälscht in und mit den Bergen leben", sie eine das Unkomplizierte, das Vertrauen in die Mitmenschen, die Gelassenheit. Als gäbe es in den Bergen keine Missgunst, keine Verbrechen, keine Betrügereien. Und er romantisiert teilweise die alten Lebensweisen. Aber so, wie sich die Städte änderten, änderte sich eben auch der ländliche Raum - in den Alpen nur später und langsamer als in den norddeutschen Ebenen. Was Bayerle kaum beachtet, ist, dass das Damalige immer aus der Not geboren war. Es gab keine andere Lebenswirklichkeit. Die Industrialisierung änderte dies, auch im Alpenraum. Anstatt karg von der Hand in den Mund zu leben, wie Generationen zuvor, verbunden mit Tagelöhnertum, Auswanderungen der Männer in der Saison und natürlich mit Kinderarbeit, gab es nun eine Wahl. Es gab Jobs in der Fabrik, im Büro. Vor allem aber, der Aspekt wird oft vergessen, hatten Frauen plötzlich andere Möglichkeiten. Denn all das karge Leben in den Alpen funktionierte auch deshalb, weil vor allem die Frauen immer vor Ort blieben und schufteten. Auch die Männer arbeiteten hart, aber sie waren oft nicht da, verdingten sich als Träger oder zogen in den Krieg.
All das änderte sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg - mit dem Wintersport. Dass diese Spirale allerdings völlig überdreht ist, das analysiert Bayerle vorzüglich, gut lesbar und zusammengefasst. Wie etwa beim Bergrutsch in Blatten. Er betont dabei, es gehe beim Alpentourismus nicht um Verzicht. Er dreht es um und sagt, es gehe um eine Wahl, nicht um ein Dilemma, sondern um das Privileg der Frage: Wie will ich reisen?
Zu spät ist es nun allerdings für einen Besuch der Eiskapelle am Watzmann. Der berühmte Gletscherbogen ist diesen Dienstag eingestürzt, eine Folge des Klimawandels, wie der Nationalpark Berchtesgaden schreibt. Zynisch gesagt: Besuchen Sie die Alpen, solange es noch etwas zu sehen gibt. Anders gesagt: Genau jetzt ist der Zeitpunkt, um sich für die Alpen einzusetzen. BARBARA SCHAEFER
Georg Bayerle: Der Alpen-Appell. Warum die Berge nicht zum Funpark werden dürfen. Tyrolia Verlag, 160 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.