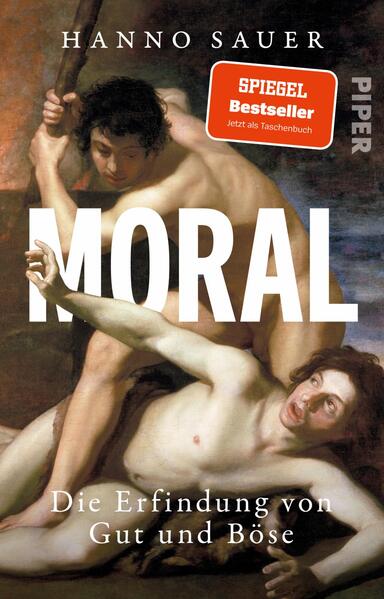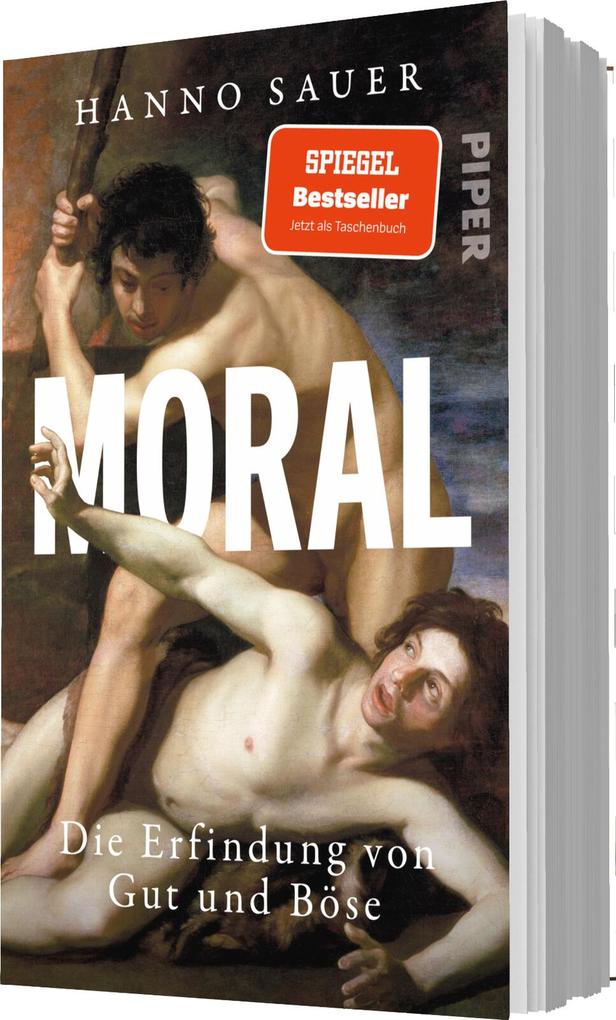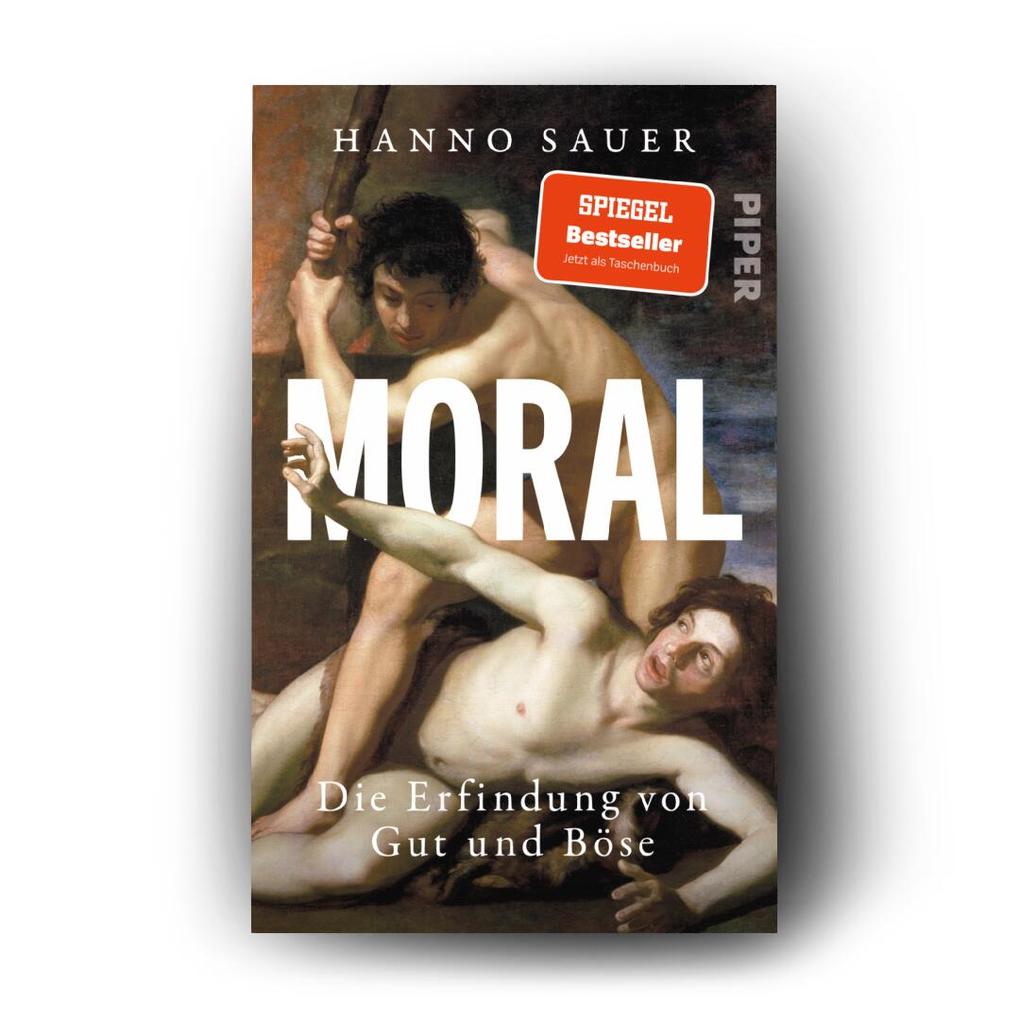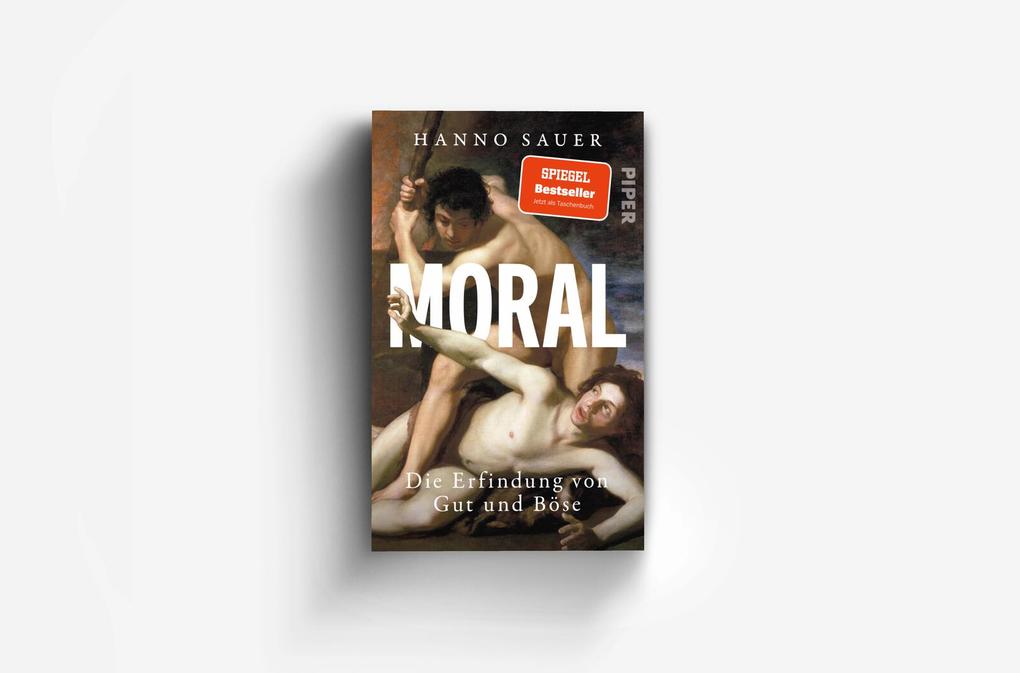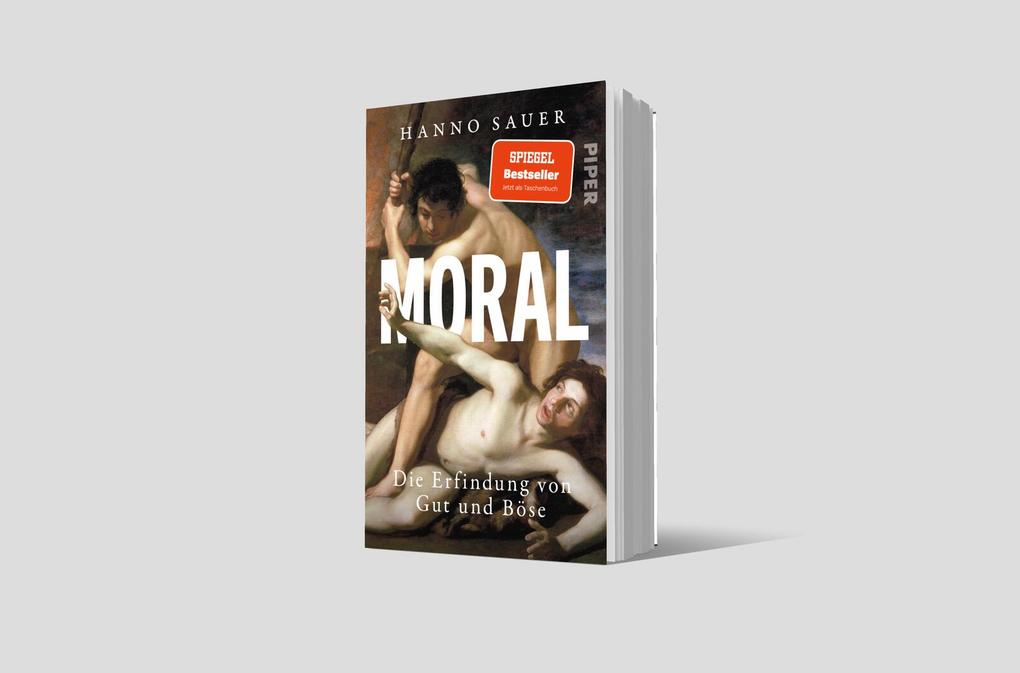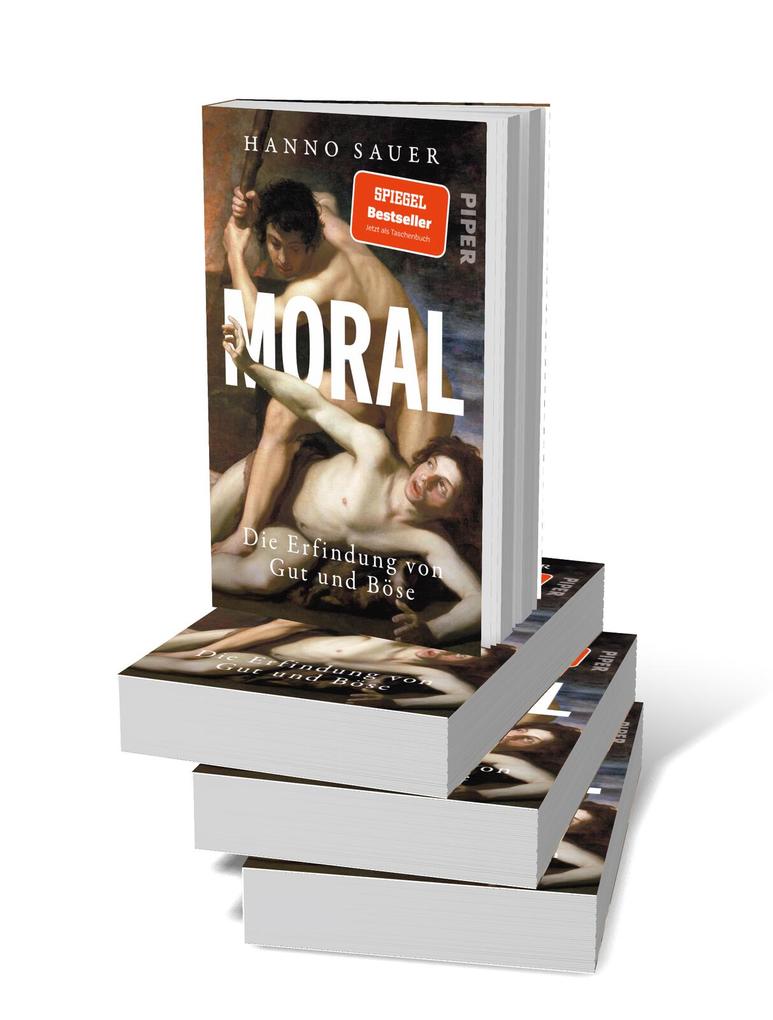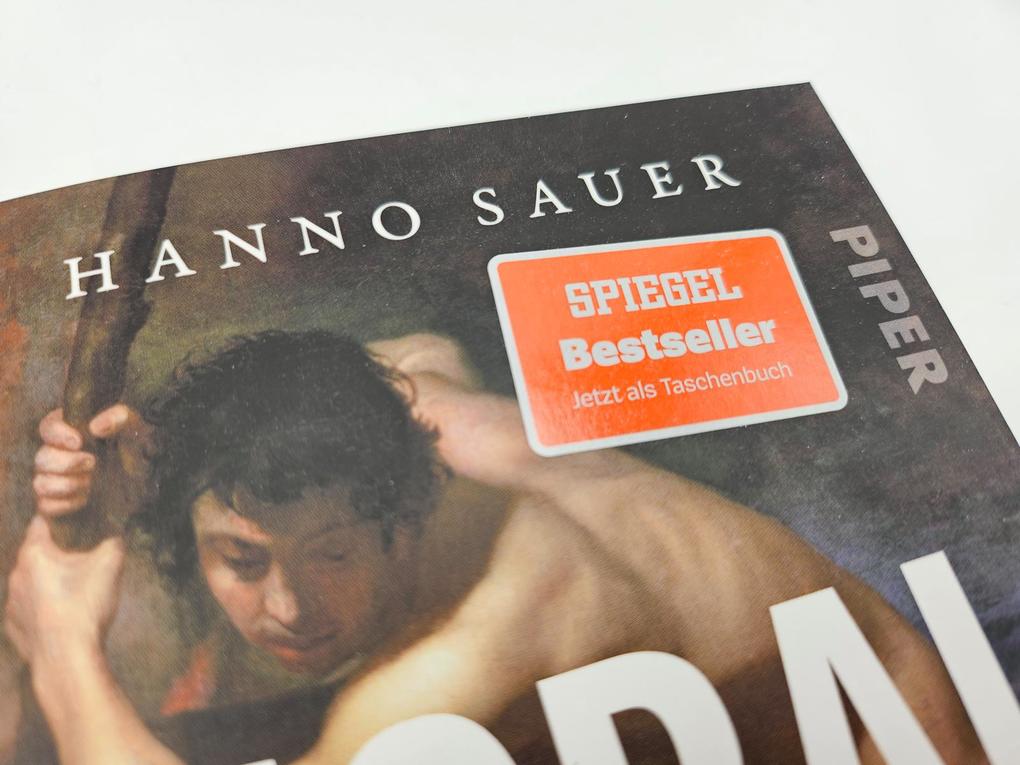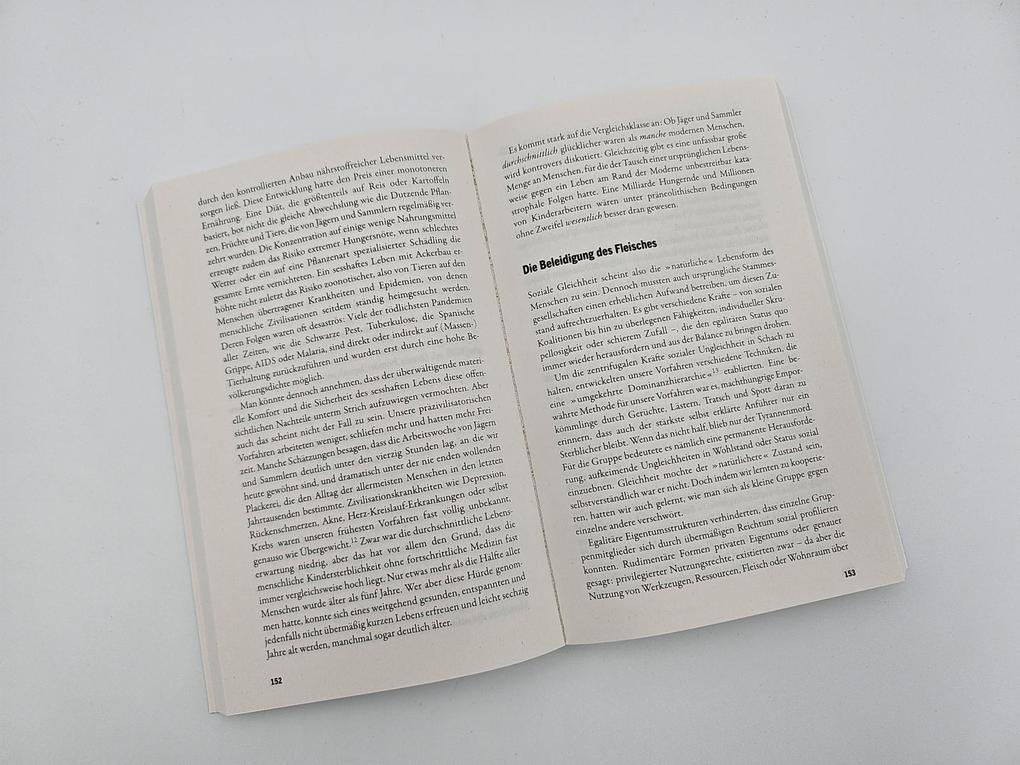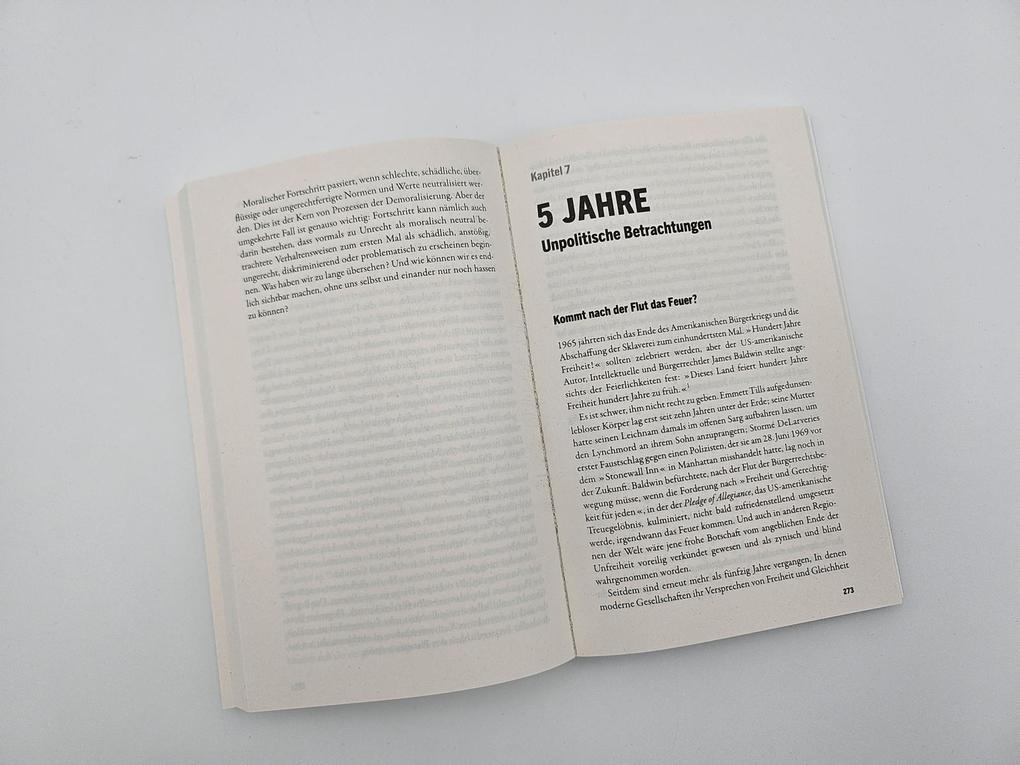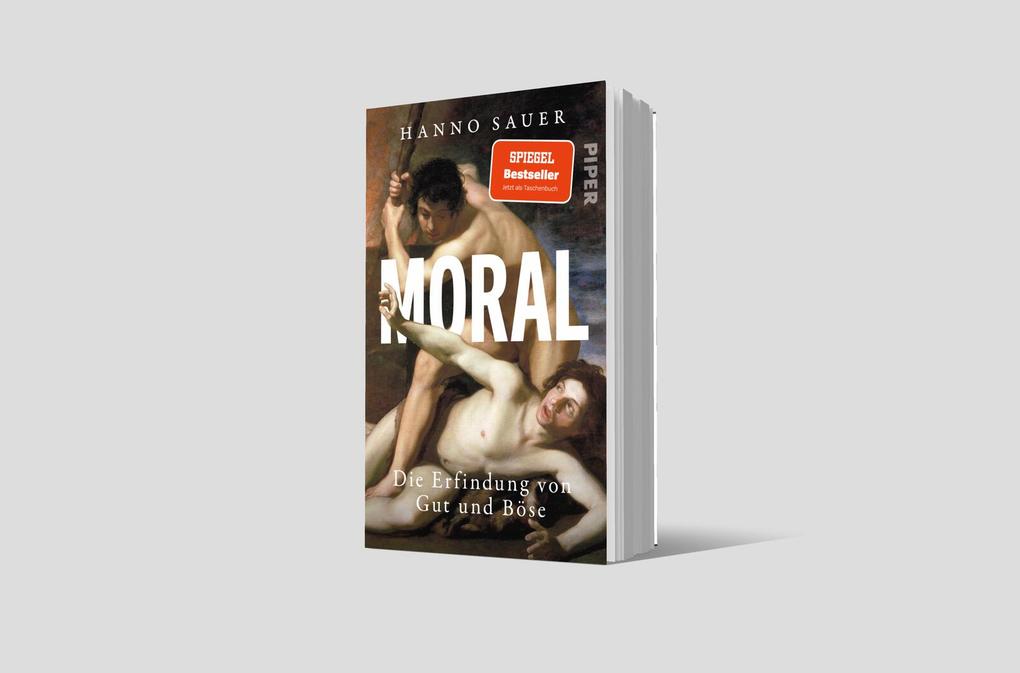Besprechung vom 06.09.2025
Besprechung vom 06.09.2025
"Moralische Überzeugungen sind zu einem Lebensstil geworden"
Leben wir noch immer in einer Klassengesellschaft? Der Philosoph Hanno Sauer geht in seinem neuen Buch den Wirkungen einer Kategorie nach, die viele längst entsorgt haben. Ein Gespräch über Status und Macht heute
Unter dem Titel "Moral" hat der Philosoph Hanno Sauer vor gut zwei Jahren die menschheitsgeschichtliche Genese unserer Werte und Normen nachgezeichnet. Der Band wurde für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert. "Klasse - Die Entstehung von Oben und Unten", so heißt Sauers neues, gerade erschienenes Buch (Piper Verlag, 367 S., geb., 26,- Euro). Die Leitfragen: Was genau ist Klasse? Wie funktionieren gegenwärtige Distinktionsdynamiken? Weshalb wird der Traum von der klassenlosen Gesellschaft auch in Zukunft nicht Wirklichkeit werden? Zum Interview sind wir in einem Café im statusbewussten Berliner Westen verabredet. Sauer, der in Utrecht lehrt und in Düsseldorf lebt, kommt gerade vom Zug.
Einen schicken Koffer haben Sie da, Herr Sauer. Und ist das schon eine Form des "demonstrativen Konsums", von dem in Ihrem Buch die Rede ist?
Natürlich sende ich mit einem Koffer, den sich nicht jeder leisten kann, ein Signal meinen Status und meinen Lebensstil betreffend. Man kann in dieser Hinsicht nicht nicht kommunizieren. Das ist nicht erst seit Bourdieus "Die feinen Unterschiede" bekannt. Entscheidende Vorarbeiten für die Theorie sozialer Signale hat der amerikanische Ökonom Thorstein Veblen bereits um 1900 geleistet. Von Veblen stammt auch der Begriff "demonstrativer Konsum", damit ist die innige Verbindung zwischen Klassenhierarchien und ästhetischen Signalen gemeint. Auch heute signalisiert man seinen sozialen Status noch mit einem Koffer, einer Hausbibliothek, einer Yacht oder einer exquisiten Armbanduhr, deren Wert nur Eingeweihte auf Anhieb erkennen. Eine meiner Hauptthesen ist, dass in der westlichen Wohlstandsgesellschaft Statuswettbewerbe zunehmend mit immateriellen Gütern ausgetragen werden.
Nämlich?
Dazu gehören nach wie vor Bildung, Denkvermögen und ein raffinierter Geschmack. Neben kulturellem Kapital geht es jedoch immer mehr um den demonstrativen Konsum moralischer Werte. Man konkurriert um immer feiner kalibrierte Sensibilitäten. Moralische Überzeugungen sind zu Distinktionsmarkern und zu einer Form des Lebensstils geworden.
Meinen Sie damit etwa, dass jemand, der sich heute gegen Rassismus oder Sexismus einsetzt, das hauptsächlich aus Prestigegewinn und Imagepflege tut?
Ich sage lediglich, dass das Streben nach moralischem Kapital auch bei dieser Art von Engagement eine entscheidende Rolle spielt. Aber damit leugne ich ganz und gar nicht, dass eine Person gleichzeitig von aufrichtigen antirassistischen oder antisexistischen Überzeugungen angetrieben werden kann. Gleiches gilt für unser Interesse an abstrakter Malerei oder an Zwölftonmusik. Es kann durchaus authentisch sein, aber trotzdem geht es dabei um Statusfragen. Das vermeintliche Apriori unserer Geschmacksurteile ist in Wirklichkeit das Aposteriori unserer Statuskämpfe.
Und was ist mit jemandem, der sich auf eine entlegene Hütte zurückzieht und sich dort Schönberg anhört? Glauben Sie ernsthaft, das geschieht mit der Nebenabsicht, irgendwelche Nachbarn zu beeindrucken, die es im Umkreis von 30 Kilometern gar nicht gibt?
Wahrscheinlich erzählt diese Person davon, sobald sie wieder unter Leuten ist. Vielleicht postet sie in den sozialen Medien, wie es ist, Schönberg fernab der Zivilisation zu hören.
Und wenn sie das eben nicht tut?
Das wäre sehr ungewöhnlich. Aber selbst dann würde sich der einsame Hüttenaufenthalt in die Logik sozialer Signale fügen: Menschen sind nämlich rekursive Mentalisierer. Deshalb ist es besonders wichtig, dass unsere sozialen Signale fälschungssicher sind, auch für uns selbst.
Könnten Sie das näher erläutern?
Wir sind wahnsinnig gut darin, mentale Zustände und Absichten anderer zu erkennen. Ist die Person wütend oder froh? Bin ich ihr egal, oder will sie mich beeindrucken? Wenn jemand als kundiger Musikliebhaber wahrgenommen werden will, muss er das zuallererst sich selbst glaubhaft machen. Deswegen hört sich eine Person auch mutterseelenallein Zwölftonmusik an. Nur ist unsere Psyche eben so gebaut, dass sie die strategische, auf Prestige zielende Logik unserer Interessen vor uns verbirgt: Wir glauben, wir hören Schönberg mit "interesselosem Wohlgefallen", und tun alles, um dieses Selbstbild zu untermauern, damit wir als Schönberg-Kenner authentisch rüberkommen. Wenn hingegen jemand seinen Musikgeschmack heuchelt und niemals im stillen Kämmerlein "Moses und Aron" hören würde, dann wittern in der Regel irgendwann auch andere, dass er vorgibt, etwas zu sein, was er nicht ist.
In Ihrem Buch betonen Sie Ihre Insiderkenntnisse der sogenannten besseren Gesellschaft und Ihre privilegierte Sprecherposition als Philosophieprofessor, der aus einer wohlhabenden bildungsbürgerlichen Familie stammt. Was bezwecken Sie damit?
Damit möchte ich auch ein bestimmtes Buchgenre parodieren, dazu zählen "Hillbilly-Elegy" von J. D. Vance oder "Troubled" von Rob Henderson. Beide Autoren folgen dem Muster: "Ich komme aus der Gosse, ich komme aus dem Dreck. Durch Schneid und Intelligenz habe ich mich hochgekämpft und die Eliten hautnah erlebt. Das sind alles privilegierte Idioten, Heuchler und pädophile Clowns. Ich kämpfe jetzt für euch gegen die." Auch wenn Vance mit dieser Erzählung buchstäblich Vizepräsident geworden ist, ist das reine Propaganda. Schon die Idee, dass man einen besonders klaren Blick auf Dinge hätte, nur weil man mit ihnen fremdelt, ist falsch. Aber die Leute in den USA glauben das und haben entsprechend gewählt. Was dann dabei herauskommt: Steuersenkungen für Reiche und schwachsinnige Zölle, die den Lkw-Fahrern schaden.
Sie zitieren eine Studie, die besagt: Menschen aus höheren Schichten neigen eher dazu, Klasse zu essentialisieren und die Statuszugehörigkeit einer Person für ein angeborenes, unveränderliches Merkmal zu halten. Sind Sie sicher, dass Sie selbst ganz frei von der Tendenz sind, Klasse in diesem Sinn zu essentialisieren?
Wo sehen Sie diese Tendenz bei mir?
Etwa wenn Sie nachdrücklich die Unzerstörbarkeit und Konstanz von Klasse betonen. Sie schreiben: "Status ist nicht nur erblich, sondern die Erblichkeitsrate von Klasse bleibt über Generationen hinweg, ja sogar über Jahrhunderte völlig unverändert." Daran, so heißt es weiter, könnten auch die "radikalsten politischen Interventionen" nichts ändern. Als Beispiel verweisen Sie auf die Florentiner Bernardi-Familie, die in der Renaissance zur absoluten Oberschicht gehörte und deren Abkömmlinge heute, nach 600 Jahren, noch immer auffallend wohlhabend und gut ausgebildet sind. Aber was ist mit der Sowjetunion, die in diesem Zusammenhang bei Ihnen unerwähnt bleibt? Da ist es doch offenkundig gelungen, die transgenerationale Weitergabe von Klasse zu unterbinden.
Klar, wenn man Aristokraten, Kulaken und andere "Klassenfeinde" umbringt und verhungern lässt, dann gibt es keine Nachkommen, an die man etwas weitergeben könnte. Aber das ist eine extreme Maßnahme und keine im Ansatz akzeptable politische Intervention. Mir ging es hier darum, zu zeigen, was für ein unglaublich stabiles Feature Klasse ist. Damit essentialisiere ich sie nicht. Ich sage ja eben nicht: Es gibt eine bestimmte Schicht von Menschen, die zum Herrschen geboren sind, weil sie blaues Blut haben. Aber jede Gesellschaft, jede Kultur bringt ihre eigenen Statushierarchien hervor. Das gilt auch für die Sowjetunion, in der lediglich das Personal der Elite ausgetauscht wurde. Wenn der Wettbewerb auf ökonomischer Ebene ausgeschaltet wurde oder nicht mehr so wichtig ist, geht er zwangsläufig auf der symbolisch-immateriellen Ebene weiter. Wer ist der Parteitreueste oder der größte Held der Arbeit? Wer hat auf X die meisten Follower und welcher Wissenschaftler die meisten Publikationen?
Der Gedanke, dass wir Hierarchien und Statuswettbewerbe auch künftig nicht loswerden, zieht sich durch das gesamte Buch. Aber ist das automatisch ein Grund, das Bestreben nach ökonomischer Gleichheit als illusorisch abzutun? Man könnte doch auch fordern: Stellt erst mal ökonomische Gleichheit her, so weit und so gewaltfrei wie möglich. Das ist immer noch besser als gar keine Gleichheit, dann sind zumindest wesentliche Startbedingungen für alle ähnlich. Wenn der Wettbewerb sich dann ins Postmaterielle verlagert, ist das verkraftbar.
Die Tatsache, dass wir die Statusungleichheiten nicht loswerden können, heißt nicht, dass wir andere Formen der Gleichheit immer ablehnen müssen. Aber man darf auch nicht überschätzen, wie wirksam das ist. Wenn man mich fragt: Können wir durch ökonomische Umverteilung eine Gesellschaft bauen, die sich für unsere egalitären Ideale befriedigend anfühlt? Dann ist die Antwort: Nein. Ich glaube, ökonomische Umverteilung kann trotzdem eine gute Idee sein, zum Beispiel von den Arbeitenden zu den Nichtarbeitenden, das nennen wir dann "Rente". Oder auch für die Bereitstellung öffentlicher Güter, von denen jeder profitiert. Aber man muss sich klarmachen, was Umverteilung auch macht, denn je mehr ökonomische Gleichheit es gibt, desto attraktiver werden eben andere Formen des Wettbewerbs, zum Beispiel um Macht oder Einfluss. Wir überschätzen die Macht der Redistribution deutlich.
Die Fragen stellte Marianna Lieder.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.