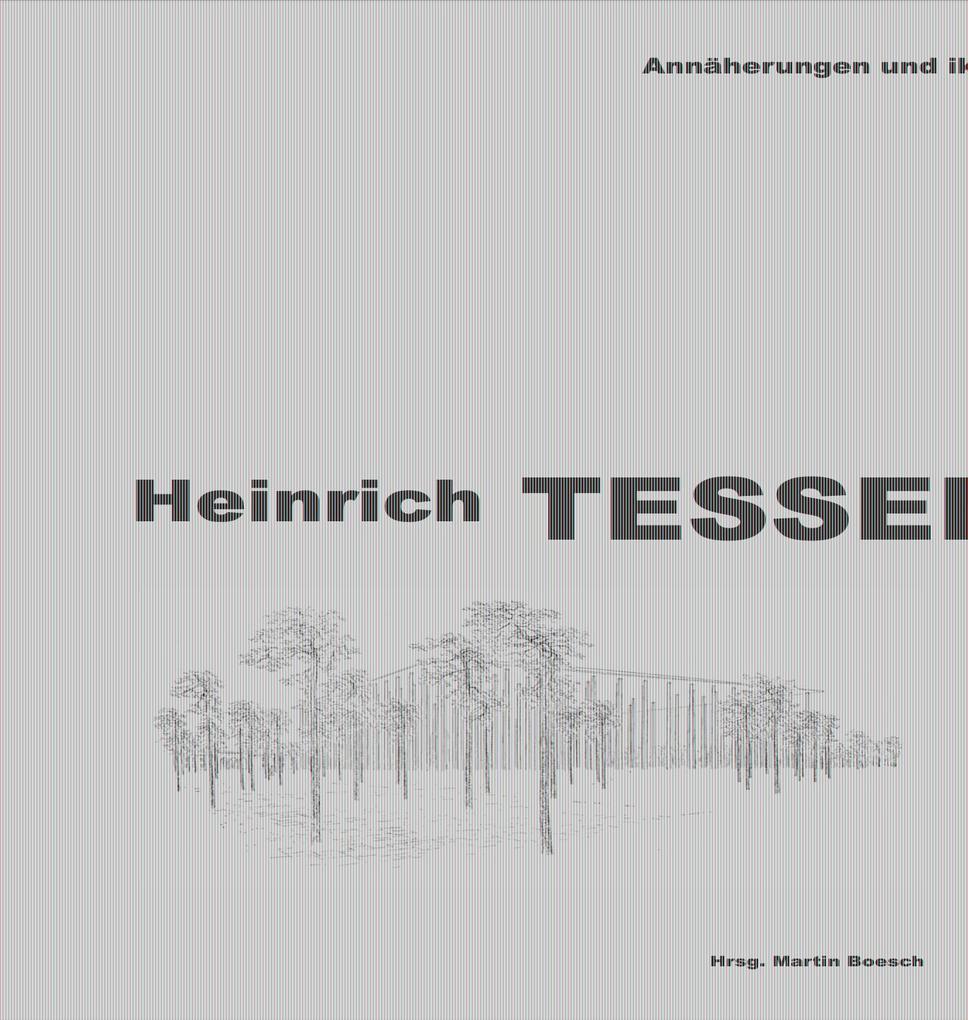
Zustellung: Sa, 09.08. - Do, 14.08.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Heinrich Tessenow (1876-1950) gilt als einer der bedeutendsten deutschen Architekten der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Nun feiert eine neue Monografie sein Gesamtwerk. Sie fragt, welche Bedeutung seine Bauten, Schriften und Zeichnungen heute haben. Der Zürcher Architekt, Architekturprofessor und Autor Martin Boesch zeichnet mit seiner akribischen Recherche zum geschriebenen und gebauten Werk ein neues Bild von Tessenow, den man zuerst gerne mit kleinen Wohnhäusern für Arbeiter, Handwerker und Kleinbürger in Verbindung bringt. Boesch zeigt in seiner Publikation, dass Tessenow den grossen Massstab so souverän beherrschte wie den kleinen und dass er sehr wohl fähig war, für die Grossstadt zu planen. Das Buch würdigt insbesondere Tessenows ikonische Gebäude - etwa das Haus Böhler bei St. Moritz, die Mädchenschule in Kassel, die Landesschule in Klotzsche bei Dresden, den Umbau der Neuen Wache in Berlin und die Säulenhalle am Strand von Prora. Für die Monografie und die von ihm kuratierte Ausstellung an der Accademia di architettura in Mendrisio hat Martin Boesch neben der Recherche in den verbliebenen Archiven (Tessenows Archiv verbrannte im Zweiten Weltkrieg) auch Feldforschung betrieben und sogar archäologische Methoden angewandt. Er ordnet seine Funde entlang der drei Themenkreise 'Bauen in der Landschaft', 'Projekte für die Stadt', 'Das grosse Haus und das kleine Haus', kommentiert von 33 Autoren, verteilt in Europa, von Kent über Bari bis Prag.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. Juli 2023
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
532
Herausgegeben von
Martin Boesch
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Historische und aktuelle Fotos, Abbildungen und Pläne
Gewicht
2486 g
Größe (L/B/H)
302/291/36 mm
Sonstiges
Großformatiges Paperback. Klappenbroschur
ISBN
9783909928828
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 12.03.2024
Besprechung vom 12.03.2024
Nicht nur im kleinen Maßstab
An ihm scheiden sich die Geister: Ein stattlicher und exzellent bebilderter Band setzt sich mit dem Architekten Heinrich Tessenow auseinander.
Bis in die Achtzigerjahre des vorigen Jahrhunderts hinein war die Geschichtsschreibung der Architektur der Moderne recht einseitig. Vom Bauhaus über die Emigration führte der Siegeszug der Moderne scheinbar ohne Umwege zum weltweit erfolgreichen International Style. Fast ausschließlich politisch links orientierte Architekten, wie etwa Walter Gropius oder Bruno Taut, galten als Helden diese Entwicklung. Dass es auch eine reiche konservative Gegenströmung gab, die Interesse verdient und das Bild entscheidend erweitert, wurde erst in postmodernen Zeiten näher erforscht. Es waren italienische Architekten des Razionalismo wie Giorgio Grassi, die sich für Architekten wie Heinrich Tessenow interessierten, ihn entdecken und kanonisieren wollten.
Tessenow (1876-1950) gilt als einer der bedeutendsten Architekten der "anderen Moderne", und bis heute scheiden sich an ihm die Geister: Während manche Kenner in ihm einen wenig talentierten, ewig gestrigen Moderne-Verweigerer und provinziellen Kleinbürger sehen, gilt er anderen Zirkeln als zu Unrecht übersehener Meister-Architekt, dem nur eine ideologiegetriebene Architekturgeschichtsschreibung seinen verdienten Platz in der Ruhmeshalle verweigert, obwohl sein Gespür für feine Proportionen und Details besonders ausgeprägt war.
In seinem neuen, stattlichen Buch wirft der Zürcher Architekt Martin Boesch ein neues Licht auf den Architekten. Besonders die opulente Ausstattung mit mehr als tausend Bildern macht das Buch zu einer ergiebigen Quelle, und die grafische Gestaltung ist ein Genuss. Der Chor von über dreißig Autoren, den Boesch in seinem Buch versammelt, macht die Sicht auf Tessenow vielstimmig. Laut Klappentext "feiert" seine Monographie Tessenows Gesamtwerk. Das macht misstrauisch. Zum Glück fragt es aber auch, "welche Bedeutung seine Bauten, Schriften und Zeichnungen heute haben".
Boesch will zudem zeigen, dass Tessenow zu Unrecht als "Architekt des kleinen Maßstabs" gilt. Denn neben bekannten Werken wie dem Haus Böhler in Oberalpina bei St. Moritz (1989 abgerissen) oder dem Umbau von Schinkels Neuer Wache in Berlin stellt der Autor vor allem Tessenows größere, urbane Projekte in den Mittelpunkt seiner Betrachtung, etwa die Mädchenschule in Kassel oder die Säulenhalle des Kraft-durch-Freude-Bades in Prora. Das Festspielhaus in der Gartenstadt Hellerau von 1912, Tessenows wohl bekanntestes Werk, markiert die Wende vom "Vereinfachten Jugendstil" zum Neoklassizismus in Tessenows Werk. Nach Stationen in Trier und Wien unterrichtete Tessenow 1926 bis 1941 an der Technischen Hochschule Berlin. Albert Speer war sein Assistent. 1944 wurde er in der Gottbegnadeten-Liste von Jospeh Goebbels aufgenommen.
Tessenows Archiv verbrannte im Zweiten Weltkrieg, und Boesch rekonstruiert die fehlenden Unterlagen minutiös. Die Einfachheit, Sachlichkeit und Schlichtheit der frühen Werke von Tessenow, die man der Reformarchitektur zurechnet, bestechen bis heute durch Bodenständigkeit und Liebe zum Detail, die vom Siedlungsbau bis zur Möblierung und Innenarchitektur reicht.
Tessenows Maxime "Das Einfache ist nicht immer das Beste; aber das Beste ist immer einfach" kann man kaum widersprechen. Bruno Taut bezeichnete Tessenow als "Vorreiter der Wohnhausbaureform", und Tessenows Einfluss ist in den Siedlungen der Moderne, die heute zum UNESCO-Weltkulturerbe zählen, zu erkennen. Sein Stadtbad in der Berliner Gartenstraße gehört zu den faszinierendsten öffentlichen Bauten in Berlin-Mitte.
Das ändert nichts daran, dass Tessenow schon vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 mit Werken wie der Wohnsiedlung Am Fischtal in Berlin-Zehlendorf auch als Wegbereiter der nationalsozialistischen Architekturauffassung agierte. Wie sein Zeitgenosse Paul Schultze-Naumburg war Tessenow den Nationalsozialisten jedoch im Zweifelsfall zu bürgerlich-konservativ. Besonders lesenswert ist der Beitrag von Hartmut Frank über Tessenow und Speer, in dem der Autor die Balance zwischen Strenge und Poesie in Tessenows Werk ebenso thematisiert wie sein Verhältnis zu Macht und Politik.
Tessenows eigenes Haus in Neubrandenburg zeigt am deutlichsten seine Vorstellungen eines Wohnhauses als Baustein einer Gartenstadt, mit Nutzgarten und Pergolen, die in die Landschaft ausgreifen. Es ist der Urtyp eines Hauses mit Satteldach, allein die glatten Oberflächen und geometrischen Formen unterscheiden es von Kinderzeichnungen eines Klischee-Hauses mit rauchendem Schornstein und Gardinen hinter Sprossen-Fenstern. In den Dreißigerjahren entwarf Tessenow Kasernen, Offizierssiedlungen und Ehrenmale, nach dem Krieg eine Wiederaufbauplanung für seine Heimat in Mecklenburg. Er bleibt eine zwiespältige und gerade deshalb interessante Figur der Architekturgeschichte in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. ULF MEYER
Martin Boesch (Hrsg.): "Heinrich Tessenow". Annäherungen und ikonische Projekte.
Hochparterre Verlag,
Zürich 2023. 532 S., Abb., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Heinrich Tessenow" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









