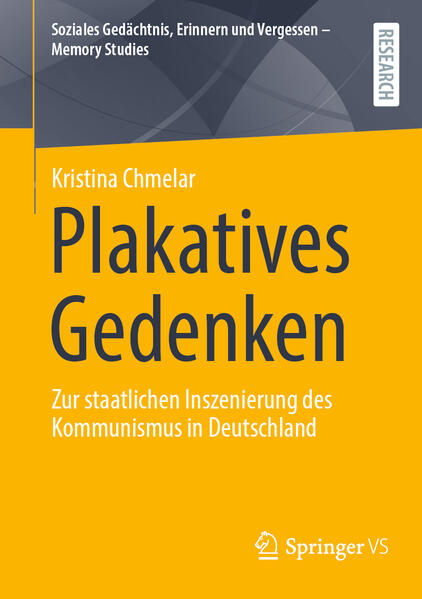
Zustellung: Di, 24.06. - Do, 26.06.
Noch nicht erschienen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Im Fokus der Arbeit steht eine von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur federführend organisierte Jubiläumsausstellung. An dieser besonderen und gleichermaßen signifikanten Form staatlicher Geschichtspolitik interessiert vor allem das Wie der Darstellung des Kommunismus, wobei verschiedene sozialwissenschaftliche Abstraktionsebenen eingepreist werden. Zunächst entwickelt die Autorin eine kulturwissenschaftlich informierte und gleichsam für Politik sensible postkonstruktivistische Gedenkanalytik. Auf die zentrale Begrifflichkeit der Inszenierung zulaufend grundiert diese Analytik eine systematische Beschäftigung mit dem Zurschaustellungsprozess sowie mit der fertigen Schau. Bei der doppelten Dekonstruktion wird die Ausstellung in ihrer Multimedialität und -modalität ernstgenommen. Auch verschiedene Kontexte und Ambivalenzen finden Berücksichtigung. Am Ende kann die Fallstudie zeigen, dass die von der Bundesstiftung verfolgte, plakative geschichtspolitische Strategie in verschiedener Hinsicht problematisch ist. Den staatlich formulierten Anspruch, die innere Einheit des vereinigten Deutschlands mittels der Aufarbeitung des Kommunismus zu fördern und zu festigen, muss sie regelmäßig verfehlen.
Inhaltsverzeichnis
Wenn Kommunismus zur Schau gestellt wird was tun? . - Grundlegung einer Gedenkanalytik. - Gedenkausstellung als Inszenierung. - Die Dinge bewegen. Zur Dekonstruktion einer multimedialen und multimodalen
Inszenierung. - Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme. - Plakatives Gedenken an den Kommunismus. - Nachwort. - Erhobene Daten. - Literaturverzeichnis.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
24. Juni 2025
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
389
Reihe
Soziales Gedächtnis, Erinnern und Vergessen Memory Studies
Autor/Autorin
Kristina Chmelar
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Abbildungen
XII, 389 S. 9 Abbildungen, 6 Abbildungen in Farbe.
ISBN
9783658483968
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Plakatives Gedenken" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









