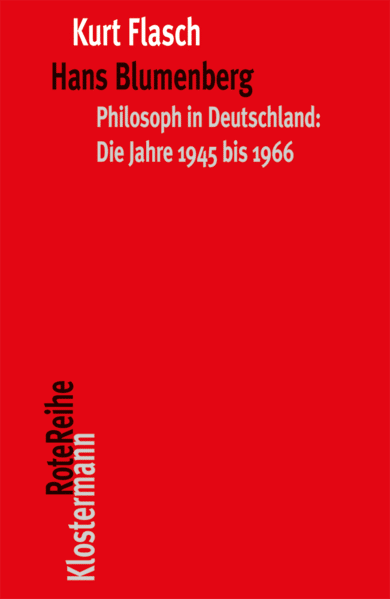
"Flasch zeigt einen unbekannten und anderen Blumenberg, einen nationalsozialistisch verfolgten und jesuitisch geschulten Katholiken und existentialistischen Christen [. . . .] Seine Erinnerung an den Scholastiker ist ein Antidot gegen einen naiven Klassikerkult, der Blumenberg in seiner Kernkompetenz nicht fachlich zu beurteilen vermag. Sie ist ein Musterbeispiel für wissenschaftsgeschichtliche Historisierung." Zeitschrift für Germanistik
"Ein ausgezeichnetes Buch . . . Lehrreich und oft vergnüglich zu lesen . . . [Flasch hat sich] auf die ersten zwanzig Jahre des Wirkens von Blumenberg beschränkt. Über diese Jahre wussten auch begeisterte Blumenberg-Leser bisher am wenigsten. Deshalb ist Flaschs Buch gerade für sie wertvoll. Aber in weiten Teilen faszinierend zu lesen ist es für jedermann."Jürgen Busche, in: Süddeutsche Zeitung, 27. 10. 2017
"Habitus temperamentvoller Klarheit . . . Hans Blumenberg ist für den Mediävisten und Philosophiehistoriker Kurt Flasch noch heute ein Zeitgenosse. [In diesem Buch] balgt er sich mit ihm, gelehrt und akribisch, dass es eine Lust ist." Manfred Sommer, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7. 10. 2017
"Ebenso gelehrtes wie lehrreiches Buch [. . . .] Flasch füllt eine Forschungslücke, wobei er im Grunde fast so etwas wie ein Handbuch zum frühen Blumenberg vorlegt." Informationsmittel für Bibliotheken
"So muss man es als Glücksfall bezeichnen, dass Kurt Flasch [. . .], nur ein Jahrzehnt jünger als Blumenberg und von 1970 bis 1995 Lehrstuhlinhaber in Bochum, wo beide sich noch begegneten, der "philosophischen Genesis" Blumenbergs ein ganzes Buch widmet." Zeitschrift für Kulturphilosophie
The interest taken in the philosophy of Hans Blumenberg (1920-1996) is growing both in Germany and abroad. Yet it almost always focuses on the later Blumenberg. The reasons for the neglect of his early writings are easy to point out: they seek their way between Husserl and Heidegger in interpretations of texts of medieval philosophy, and the greater part of them remains unpublished to this day. This monograph by Kurt Flasch, one of Germany s most renowned experts on medieval philosophy and the history of philosophy, is based on archival studies and draws on lifelong source work on medieval philosophy and the early modern period. It reconstructs the philosophical development of Blumenberg from his earliest texts up to the discussion centered upon the Legitimität der Neuzeit (1966). It philosophically and philologically discusses their lines of argumentation and juxtaposes them with the contemporaneous historical development of the German Federal Republic. It does not eschew criticism, but at the same time does not deny the author s personal empathy for his subject. Despite the scholarliness of the presentation, the extensive study is an eminently good read just as one has come to rightfully expect from this author.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.04.2025
Besprechung vom 23.04.2025
Mit roter Geheimtinte
Leben oder Papier? Kurt Flasch wird berichtigt
Das muss gekonnt sein: Anhand jüngster Bücher eines Autors sich als Rezensent auf die "zahlreichen inhaltlichen Gewinne, die in ihnen erwirtschaftet werden", zu berufen, um dann die Kritik umso schärfer und schneidender ausfallen zu lassen - indem man die Schwächen gleichsam als Komplementärphänomen der Stärken darstellt, als schwache Bedingungen ihrer starken Möglichkeiten. Überaus vorsichtig stellt der junge Friedrichshafener Philosoph Gill Zimmermann die Philosophiehistorie von Kurt Flasch, dessen Domäne der Spätantike und des Mittelalters, unter die seinem, Zimmermanns Aufsatz titelgebende Alternative "Leben oder Papier" (in: Philosophische Rundschau, 71. Jg., Heft 3, Verlag Mohr Siebeck, 2024). Die These ist klar geschnitten: Flasch hat einen papierenen Philosophiebegriff, dem jedes Berührtwerden vom Leben abgeht, und sei es auf dem Papier. Der Vorwurf lautet, "dass Flasch sich zwar überall der Korrektheit und Kohärenz geschichtlicher Fakten zuwendet, sich aber nirgendwo für Wahrheitsansprüche, geschweige denn für deren Einlösbarkeit oder für eine mögliche Betroffenheit interessiert, die uns von ihnen ausgehend noch heute berühren könnte". Demnach setzt Flasch die von ihm untersuchten Texte einem gelehrten Neutralisierungsprogramm aus, welches "das Überzeitliche am Denken sowie andererseits das Leben, dem es entspringt", sprachlos werden lässt.
Zimmermann macht diese Taubheit Flaschs gegenüber einem "Denken des Uneinholbaren" hier namentlich anhand des Blumenberg-Buchs von 2017 fest, in welchem Flasch unter dem Titel "Hans Blumenberg. Philosoph in Deutschland: Die Jahre 1945 bis 1966" im Grunde seinen Gegenstand verfehle. Darin würden historische Monita ausgesprochen, Blumenbergs Neigung für Latentes sowie seine Nichtbeachtung der Wissenssoziologie beanstandet, wodurch Flaschs Bewertungen nicht etwa falsch, aber oft disproportional erschienen. In Zimmermanns Worten: Der Rigorismus, mit dem Flasch seinen eigenen Begriff von entpsychologisierter, einem stets einholbaren Quellennachweis verpflichteter Philosophiegeschichte über weite Strecken des Blumenberg-Buchs verfolge, ohne Blumenberg "von seiner eigenen Denksituation aus zu verstehen zu versuchen, entkräften in meinen Augen nicht die Stichhaltigkeit seiner Monita, nehmen ihnen aber das Gewicht und lassen den Raum, den Flasch ihnen gibt, unverhältnismäßig wirken".
Fast abrupt formuliert Zimmermann dann ein Resümee, aber es ist gehauen und gestochen: "Flaschs Buch über den jungen Blumenberg glänzt durch die genaue Kenntnis der frühen Schriften, erstickt manchmal fast an großräumigen und kleinteiligen historisch-mediävistischen Korrekturbemühungen, lässt sich zu selten auf das Denken von Geschichtlichkeit ein, das in ihnen zur Sprache kommt und verpasst die Chance, Leben und Denken seines zugegebenermaßen um sein biografisches Inkognito bemühten Autors über bloß äußerliche Zuordnungen hinaus in Beziehung zueinander zu setzen." So blockiere Flaschs Historismus sowohl den Weg in die Systematik als auch den einer biographischen Lektüre.
Nun hat die von Zimmermann kritisierte Aussparung von Latenzen zugunsten einer Beschreibung, die mit der Vorlage meint fertig zu werden, immer auch etwas Kurioses. Denn der sprachliche Ausgriff auf Gedachtes bleibt stets unabgeschlossen, ist eine handhabbare Abkürzung dessen, was bezeichnet werden soll. Nur wer solche epistemische Beschränkung ausblendet, hält die rote Tinte von Korrekturanstrichen für die Geheimtinte des Erkenntnisfortschritts. So aber desavouiert Flaschs ursprüngliche Einsicht, Philosophiegeschichte lasse sich nur philosophisch betreiben, sich selbst. Hier setzt Zimmermanns Rede von Leben und Papier an, zwei Materialdepots, wie sie Flasch der Sache nach zu Unrecht wiederholt in Gegensatz bringe: Wenn die Philosophiehistorie über die Verabredung mit Papier und Dokumenten aufhöre, nach dem Leben zu fragen, sich dieses Fragen sogar systematisch untersage, habe sie nichts gewonnen. Immer wieder, so Zimmermann, betone Flasch seine absichtliche Aussparung von Biographischem und Psychologischem. Die Gefahren des Unmittelbarkeitsfetischismus leuchte er bevorzugt aus. Ob er dabei aber hinreichend bedenke, dass Erfahrungen - und eben auch die vom Papier abgelesenen - stets den Schein von Unmittelbarkeit an sich hätten, ohne dass sie deshalb ausgespart gehörten?
Noch einmal Blumenberg zur Illustration: Seine Philosophie befasst sich in Zimmermanns Worten "bevorzugt mit Dingen, mit denen nicht fertig zu werden ist und deren unscheinbare Aufdringlichkeit andererseits auf ein Werden verweist, dessen letzte oder erste Quellen unergründlich bleiben müssen". Wie lässt sich dieser Denktypus auf die Verlegenheiten derer beziehen, die sich in ihm wiederfinden? Na ja, mit Mut zu einer Latenz, aus der sich vielleicht nichts machen lässt - außer ein Gefühl für die Proportionen dessen herzustellen, was bei Flasch fehlt. CHRISTIAN GEYER
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Hans Blumenberg" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.












