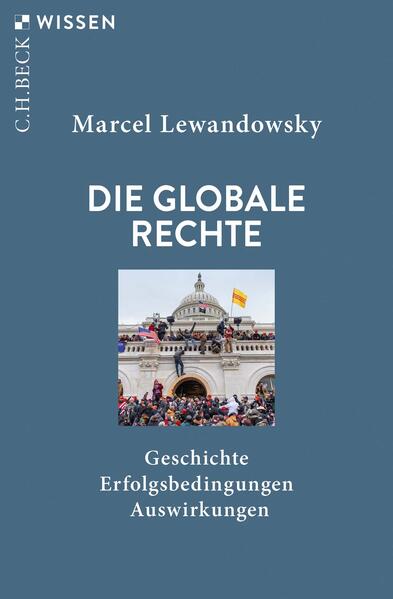Besprechung vom 29.07.2025
Besprechung vom 29.07.2025
Nationalistisch, aber international vernetzt
Marcel Lewandowsky zeigt die staatenübergreifenden Verflechtungen der neuen Rechten
Ob Donald Trump, Viktor Orbán, Javier Milei, Martin Sellner oder Jair Bolsonaro - sie stehen exemplarisch für einen Rechtsruck, der viele Demokratien weltweit prägt. Doch sind diese Entwicklungen nur nationale Einzelphänomene? Der Politikwissenschaftler Marcel Lewandowsky argumentiert in seiner neuen Monographie, dass sie vielmehr ein ideologisch verwandtes Netzwerk bilden - eine "nationalistische Internationale" -, deren gemeinsame Basis ein kämpferischer, ethnisch oder kulturell verstandener Nationalismus, die Ablehnung demokratischer Prinzipien und des gesellschaftlichen Pluralismus sowie Vorstellungen von natürlicher Ungleichheit zwischen Menschen auf Basis ihrer ethnischen oder kulturellen Gruppenzugehörigkeit sind.
Mit seiner Monographie "Die globale Rechte" legt Lewandowsky eine kompakte, gut 140 Seiten umfassende Analyse vor. Er untersucht darin die ideologischen Grundlagen, die historische Entwicklung und die transnationalen Verflechtungen der neuen Rechten - ebenso wie deren Auswirkungen auf demokratische Ordnungen.
Lewandowsky beginnt mit einer präzisen Begriffsarbeit: Was heißt es, politisch "rechts" zu sein? Er trennt etwa Nationalismus klar vom Konservatismus. Besonders hilfreich ist die Übersichtstabelle, in der Lewandowsky zentrale Merkmale und konkrete Beispiele systematisch gegenüberstellt. So wird beispielsweise auf einen Blick deutlich, dass sich der Rechtspopulismus - anders als der Rechtsextremismus - explizit von politischer Gewalt distanziert. Immer wieder greift der Autor auf solche grafischen Darstellungen zurück, wodurch komplexe Begriffe, historische Entwicklungen und ideologische Unterschiede übersichtlich strukturiert werden.
Den ideologischen Ursprung der globalen Rechten verortet Lewandowsky in den Umbrüchen nach dem Ersten Weltkrieg: Der Zusammenbruch der Monarchien, das Scheitern junger Demokratien und weitreichende gesellschaftliche Krisen schufen einen Resonanzraum für autoritäre Bewegungen. Nach 1945 schien der Faschismus besiegt, doch die Rechte verschwand nicht - sie formierte sich neu. In Parteien wie dem Movimento Sociale Italiano oder der FPÖ erkennt Lewandowsky eine direkte Traditionslinie zur Zwischenkriegszeit. Er zeigt, dass diese Akteure schon früh internationale Vernetzung suchten - ein Beispiel dafür ist die 1951 gegründete Europäische Soziale Bewegung. Die "Neue Rechte" nimmt Lewandowsky besonders in den Blick: eine Strömung, die sich seit den 1970er Jahren herausbildet und nicht mehr offen faschistisch auftritt, sondern diskursiv, intellektuell und zunehmend digital agiert.
Stärken zeigt Lewandowskys Buch vor allem in der vergleichenden Perspektive auf die weltweite Verbreitung rechter Bewegungen. In knappen, aber instruktiven Porträts einzelner Länder und Regionen skizziert er, wie sich rechte Akteure in Europa, den USA, Russland, Lateinamerika, Asien und Afrika positionieren. Zwar variiert die analytische Tiefe, doch Lewandowsky gelingt es, die länderübergreifenden Ungleichheitsideologien prägnant darzustellen.
Eine einfache Erklärung für die Erfolgsbedingungen rechter Parteien gibt es laut Lewandowsky nicht. Stattdessen verweist er auf ein Bündel begünstigender Faktoren für die Unterstützung rechter Parteien - von ökonomischer Ungleichheit und Migration bis hin zu psychologischen Dispositionen.
Das Buch belässt es nicht bei der Diagnose. Es fragt auch nach den Auswirkungen rechter Politik auf Justiz, Medien und Gesellschaft - sei es in der Regierung oder in der Opposition. Wo rechte Parteien regieren, zeigt sich laut Lewandowsky eine deutliche Veränderung der Funktionsweise und der Machtbalance der Verfassungsorgane, "dass sich mittel- bis langfristig der Charakter der Demokratie selbst wandelt". Aber auch in der Opposition können rechte Parteien auf den politischen Diskurs einwirken, indem sie Themen setzen, die dann von ihren Konkurrenten aufgegriffen werden - allen voran in der Migrations-, Asyl- und Gesellschaftspolitik. Lewandowsky spart auch die Frage nach Gegenstrategien nicht aus. Er beschreibt die Dilemmata, vor denen Mainstream-Parteien stehen: Ausgrenzung kann das Außenseiter-Narrativ der Rechten befeuern, Einbindung zur Normalisierung beitragen.
Am Ende wird deutlich: Die globale Rechte ist längst keine Randerscheinung mehr. Achtzig Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben rechte Parteien die gesellschaftlichen Debatten und demokratischen Institutionen vieler Staaten maßgeblich verschoben. Wer die Grundlagen und Konsequenzen dieses Wandels verstehen möchte, findet in Lewandowskys Buch eine gleichermaßen fundierte wie nüchterne Analyse - präzise, zugänglich und ohne jeden Alarmismus. Der Autor strukturiert komplexe Zusammenhänge übersichtlich und bietet damit eine wertvolle Grundlage, um rechte Bewegungen - national wie international - einzuordnen. LAURA GABLER
Marcel Lewandowsky: Die globale Rechte. Geschichte, Erfolgsbedingungen, Auswirkungen.
C.H. Beck Verlag,
München 2025.
143 S., 12, - Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.