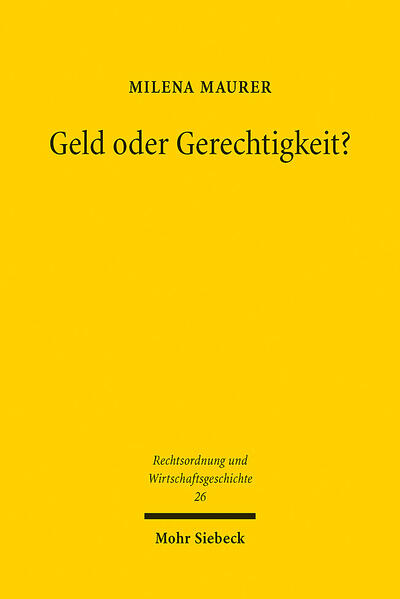
Zustellung: Di, 22.07. - Do, 24.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Ökonomische Analyse des Rechts entwickelte sich in den 1960er Jahren in den USA und hat sich inzwischen einen Platz in der deutschen juristischen Methodenlehre gesichert. Eng mit ihr verwandt ist die wirtschaftswissenschaftliche Strömung der Neuen Institutionenökonomik. Während die Ökonomische Analyse einzelne juristische Probleme untersucht, widmet sich die Neue Institutionenökonomik den Einflüssen ganzer politischer und gesellschaftlicher Systeme auf die Durchsetzung rechtlicher Regeln. Damit ist sie grundsätzlich geeignet, interessante neue Erkenntnisse auch für die Rechtswissenschaft zu liefern. Inwiefern rezipieren Juristen die verschiedenen rechtsökonomischen Ansätze seit ihrem Aufkommen? Welche verfassungsrechtlichen Aspekte sprechen gegen eine Rezeption? Und in welchen Bereichen ist ein Erkenntnisgewinn besonders vielversprechend?
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. Januar 2025
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
341
Reihe
Rechtsordnung und Wirtschaftsgeschichte
Autor/Autorin
Milena Maurer
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
542 g
Größe (L/B/H)
229/154/18 mm
ISBN
9783161638350
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 23.06.2025
Besprechung vom 23.06.2025
Jurisprudenz und Ökonomik
Fünf Bücher zum ungeklärten Beziehungsstatus
Am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn geht ein Sammelband zur Verhaltensökonomie auf die Initiative von Laurence O'Hara zurück. "Öffentliches Recht als Verhaltensordnung" verarbeitet die neuesten Befunde und kommt dabei ohne mathematische Formeln aus. Natürlich folgt daraus kein Gesamtkonzept wie bei Annahme eines "homo oeconomicus", der stets rational entscheidet. O'Hara betont zu Recht: "Wenn man an empirisch fundierter Verwaltungsrechtswissenschaft interessiert ist, sind die verschiedenen diskutierten Begriffe (homo oeconomicus, sociologicus, etc.) kein Angebot, aus dem man beliebig wählen oder nicht wählen kann: Der Mensch hat all diese Facetten. Die verhaltenswissenschaftliche Analyse dient dazu, soweit möglich fundierte Prämissen als Grundlage der Steuerung zu entwickeln."
Auch Milena Maurer übt sich in ihrem Werk "Geld oder Gerechtigkeit?" in Zurückhaltung. Das Homo-oeconomicus-Modell sei stark vereinfacht und entspreche nicht dem Menschenbild des deutschen Rechts. Bei Property Rights oder Prinzipal-Agent handele es sich um Theorien, "die nicht den Anspruch erheben, dass ihre Ergebnisse im Einzelfall juristisch korrekt und vollständig sind". Bei rechtsökonomischen Autoren bleibe die Gerechtigkeit unerwähnt. Die so Angesprochenen haben freilich durch verschiedene Strategien versucht, Gerechtigkeitsvorstellungen in ihre Modelle zu integrieren, etwa Gerechtigkeitspräferenzen in der Nutzenfunktion eines Akteurs zu berücksichtigen.
Wie sieht es auf europäischer Ebene aus? Dazu hat sich der ehemals in Paris lehrende Armin Steinbach in "EU Law and Economics" kluge Gedanken gemacht. Den Mehrwert einer ökonomischen Betrachtung veranschaulicht er etwa am Subsidiaritätsprinzip. Von Juristen mit einem Effektivitätsbegriff unpräzise ausgestaltet, könne er ökonomisch betrachtet viel genauere Kriterien entwickeln. Größenvorteile, Externalitäten und heterogene Präferenzen, die letztlich in eine Kosten-Nutzen-Analyse münden, würden dann entscheiden, ob etwas auf nationaler oder europäischer Ebene gemacht werden soll. Steinbach versteht die Mitgliedstaaten grundsätzlich als "state oeconomicii" mit eigenen Zielen, Zwecken, Nutzenerwartungen, aber auch Anreizen und Machtdynamiken, ebenso wie die EU-Institutionen. All das präge die Art der Kooperation und sei für das Ergebnis der Rechtssetzung entscheidend. Steinbachs fundierte Analysen werden dem Bundesfinanzministerium noch sehr helfen.
Philippe-Emmanuel Partsch erinnert in "The 5 labours of Europe" (Die fünf Aufgaben Europas) an den großen Erfolg durch wirtschaftliche Kooperation und Binnenmarkt. Europa habe eine unglaubliche Kraft und hohe Lebensqualität: Damit das so bleibt, präsentiert Partsch ein kluges Pflichtenheft mit 34 Vorschlägen für die Zeit bis 2030.
Dass sich Differenzen zwischen Recht und Ökonomik auf einer fundamentaleren Ebene auftun können, untersucht der von der Philosophin Weyma Lübbe und dem Bonner Rechtswissenschaftler Thomas Grosse-Wilde herausgegebene Band "Abwägung. Voraussetzungen und Grenzen einer Metapher für rationales Entscheiden". Juristen benutzten fortwährend die "Abwägungsmetapher", die schon durch Justitias Waage versinnbildlicht wird; Ökonomen versuchten dagegen, Entscheidungssituationen mithilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse von "Outcomes" zu modellieren. Wie weit trägt diese vordergründige Parallele? Ein Beispiel ist eine an John Taurek (mit seinem berühmten Aufsatz "Should the numbers count?") angelehnte, dilemmatische Entscheidungssituation: Patient C benötigt die volle Dosis eines knappen Medikaments, um zu überleben, zwei weitere Patienten, A und B, könnten mit jeweils einer halben Dosis vor dem Tode bewahrt werden. Die Rechtsordnung fordert nicht das Überleben der größeren Zahl, sondern stellt die Allokation dem Arzt frei und spricht von einer "rechtfertigenden Pflichtenkollision". Und die Ökonomen? "Aus Perspektive der Wertmaximierung ist es schwer nachvollziehbar, warum die Ärztin, die A mit einer halben Dosis hilft und die zweite Hälfte der Dosis entsorgt, etwas Unrechtes tut (Totschlag durch Unterlassen), während die Ärztin, die C mit der ganzen Dosis hilft, nichts Unrechtes tut", konstatiert Lübbe. Denn die Ergebnisse, dass zwei Patienten sterben, seien in beiden Fälle dieselben. Ob sich solche rechtlichen und moralischen Zurechnungsurteile im Rahmen einer formalen ökonomischen Entscheidungstheorie umformulieren lassen, wird in dem Band anschaulich diskutiert. Mehrheitlich überwiegt die Skepsis, in der ökonomischen Entscheidungstheorie wenigstens minimale Kohärenzbedingungen menschlichen Handelns zu betrachten, wenn es um rechtliche und moralische Urteile geht. Die Suche nach einer "Grand Theory" als einer Ökonomik und Jurisprudenz überspannenden gesamten Staatswissenschaft geht also weiter. JOCHEN ZENTHÖFER
Chr. Engel, L. O'Hara, S. Egidy, Y. Hermstrüwer, L. Hoeft, P. Langenbach: Öffentliches Recht als Verhaltensordnung, Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 389 Seiten, 49 Euro.
Milena Maurer: Geld oder Gerechtigkeit? Mohr Siebeck, Tübingen 2025, 341 Seiten, 89 Euro.
Armin Steinbach: EU Law and Economics, Oxford University Press 2025, 272 Seiten, 122 Euro.
Philippe-Emmanuel Partsch: The 5 labours of Europe. A Europe that will make us grow, Institute of Competition Law, New York 2024, 25 Euro.
Weyma Lübbe / Thomas Grosse-Wilde (Hrsg.): Abwägung. Voraussetzungen und Grenzen einer Metapher für rationales Entscheiden, Brill/Mentis, Paderborn 2022, 429 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Geld oder Gerechtigkeit?" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









