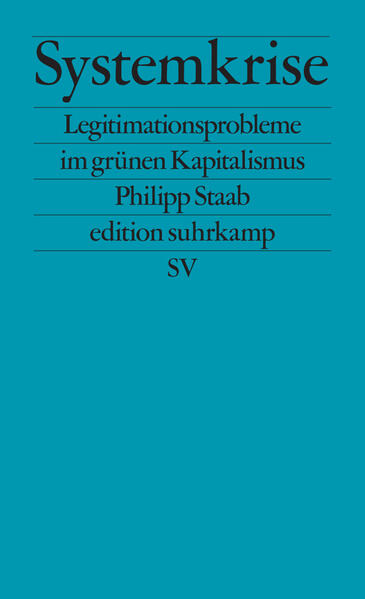Besprechung vom 06.11.2025
Besprechung vom 06.11.2025
Mehr als die Verlängerung der Gegenwart kommt nicht in den Blick
Spätmoderne Verunsicherungen: Philipp Staab macht sich an eine Erklärung, warum von der ökologischen Transformation mittlerweile kaum mehr die Rede ist
Irgendwo zwischen Heizungshammer und Flugscham war plötzlich Schluss mit der Klimadebatte. Zuvor hatte das Land etwa vier Jahre lang leidenschaftlich geplappert, wie viel Veganismus und Lastenräder im ländlichen Raum es brauche, um klimaneutral zu werden. Unverschämt, leidenschaftlich, folgenlos. Seither herrscht eisernes Schweigen. Keine Talkshows mehr über CO2-Grenzausgleichssysteme, kein Aufregen mehr über die angeblich Letzte Generation. Der Kanzler fliegt zwar zur COP nach Brasilien, hatte aber in seiner Standard-Wahlkampfrede nicht einmal Platz für einen einzigen Gedanken zum Klima. Wie ist das so gekommen und warum so schnell?
Der Berliner Soziologieprofessor Philipp Staab erscheint mit "Systemkrise - Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus" gerade richtig auf der Szene, um eine triftige Antwort auf diese Fragen zu geben. Staab gibt sich nicht mit einer deskriptiven Aneinanderreihung von Backlash-Momenten zufrieden. Er möchte einen Beitrag liefern, wie er selbst schreibt, die "Identitätskrise der spätmodernen Gesellschaft" zu erklären. Diese Krise steht für ihn im Zentrum des verloren gegangenen Themas, der aus dem Blick geratenden Modernisierungsagenda.
Seinem eigenen Fach rechnet Staab an, dass es sich tiefgehender mit dem ökologischen Gesellschaftskonflikt auseinandergesetzt hat als etwa die Medien. Diese übersähen, was die Gemeinsamkeit der wütenden Bauernproteste gegen wegfallende Diesel-Subventionen und des Protests gegen das Gebäudeenergiegesetz sei: Ängste ärmerer Haushalte vor höheren Rechnungen. Klares Bewusstsein für hohe Kosten der Modernisierung habe gefehlt.
Staab knüpft in seinen Überlegungen an zwei prominente Vertreter seiner Disziplin an: Ulrich Beck, der umweltbezogene Achtsamkeit als einen Kerngedanken seiner Zeit identifizierte, und Jürgen Habermas, in dessen Schema fundamentaler sozialer Konflikte er den ökologischen Widerstreit zwischen rückwärts und voraus orientierten Gesellschaftsgruppen als neue leitende Konfrontation integriert.
Nach den Fortschrittsversprechen früherer Zeiten komme mit der ökologischen Modernisierung ein gesellschaftliches Projekt ins Spiel, das keine Aussicht auf Verbesserung biete. Schon in dieser Eigenschaft liege begründet, dass es Abwehr in der Gesellschaft hervorruft. Es gehe somit nicht mehr darum, bestehende Verhältnisse für etwas Besseres zu überwinden: "Nicht die transformative Zukunft, sondern Gegenwartsverlängerung bildet das eigentliche Motiv."
Über die knapp zweihundert Seiten seines Buchs entwickelt Staab die im Öko-Wortbestandteil enthaltene Hausmetapher. Durch den Klimawandel wirke von außen eine Bedrohung auf die Stabilität des Hauses ein. Herausfordernd ist, dass parallel zu dieser neuen, mit wenig Optimismus verbundenen Aussicht auf künftige Lebensentfaltung auch im Inneren des Hauses die Statik durcheinandergerät. Denn die Dynamik eines Staates im Wandel greife die sozialen Bezüge ebenfalls an. In der Gesellschaft setze durch dieses Zusammenspiel eine Art von Lähmung ein: "In der ökologisch beunruhigten Spätmoderne grassiert die Angst vor dem Zusammenbruch bestehender Lebensmodelle." Zukunftseroberung sei kein Motiv mehr, wenn es darum gehe, die Gegenwart zu verlängern. Gelang es früher, widerstreitende Gruppen in Verteilungskonflikten auf ein besseres Morgen zu vertrösten, bestehe nun keine Aussicht mehr auf eine vielversprechende kommende Zeit. Bestehende Verhältnisse würden gegen einen Ansturm kommender Probleme abgesichert. Eine Gruppe mache mit, die andere sperre sich.
In dieser Ausgangslage bilde sich gegenüber bestehenden Grundkonflikten von Arbeit und Kapital, Unten und Oben, Innen und Außen (Einheimische und Zuwanderer) ein neuer Interessengegensatz zwischen bedrohter Gegenwart und bedrohter Zukunft heraus. Die Angst vor einer schlechteren Zukunft sei bestimmend, so habe die ökologische Frage "ein zentrales Element im liberalen Fundament des spätmodernen Hauses zerstört".
Im weiteren Verlauf grenzt Staab Lebenswelten der Abwehr, des grünen Kapitals und des Engagements voneinander ab, die er in einem empirischen Projekt identifiziert hat. Aus Argumentationsmustern von Probanden leitet er ihre Besorgnisse und Glaubenssätze ab, die sich in ihren Haltungen zur ökologischen Transformation ausprägen. Die Unterschiede sind sichtbar und deuten auf verhärtete Fronten hin, die kaum zu überwinden sind.
Dass die Darstellung der sozialen Evolution vom Spätkapitalismus übers "neoliberale" Zeitalter bis zur ökologischen Modernisierung bei Staab etwas stromlinienförmig gerät, ist verzeihlich. Aber in der Auseinandersetzung mit Staabs These muss zu fragen erlaubt sein, ob die Stabilität der Gesellschaft angesichts einer erheblichen Bedrohung wirklich von Bedingungen abhängt, die die Soziologie aus den Verhältnissen des kurzen Zeitalters einer außergewöhnlich wohlhabenden Gesellschaft für selbstverständlich nimmt. Anders gesagt: Ist nicht auch eine gute Welt vorstellbar, in der Energie, Mobilität und Nahrung weniger CO2-intensiv bereitgestellt werden, und könnte dieser Wandel den Akteuren auch etwas wert sein?
Aber eines leistet Staabs Buch ganz sicher: Wer über vereinende und überzeugende Narrative einer wünschenswerten nachhaltigen Zukunft nachdenkt, wird nicht so leicht über berechtigte Ängste und das alle einende Motiv der Gegenwartsverlängerung hinweggehen können. PHILIPP KROHN
Philipp Staab: "Systemkrise". Legitimationsprobleme im grünen Kapitalismus.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 221 S., br.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.