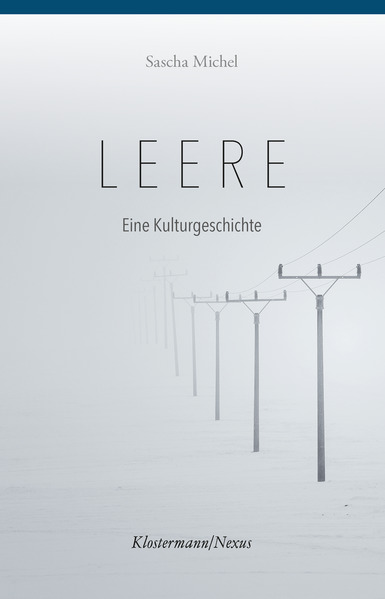
Zustellung: Fr, 18.07. - Mo, 21.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Vom Horror vacui, vom Schrecken der Leere, sprach schon das Mittelalter. Und auch in der Gegenwart fürchten wir nichts so sehr wie Leerlauf und Langeweile, leere Gasspeicher und leere Supermarkt-Regale. Andererseits hat die gespenstische Leere, die wir aus dem Corona-Lockdown oder von dystopischen Zombie-Filmen kennen, auch etwas Faszinierendes. Für die Atomisten der Antike gab es nur dank der Leere überhaupt Bewegung in der Welt. Von Zen bis Dada, von der Moderne bis zur Pop-Kultur wird die Leere nicht gefürchtet oder geleugnet, sondern gefeiert und bejaht, erforscht und in Szene gesetzt. Dieses Buch erzählt die wechselhafte Geschichte eines ambivalenten Begriffs. Es geht dabei nicht nur um das mächtige Phantasma von der großen, gewaltigen Leere am Anfang und Ende der Welt, sondern auch um die Leere als Spiel- und Zwischenraum: um die Leerstellen unserer Selbst- und Weltbilder, um eine gelockerte Kultur der Pausen und Lücken. Denn die Löcher sind bekanntlich die Hauptsache an einem Sieb.
Already the Middle Ages knew of horror vacui, the horror of emptiness. And as for us today, there is still nothing we fear more than idleness and boredom, empty gas tanks and empty supermarket shelves. On the other hand, the ghostly emptiness we experienced during the coronavirus lockdown or in dystopian zombie films also has something fascinating about it. For the atomists of antiquity, it was only thanks to the void that there was any movement in the world at all. From Zen to Dada, from modernism to pop culture, emptiness is not feared or denied, but celebrated and affirmed, explored and staged. This book tells the ever-changing story of an ambivalent concept. It is not only about the powerful phantasm of the great, enormous void at the beginning and end of the world, but also about the void as a space of play and in-between: about the empty spaces of our self-images and world views, about a loosened culture of pauses and gaps. Because, as we all know, the holes are what essentially makes a sieve.
Already the Middle Ages knew of horror vacui, the horror of emptiness. And as for us today, there is still nothing we fear more than idleness and boredom, empty gas tanks and empty supermarket shelves. On the other hand, the ghostly emptiness we experienced during the coronavirus lockdown or in dystopian zombie films also has something fascinating about it. For the atomists of antiquity, it was only thanks to the void that there was any movement in the world at all. From Zen to Dada, from modernism to pop culture, emptiness is not feared or denied, but celebrated and affirmed, explored and staged. This book tells the ever-changing story of an ambivalent concept. It is not only about the powerful phantasm of the great, enormous void at the beginning and end of the world, but also about the void as a space of play and in-between: about the empty spaces of our self-images and world views, about a loosened culture of pauses and gaps. Because, as we all know, the holes are what essentially makes a sieve.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
21. Mai 2024
Sprache
deutsch
Auflage
Auflage 2024
Seitenanzahl
242
Reihe
Klostermann Nexus, 110
Autor/Autorin
Sascha Michel
Verlag/Hersteller
Produktart
kartoniert
Gewicht
389 g
Größe (L/B/H)
220/145/25 mm
ISBN
9783465046585
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 06.09.2024
Besprechung vom 06.09.2024
Rund um nichts
Sascha Michel widmet sich Leerstellen
Es ist nur auf den ersten Blick ein befremdliches Unterfangen, ein über zweihundert Seiten starkes Buch über fast gar nichts zu schreiben. Sollte sich Leere nicht gerade dadurch auszeichnen, weitgehend nichtssagend zu sein? Dieser naheliegende Gedanke müsste spätestens beim Blick auf die Zeitungsseite, die diese Rezension enthält, eine zumindest leichte Erschütterung erfahren. Denn anteilig ist auf dieser Seite die weiße Leere in deutlich größerer Menge vorhanden als die gedruckte Schwärze.
Mit allzu viel Fülle, so lässt sich daran lernen, kann die abwesenheitsabhängige Spezies Mensch schwerlich umgehen. Und Leerstellen sind nicht nur sinngenerierend, sondern sind sowohl in ihrer materiellen wie auch immateriellen Form konstitutiv für menschliches Leben. Durchgänge, Öffnungen, Poren machen Existenz überhaupt erst möglich.
Insofern ist die Leere, der sich Sascha Michel in seinem kulturgeschichtlichen Rundumblick widmet, ein mit zahlreichen Facetten angefülltes Thema - in der Tat so angefüllt, dass der Autor sich gar nicht allen Aspekten widmen kann. Michel konzentriert sich eher auf die immaterielle Seite der Leere, auf ihre Rolle als diskursives Phänomen in der sogenannten Moderne. Das Buch ist chronologisch aufgebaut und widmet sich der Behandlung der Leere im europäisch-westlichen Kontext von der Romantik bis zur Klimakrise. Michel weiß durch Belesenheit, weit gefächerte kulturelle Kenntnis sowie die stilistisch eingängige Präsentation seiner Geschichte zu überzeugen. Er überrascht zwar nicht mit Funden, die einer solchen Kulturgeschichte ein gänzlich neues Gepräge geben würden. Aber es gelingt ihm, Phänomene, Entwicklungen oder Denkrichtungen um das konstitutive Element der Leere anzuordnen und dessen Bedeutung aufscheinen zu lassen. Schließlich lautet eine weitere differenztheoretische Binsenweisheit: Leere lässt sich nur in Korrespondenz zur Fülle erkennen.
Michels Kulturgeschichte gewinnt ihr spezifisch europäisch-westliches Gepräge durch die Darstellung der offensichtlichen Abneigung, die im Westen gegenüber dem Leeren gehegt wurde. Weder die aristotelische Philosophie noch die christliche Theologie konnten besonders viel mit dem Nichtvorhandenen anfangen - mit Auswirkungen bis in unsere Gegenwart. Buddhistische Denkschulen verfolgten da einen gänzlich anderen Ansatz, mit ebenso weitreichenden Folgen.
Dass mit der Moderne ab etwa 1800 das Leere für christlich geprägte Kulturen erneut zu einem Problem werden sollte, lässt sich unschwer erahnen: Die schwindende oder negierte Bedeutung eines Schöpfergottes produzierte ein kosmologisches Vakuum, das nicht so leicht gefüllt werden konnte. Michel führt in seinem Buch luzide das Wechselspiel vor, das sich für europäische Zusammenhänge aus dieser Konstellation ergab: einerseits in dem Bemühen, die Leerstelle durch einen Ersatz füllen zu wollen, andererseits sie als Antrieb zu nutzen, um erhebliche Dynamiken auszulösen - etwa um mittels Raketenantrieb in die Leere des Weltalls vorzustoßen.
Zwischen Endzeitphantasien und Machbarkeitshybris entfaltet Michel ein Panorama an modernen Leerstellen, das die Frage provoziert, worin die viel beschworenen Fundamente bestehen sollen, auf die sich Gemeinwesen immer wieder berufen - außer in der Anrufung dieser Fundamente selbst. Das Subjekt weiß seit Descartes um sich selbst nur noch, weil es sich selbst denkt; die Demokratie muss sich ihrer selbst immer wieder vergewissern, weil sie gerade keinen substantiellen Kern hat; und der Kapitalismus kaschiert die kosmologische Leere mit einem Kreislauf von Produktion und Konsum, der zu seinem wesentlichen Inhalt nur das eigene Funktionieren hat.
Falls das nun etwas abstrakt klingen mag, denke man nur an ein prominentes Bauwerk der westlichen Moderne, die am häufigsten besuchte Sehenswürdigkeit weltweit, die erst in diesem Sommer während der Olympischen Spiele einmal mehr im Mittelpunkt von Kamerafahrten stand: Der Eiffelturm in Paris ist eine nahezu vorbildliche Manifestation der konstitutiven Rolle von Leerstellen. Diese Ingenieurleistung steht nicht nur auf einem weitgehend entleerten Marsfeld, besticht nicht nur durch seine löchrige Bauweise, sondern ist vor allem nahezu funktionsfrei. Der Eiffelturm existiert nur, weil es möglich war, ihn zu bauen. Er verweist ausschließlich auf sich selbst - selbst wenn er nun weiterhin die olympischen Ringe tragen soll, ist er ein durchaus angemessenes Mahnmal für die Bedeutung der Leere in der Moderne. ACHIM LANDWEHR
Sascha Michel: "Leere". Eine Kulturgeschichte.
Klostermann Verlag, Frankfurt am Main 2024. 242 S., br.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Leere" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.











