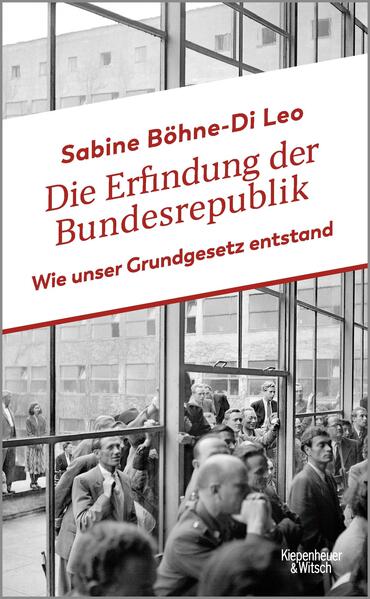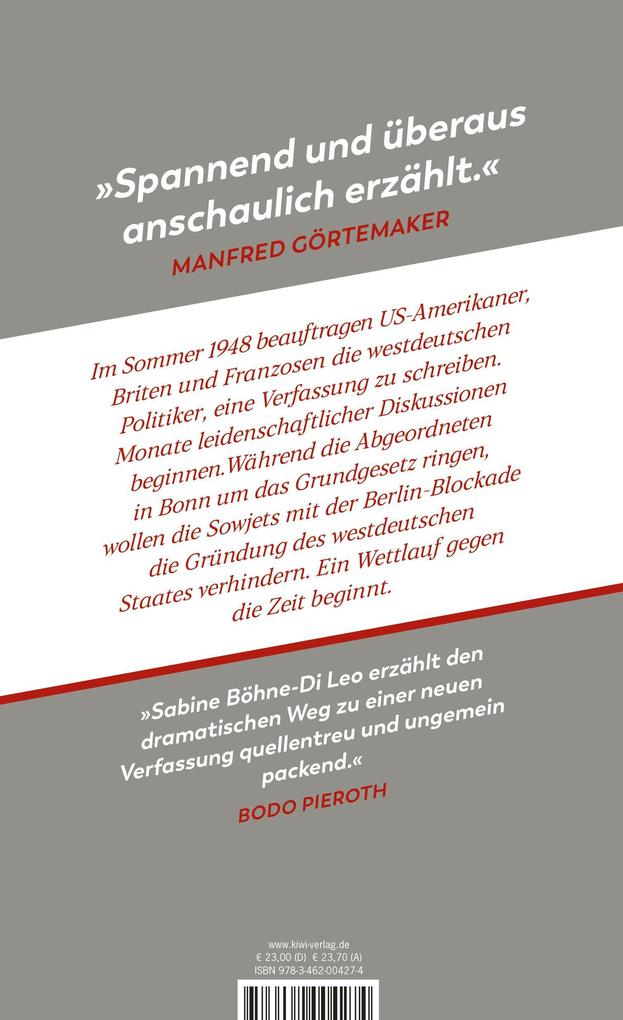Besprechung vom 10.12.2024
Besprechung vom 10.12.2024
Eine Bettlektüre zum Grundgesetz
Sabine Böhne-Di Leo zeigt: Die Gründung des Bundesrepublik kann auch spannend und unterhaltsam sein
Jeder Staat brauche seine Gründungsmythen. So lautet eine oft gehörte These. Das fördere die Identifikation der Bürger mit ihrem Gemeinwesen. Zweifelsohne ist die Bundesrepublik da keine Ausnahme. Aber in ihrem Fall darf man die Latte getrost etwas tiefer hängen: Ein paar flott geschriebene populärwissenschaftliche Bücher über ihre Anfänge würden fürs Erste auch schon genügen. An gediegenen historischen Abhandlungen zur Entstehung des Grundgesetzes herrscht zwar kein Mangel. Aber wer eine Bettlektüre sucht, der findet auch 75 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik kaum ein Buch, das ihm diese politische Schöpfungsgeschichte als spannende und unterhaltsame Erzählung präsentiert.
Man könnte meinen, das liege in der staatstragenden Natur der Sache: Die Entwicklung von den Frankfurter Dokumenten der drei westlichen Besatzungsmächte über den Konvent von Herrenchiemsee bis zu den Beratungen des Parlamentarischen Rats in Bonn sei eben nicht der Stoff, aus dem packende Dramen gemacht sind. Das Buch "Die Erfindung des Grundgesetzes" von Sabine Böhne-Di Leo beweist, dass auch diese Materie nicht staubtrockene Staatsbürgerkunde sein muss. Die Journalistin zeichnet das Ringen der Ministerpräsidenten, Besatzungsmächte und Staatsrechtler um die deutsche Verfassung, die nur ein Provisorium sein sollte, überaus anschaulich nach. Dabei ist ihr Ansatz altbekannt und wenig originell: Sie erzählt Geschichten, zeichnet persönliche Schicksale nach und bettet die politische Entwicklung darin ein. Aber das gekonnt.
Noch bevor der Leser etwa Genaueres über Adenauers Wirken als Präsident des Parlamentarischen Rates erfährt, liest er von seiner Frau Gussie: Die zweite Gattin des späteren Bundeskanzlers hatte 1944 dem Druck der Kölner Gestapo im Verhör nicht standgehalten, das Versteck ihres Mannes verraten und daraufhin einen Selbstmordversuch unternommen.
Das trägt nicht zum tieferen Verständnis der Beratungen des Parlamentarischen Rates über die Grundrechte bei. Aber es zeigt dem Leser eine sonst oft unnahbar wirkende Gründungsfigur der Bundesrepublik von einer persönlichen Seite.
Ein anderes Beispiel ist das im Buch zitierte Spottgedicht, das der spätere Bundespräsident Theodor Heuss auf den Sozialdemokraten Carlo Schmid dichtete, neben Adenauer die maßgebliche Figur des Parlamentarischen Rates. Anlass dafür war, dass Schmid zunächst nicht von der Forderung abrücken wollte, erstmal nur ein "Staatsfragment" zu gründen, aber keinen Staat - und das mit der ihm eigenen professoralen Art vortrug.
Auch der Einstieg des Buches ist ungewohnt: Statt eines magistralen Überblicks über den sich zuspitzenden Kalten Krieg im Sommer 1948 schildert die Autorin, wie die außerhalb von Fachkreisen kaum bekannte Louise Schroeder mit einem leeren Rosinenbomber nach Westdeutschland fliegt, um als Ehrengast der Konferenz im Koblenzer Hotel "Rittersturz" an die Ministerpräsidenten einen Appell gegen die Gründung eines deutschen Weststaates ohne die sowjetische Besatzungszone zu richten. Die Sozialdemokratin war die amtierende Oberbürgermeisterin Berlins, weil die sowjetische Besatzungsmacht den Amtsinhaber, ihren Parteifreund Ernst Reuter, damals nicht anerkannte.
Wer auf nur knapp 200 DIN-A5-Seiten die Gründung der Bundesrepublik Deutschland nachzeichnen will, muss vieles verdichten, verknappen oder ganz weglassen. Umso hilfreicher ist es, dass dieses Buch nicht völlig auf Fußnoten verzichtet. THOMAS JANSEN
Sabine Böhne-Di Leo: Die Erfindung der Bundesrepublik. Wie unser Grundgesetz entstand.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2024. 224 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.