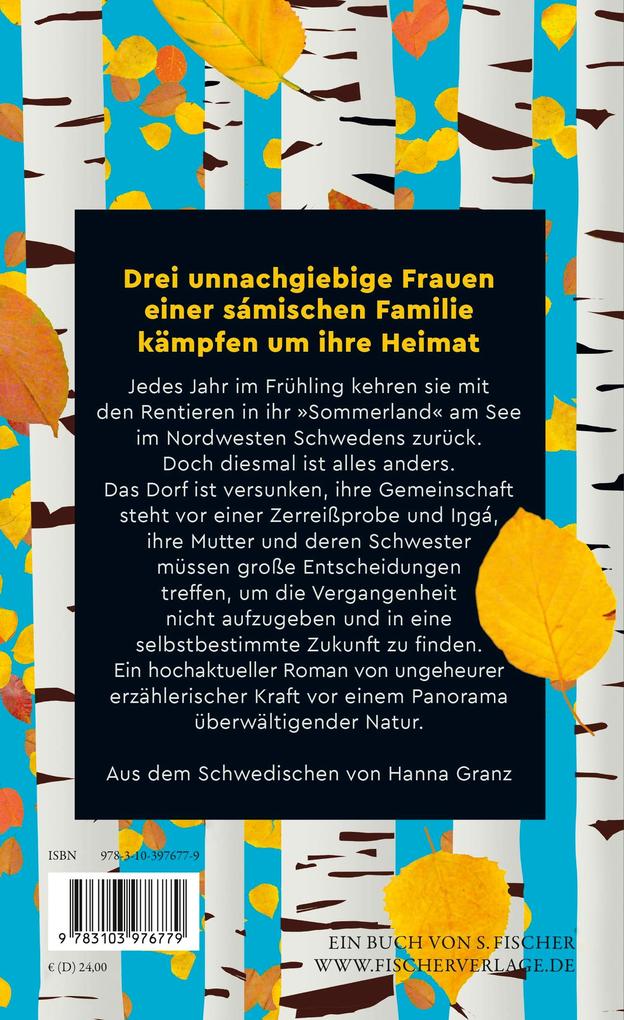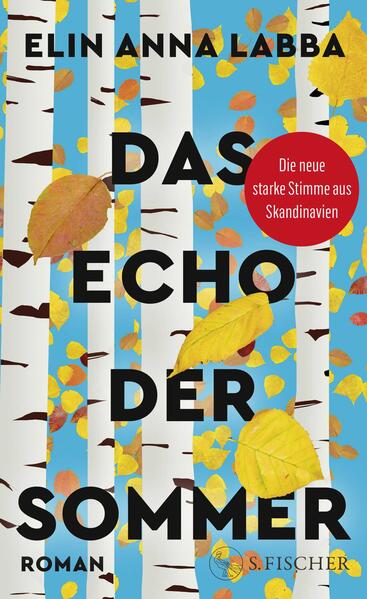
Zustellung: Fr, 01.08. - Mo, 04.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Vor einem Panorama überwältigender Natur - drei unnachgiebige Frauen einer sámischen Familie kämpfen um ihre Heimat
Jedes Jahr im Frühling kehren sie nach dem Winter in ihr »Sommerland« am See im Nordwesten Schwedens zurück. Doch in diesem Frühjahr ist alles anders: Als die dreizehnjährige I_gá mit den Rentieren, Mutter und Tante das Tal erreicht, ist ihr Dorf versunken. Birken, Hütten, das Hab und Gut der Familie und vor allem das Grab des Vaters - alles unter Wasser, rücksichtslos geopfert für die Wasserkraftproduktion und den Profit der Städte im Süden. Es beginnt ein jahrzehntelanger Kampf gegen die Mächtigen des Landes, der nicht nur die drei Frauen, sondern das ganze sámische Dorf vor eine Zerreißprobe stellt.
Elin Anna Labba erzählt die weitgehend unbekannte Geschichte ihrer Gemeinschaft und schafft ein unvergessliches Zeugnis für das Recht auf Selbstbestimmung und die tiefe Verbundenheit von Mensch und Natur. Ein hochaktueller Roman von ungeheuer erzählerischer Kraft.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. April 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Roman | Über die Lebenswelten der Sámi von der neuen starken Stimme aus Skandinavien.
Originaltitel: Far inte till havet.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
464
Autor/Autorin
Elin Anna Labba
Übersetzung
Hanna Granz
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
schwedisch
Produktart
gebunden
Gewicht
562 g
Größe (L/B/H)
207/125/40 mm
ISBN
9783103976779
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Ein wichtiger, trauriger, wuchtiger Roman, berührend und beschämend. Verena Stössinger, NZZ Online
Mit weichen, von Hanna Granz melodiös übersetzten Sätzen erzählt Matthias Hannemann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
[. . .] ergreifend und poetisch Janne Mommsen, Freundin
[. . .] Labba hat ein wehmütiges Buch geschrieben. Ein Buch, das in jedem Satz klarmacht, wie eng Mensch und Landschaft verwoben sein können. Kathleen Hildebrand, Süddeutsche Zeitung, SZ am Wochenende
Mit weichen, von Hanna Granz melodiös übersetzten Sätzen erzählt Matthias Hannemann, Frankfurter Allgemeine Zeitung
[. . .] ergreifend und poetisch Janne Mommsen, Freundin
[. . .] Labba hat ein wehmütiges Buch geschrieben. Ein Buch, das in jedem Satz klarmacht, wie eng Mensch und Landschaft verwoben sein können. Kathleen Hildebrand, Süddeutsche Zeitung, SZ am Wochenende
 Besprechung vom 21.06.2025
Besprechung vom 21.06.2025
Diese Narbe kann nicht mehr heilen
Aber etwas Moderne wäre vielleicht sinnvoll: Der traurig-schöne Roman "Das Echo der Sommer" von Elin Anna Labba erzählt von den indigenen Sámi in Schweden.
Das Touristenpaar, das in den Siebzigerjahren mit dem Auto nach Norden gelangt, fährt für dieses Panorama kurz einmal rechts ran: "So ein großer See so hoch in den Bergen", sagt die Frau, "das ist doch traumhaft." Wie wahr. Schwedisch-Lappland ist umwerfend schön.
Die kleine Szene aus Elin Anna Labbas Roman "Das Echo der Sommer" ist trotzdem unangenehm. Das liegt zum einen an zwei Frauen, die neben den Touristen stehen: Ingá und Rávdna. Sie hören ihnen mit fassungslosen Gesichtern zu, dann zieht die jüngere die ältere fort.
Zum anderen ist klar, dass die Autorin eigentlich ihre Leser meint mit diesen unbedarften Touristen. Ohne die Lektüre wüssten nämlich auch die meisten von ihnen nichts von den Menschen, die ehedem ebendort, wo nun Wellen schwappen, im Einklang mit der Natur zu leben vermochten. Sie würden ebenso mit gebügelten Freizeitklamotten am Wasser stehen und den Damm als Wunderwerk der Baukunst bezeichnen. Kämen gar nicht erst auf die Idee, dass der Akkajaure, ein mehr als sechzig Kilometer langer Stausee, ein Ort der Zerstörung und Vertreibung sein könnte.
Mit weichen, von Hanna Granz melodiös übersetzten Sätzen erzählt "Das Echo der Sommer" von der allmählichen Flutung der vormaligen Landschaft. Bei Handlungsbeginn in den Vierzigerjahren stehen noch drei Frauen im Zentrum: die Schwestern Rávdná und Ànna und Ingá, Rávdnas in sich gekehrte Tochter. Sie gehören zu einer Gruppe von Sámi, die den dunklen Winter in einem Ort weiter östlich verbringt und im Frühjahr stets wieder hierher, in ein bislang von Flüssen und kleineren Seen bestimmtes "Sommerland", zieht.
Ein faszinierend archaischer Rhythmus. Sobald der Winter endet, folgen die Menschen den Rentieren bis an die Sumpfgebiete und fischreichen Gewässer. Dort leben sie in Torfkoten und hätten das auch in jenem Sommer, in dem das Buch einsetzt, wieder getan.
Diesmal erwartet die Gruppe indes ein "ertrunkenes Dorf": "Der Staudamm war bereits fertig gewesen, das hatten sie gewusst. Niemand aber hatte geahnt, dass der See so schnell ansteigen würde." Die Schäden sind erheblich schlimmer als bei den ersten Flutungen, die "das Unternehmen" vor vielen Jahren durchführte. Sicher wird man sich wieder anzupassen versuchen und abermals neue Bauten oberhalb des Wasserpegels errichten. Die alte Heimat jedoch: verlorene Welt.
Die Frauen besteigen ein Boot und blicken in die Tiefe hinab: "Der Birkenwald war ein See. Die Bäche Unterwasserströmungen (. . .). Da lag der Weg, der früher durchs Dorf führte." Aus den Beobachtungen wird ein Roman-Anfang, den man so schnell nicht vergisst. Überall am See versuchen Menschen zu retten, was vielleicht noch zu retten ist. Das Grab von Ingás Vater versinkt.
Diskret schildert die Autorin nebenher das Leben der Sámi, ihre Kleidung und Wohnform, ihr inniges Verhältnis zu Tier und Natur, ihre Kultur. Sie benutzt viele Begriffe, unter denen man sich zunächst wenig vorstellen kann: "Gákti", "Cuipi", "Boassu", "Joik". Ganze Sätze auf Samisch bleiben unübersetzt. Doch genau das erzeugt den charaktervollen Ton des Romans.
Manchmal erhält außerdem der See eine Stimme: "Ich hatte einen Namen, den ich vergessen habe. Ich war Meerengen und Strände, Wasserfälle und Buchten." Das ist kein Schwulst. Es ist Ausdruck des uns fremden samischen Wirklichkeitsverständnisses. Der Unterschied zwischen einem in "Sápmi" und einem in Deutschland gebauten Stausee ("Edersee-Atlantis") liegt in diesem besonderen Bezug zur Natur. Sie ist für die Sámi beseelt, wobei man diesen Begriff nicht christlich verstehen darf.
Zurück im Osten, erhält "die Nomadenwitwe" Rávdna einen dünnen Brief, und die dünnen, das weiß sie, die sind gefährlich. Das Schreiben stammt von einem Verwaltungsbeamten, den Rávdna um einen Immobilienkredit gebeten hat. Sie möchte die heruntergekommene Behausung, in der sie die Winter verbringt, endlich verlassen und ein richtiges Häuschen errichten. Die Antwort ist abschlägig: "Lappen" erscheinen dem schwedischen Staat "für die Sesshaftigkeit nicht geeignet".
Derselbe Staat, der ihren Kulturraum zerstört, verhindert also ihre behutsame Anpassung an die Moderne und die Integretation in die Gesellschaft. Er verfährt seit Jahrzehnten nach dem Motto "Lapp ska vara Lapp" (Lappe soll Lappe bleiben), eine fürchterliche Mischung aus Rassismus und Romantik, und zieht am Winterquartier selbst die knisternden Stromleitungen, die mit den ersten Dämmen und Kraftwerken in die Gegend einzogen, über die nasskalten Behausungen der Sámi hinweg. Was an festeren Baracken bereits existiert, soll möglichst verschwinden.
Rávdná ist glücklicherweise eine starke weibliche Romanfigur: Sie trotzt der fehlenden Baugenehmigung und dem fehlenden Geld und baut für sich und die Ihren ein winziges Häuschen oberhalb des neu entstandenen Sees. Die Abrissverfügung ignoriert sie ebenso wie das Kopfschütteln, mit dem konservative Samen den viereckigen Bau mit Fenstern quittieren: "Wir sind ein Volk, das in Koten lebt", betonen die anderen. Etwas Moderne sei aber doch durchaus sinnvoll, hält ihnen Rávdna entgegen. Feuchtigkeit und Schimmel will sie ihrer Tochter nicht mehr zumuten. Erst recht nicht jetzt, wo so viel anderes, was einmal ein Zuhause bedeutet hat, rücksichtslos vernichtet wurde.
Im zweiten Teil des Romans, der 1968 einsetzt, droht das Wasser auch dieses Haus zu erreichen. Es steigt fast den gesamten traurig-schönen Roman hindurch, und je weiter es steigt, umso schwächer wird Rávdna: "Dieser Staudamm frisst alles auf, was ich denke." Am Ende wird sie dement sein - und nicht mehr erleben, dass sich der Traum von besseren Zeiten immerhin für ihre Tochter erfüllt. Wenn auch in sehr bescheidenem Ausmaß.
Mäkeln lässt sich immer. Schwer zu greifen sind zum Beispiel die Orte der Story, weil die Autorin hier mit vielen fiktiven Namen arbeitet; und wie das Echo eines Sommers klingt, muss uns die Marketing-Abteilung des deutschen Verlages auch mal in einer ruhigen Stunde erklären.
Aber es läuft einem warm durchs Herz und kalt den Rücken herunter bei der Lektüre dieses Debüts. Für die Autorin, eine gelernte Journalistin, die in Kiruna die Winter ihrer Kindheit und am Akkajaure die Sommer verbrachte (sie schreibt auf Schwedisch, weil sie die Sprache ihrer Vorfahren erst als Erwachsene lernte), ist der Roman das Nachfolgeprojekt eines Sachbuchs, das sich mit Zwangsumsiedelungen samischer Familien nach der sogenannten "Rentierweidekonvention" 1919 befasste und mit dem "Augustpreis" ausgezeichnet wurde.
Für deutsche Leser ergänzt "Das Echo der Sommer" die beiden Sámi-Romane, mit denen Ann-Helén Laestadius unlängst an die unrühmlichen Nomadenschulen erinnerte und an den Rassismus, dem Rentierzüchter in Nordschweden bis heute ausgesetzt sind. Man fährt anders durch "Lappland", wenn man solche Bücher gelesen hat. Auch die Nachrichten lesen sich anders, die gelegentlich Proteste der Sámi gegen Bergbauprojekte und Windkraftanlagen vermelden. MATTHIAS HANNEMANN
Elin Anna Labba: "Das Echo der Sommer". Roman.
Aus dem Schwedischen vom Hanna Granz. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2025. 464 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 22.07.2025
Beeindruckend
Das Echo der Sommer von Elin Anna Labba ist ein poetisch anmutendes Buch, das die Leser auf eine eindrucksvolle Reise in die außergewöhnliche Natur und Kultur der Samen mitnimmt, die bisher weitestgehend verborgen im Dunkeln liegt.
Elin Anna Labba schafft es, die Atmosphäre der nordischen Landschaft lebendig und bildhaft einzufangen und gleichzeitig tief in die Geschichte und die Traditionen der Samen einzutauchen und den Stolz der Menschen zu transportieren.
Besonders beeindruckend ist die Art und Weise, wie die Autorin persönliche Erlebnisse der Protagonistinnen mit historischen Hintergründen verwebt, was dem Buch eine emotionale Tiefe verleiht.
Ein kleiner Kritikpunkt für mich ist die Komplexität der Begrifflichkeiten, die der breiten Leserschaft vermutlich nicht geläufig sind. Es ist ein Buch, das Aufmerksamkeit erfordert, aber auch verdient!
am 21.07.2025
Überflutete Heimat - entrechtetes Volk
Elin Anna Labba erzählt in ihrem ersten Roman über rund fünf Jahrzehnte hinweg die Geschichte einer samischen Familie in Nordschweden aus der Perspektive von drei Frauen: der strotzenden Kämpferin Rávdná, ihrer zurückhaltenden Schwester Ánne und ihrer Tochter Ingå. Jedes Frühjahr kehren sie als Halbnomaden gemeinsam ins Sommerland zurück nur um zu erleben, wie ihr Dorf mehrfach vom steigenden Stausee überflutet wird. Staatliche Wasserkraftprojekte zerstören ihre Heimat, die Torfkoten versinken im Wasser, ohne dass die Samen vorab einbezogen oder danach entschädigt werden. Die herablassende, rassistische Haltung der schwedischen Regierung war für mich bei der Lektüre kaum erträglich. So wird etwa ein Antrag für einen Baukredit wie folgt abgelehnt: "Die damit (mit dem Bau eines Hauses) einhergehenden Verlockungen würden die Lappen nur verweichlichen. ... Die natürlichen Eigenschaften der Lappen sind für die Sesshaftigkeit nicht geeignet."
Die drei Protagonistinnen reagieren höchst unterschiedlich auf die Unterdrückung durch den schwedischen Staatsapparat: Rávdná rebelliert, kämpft um Landrechte und versucht trotz Diskriminierung ein richtiges Haus zu bauen, während Ánne resigniert und Ingå zunehmend sesshaft wird, sich also anpasst. Diese Konstellation erzeugt Spannung und zeigt zugleich die verschiedenen möglichen Wege, mit staatlicher Repression umzugehen.
Anfangs zog sich die Story etwas sehr in die Länge, aber im weiteren Verlauf hat mich die Geschichte sehr gefesselt. Das Staatsversagen gegenüber indigenen Rechten - in Europa und bis in die 1970er Jahre hinein, wohlgemerkt! - macht mich zutiefst betroffen und ich danke der Autorin, dass sie diese wenig bekannten Ungerechtigkeiten ans Licht gebracht hat.
Sprachlich ist der Roman durch sehr viele samische Begriffe und ganze Sätze einerseits sehr authentisch, andererseits ist die Lektüre dadurch auch sehr herausfordernd, zumal ein Glossar fehlt und man oft nur raten kann, was die fremdsprachlichen Begriffe bedeuten. Sehr gut herausgearbeitet ist hingegen, wie naturverbunden das Volk der Samen ist. Und so wirkt hier stimmig, was mich in einem anderen Setting vermutlich gestört hätte, nämlich dass der Stausee eine eigene Erzählstimme erhält. In kursiven Einschüben, auf sehr poetische Weise, kommt so der große See zu Wort, der - menschengemacht - für die Menschen Fluch und Segen zugleich ist.
Fazit: Ein eindrucksvoller Roman mit kraftvollen Naturbeschreibungen, ein wichtiges, poetisch erzähltes literarisches Zeitdokument über eine wenig bekannte indigene Geschichte in Nordschweden.