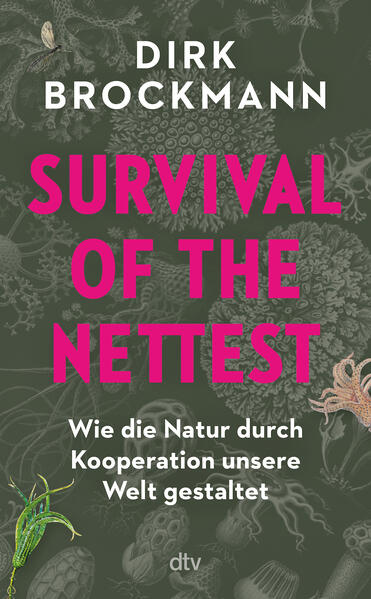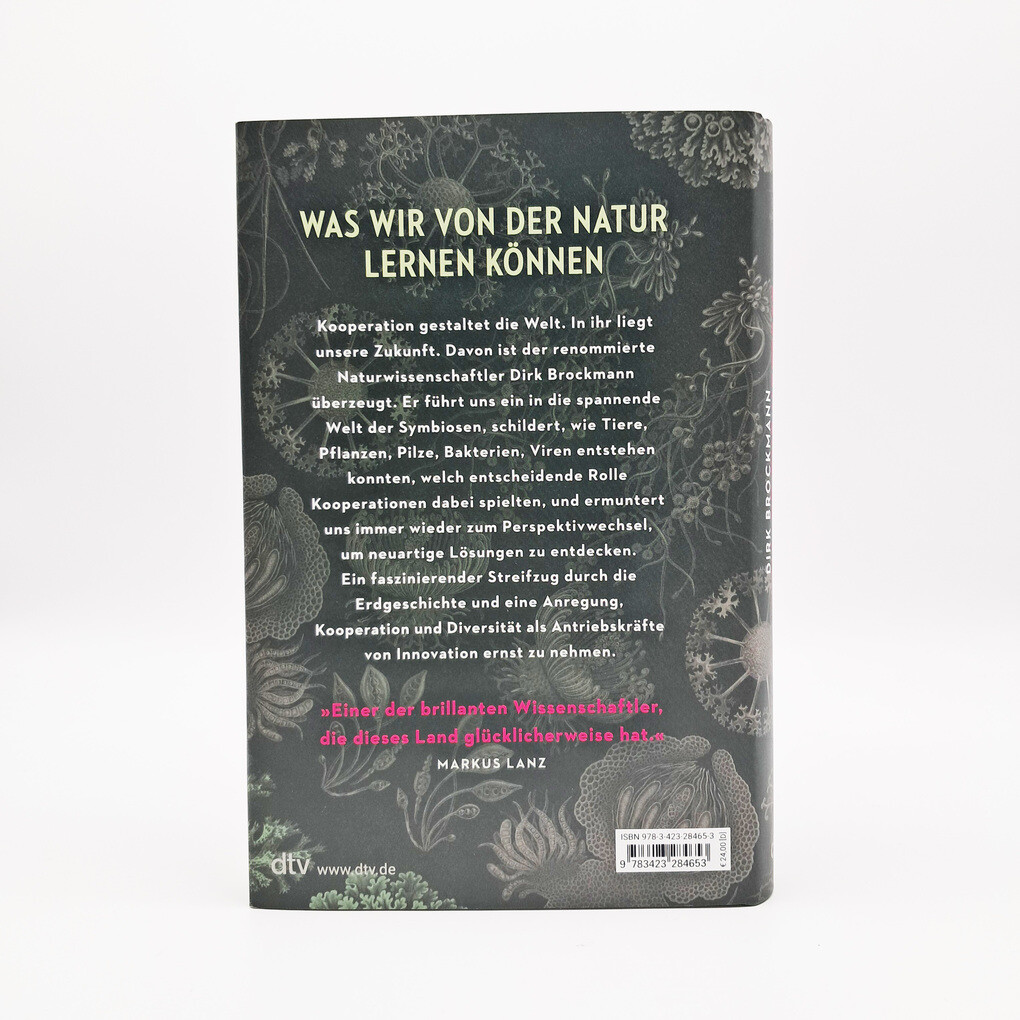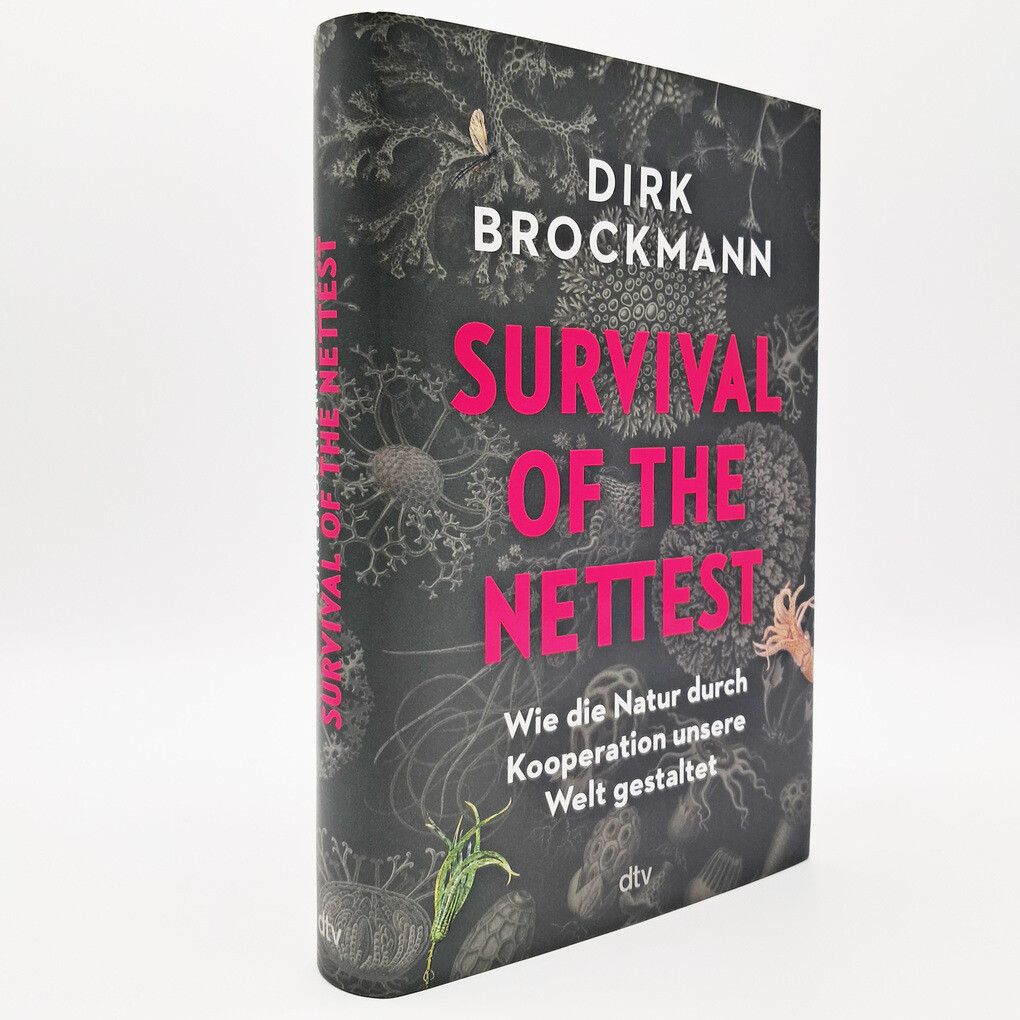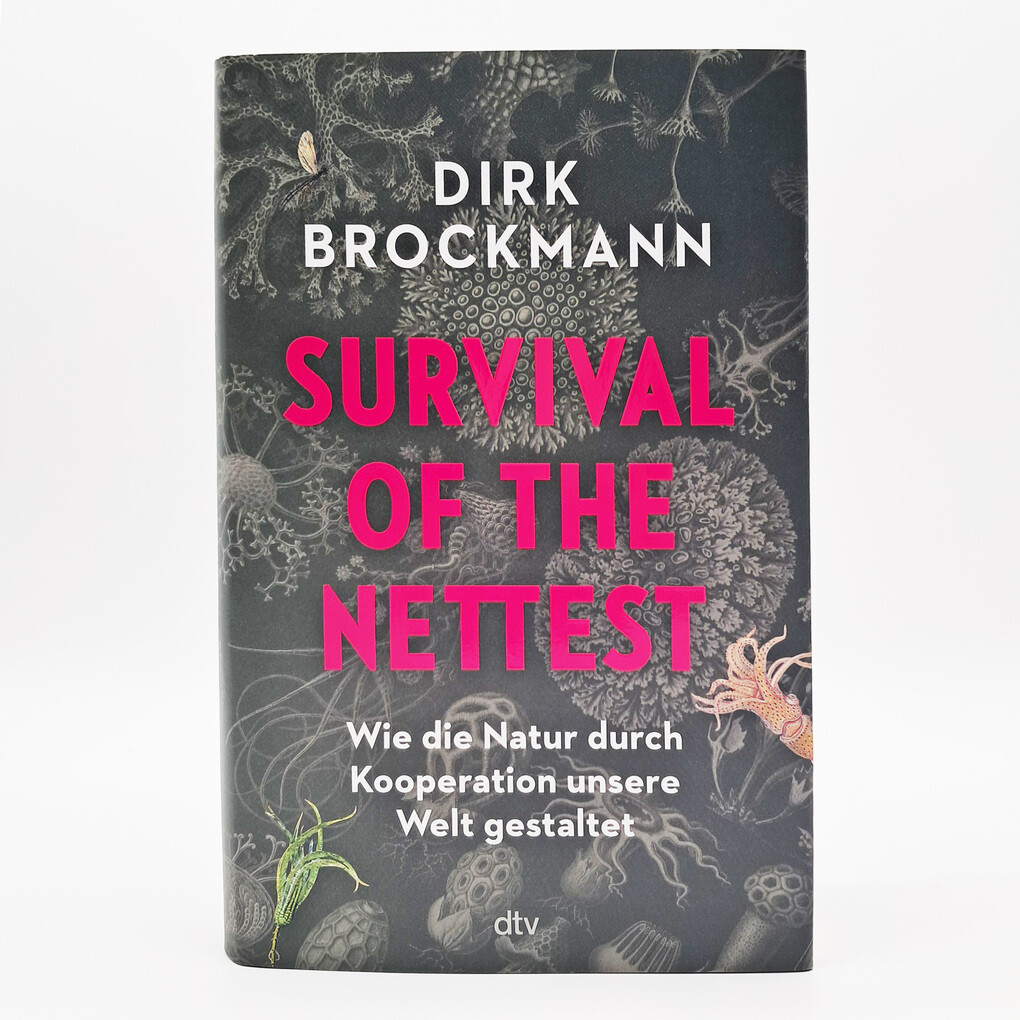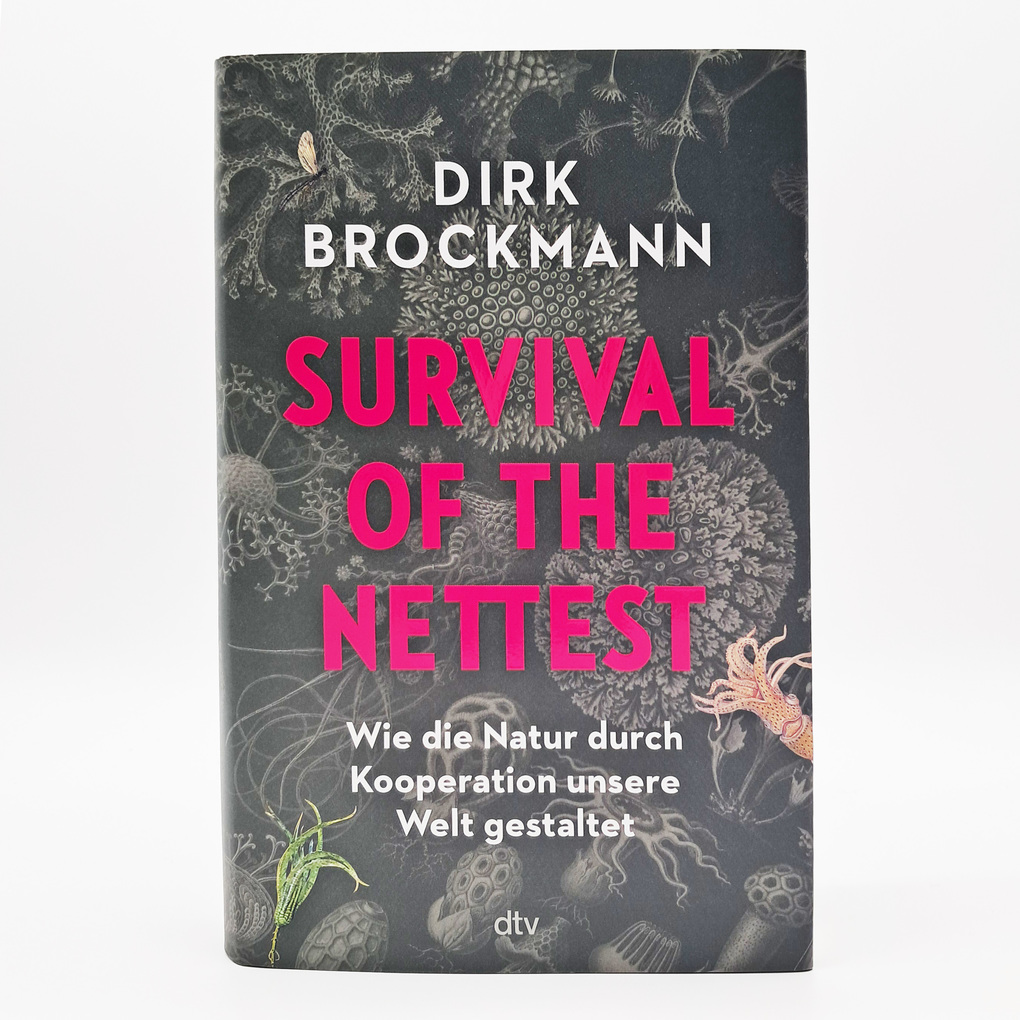Besprechung vom 01.08.2025
Besprechung vom 01.08.2025
Wo wir doch selbst aus Netzwerken bestehen
Vom Vorteil der Symbiosen: Dirk Brockmann macht mit Formen der Kooperation quer durch die Evolutionsgeschichte bekannt
Dass in der Evolution immer der Stärkste, Größte und Schnellste gewinnt, gehört zu den verbreiteten Irrtümern über das Leben auf der Erde. Charles Darwin hat vor dieser Interpretation seiner Lehren gewarnt. Allerdings hat er die von Herbert Spencer erdachte Formel vom "Survival of the Fittest" in eine spätere Ausgabe seines Standardwerks aufgenommen - und damit sozialdarwinistischen Inanspruchnahmen aller Grade den Weg gebahnt.
Dass diese Fitness in evolutionärem Sinn nicht mit Muskelkraft und körperlicher Ausdauer und auch nicht mit Intelligenz gleichzusetzen ist, sondern für die gelungene Anpassung an die jeweiligen Lebensverhältnisse steht, ging seitdem gerne immer wieder einmal unter. Dann wurden Egoismus, Konkurrenz, die Unterdrückung oder gar Ausmerzung Schwächerer als die wichtigsten Triebkräfte der Evolution hingestellt, die auch in der menschlichen Natur angelegt seien.
Mit seinem Buch "Survival of the Nettest" legt Dirk Brockmann, Physiker, Mathematiker, forschender Biologe und Gründungsdirektor des Zentrums "Synergy of Systems" an der Technischen Universität Dresden, einen originellen Gegenentwurf zur Doktrin vom allgegenwärtigen evolutionären Konkurrenzkampf vor. Er macht das nicht in Form einer Attacke oder Abrechnung, sondern als lebendig erzählte Darstellung, wie sehr das Leben auf der Erde von Kooperation geprägt ist - von den Genen über die Entstehung neuer Lebensformen bis hin zu ganzen Ökosystemen.
Dabei zitiert der Autor wiederkehrend einen Leitsatz der 2011 verstorbenen Evolutions- und Mikrobiologin Lynn Margulis: "Das Leben eroberte den Erdball nicht durch Kampf, sondern durch Netzwerken." Zu Margulis' Verdiensten zählte es, der sogenannten "Endosymbiontenhypothese" zum Durchbruch verholfen zu haben: Die Zellen, aus denen nicht nur unsere, sondern die Körper aller Vielzeller bestehen, sind das Ergebnis einer Verschmelzung mindestens von zwei, möglicherweise auch drei grundverschiedenen, aber sich ergänzenden Einzellern vor 2,2 Milliarden Jahren, erklärt Brockmann. Nicht Wettkampf, sondern Symbiose habe also schon ganz am Anfang auch unserer eigenen Evolution gestanden. Auch weitere Schlüsselereignisse des Lebens seien in Symbiosen erfolgt, etwa der Landgang der Pflanzen - als Flechten im Zusammenspiel mit Pilzen.
Brockmann zeigt an einem eher bekannten Beispiel, wie prägend das Grundprinzip Kooperation ist: dem Mikrobiom im menschlichen Darm und auf unseren Schleimhäuten. Die Tausenden Arten von Bakterien und Archaeen, mit denen wir unsere Körper teilen, brächten es zusammen auf Millionen Gene, die als Bauanleitungen für Proteine funktionierten. Das menschliche Erbgut werde dagegen nur auf etwa 23.000 Gene geschätzt. "Genetisch und damit biochemisch sind wir also deutlich mehr Bakterie als Mensch", spitzt Brockmann zu und zitiert ein Team von Evolutionsbiologen mit dem Satz: "Wir sind noch nie Individuen gewesen." Tatsächlich seien fast alle Lebewesen "Holobionten", also Gemeinschaften verschiedener Spezies.
Es folgt eine so wilde wie faszinierende Reise über den ganzen Globus: zu einer Meerschnecke, die Photosynthese betreibt, nachdem ihr ein Retrovirus zur nötigen genetischen Ausstattung verholfen hat, zu Froschembryonen, die sich mit einzelligen Algen verbünden, Zwergtintenfischen, die sich im Zusammenspiel mit Bakterien unsichtbar gegenüber Fraßfeinden machen. Wie genau diese Bakterien es schaffen, zum Teil des Tintenfischkörpers zu werden, ist höchst staunenswert. Das gilt auch für andere Beispiele, wie etwa das aus fünf verschiedenen Mikroorganismen zusammengesetzte birnenförmige Gebilde, das australische Darwin-Termiten erst in die Lage versetzt, Zellulose zu verdauen.
Dass dies keine bloßen Eskapaden der Natur sind, veranschaulicht eine Gruppe von Bakterien, die in den meisten Insekten leben und deren Fortpflanzung beeinflussen, wie Brockmann berichtet. So könnten Männchen, die mit Wolbachien infiziert seien, sich nur mit ebenfalls infizierten Weibchen fortpflanzen. Weibchen wiederum könnten von den Bakterien zur Parthenogenese, also der Fortpflanzung ohne Männchen, gebracht werden. Damit nicht genug, bestehe der Gesamteffekt der Wolbachien darin, neue Untergruppen zu schaffen, die sich nicht miteinander fortpflanzen können: "Jede Population geht nun ihren eigenen evolutionären Weg und verändert sich genetisch so stark, dass sich zwei neue Arten herausbilden." Da sei es plausibel anzunehmen, dass diese Bakterien Anteil am enormen Artenreichtum der Insektenwelt haben.
Das Buch bietet eine gelungene Mischung aus verständlich dargestellten Einsichten der modernen Biologie, Anekdotischem aus dem Naturreich und neuen Perspektiven auf unsere eigene Evolution. Wünschenswert wäre gewesen, dass der Autor stärker zwischen gesichertem Wissen und neuen Thesen, etwa zur Entstehung der ersten Eukaryotenzellen, unterschieden hätte. Dass der Verlag dabei mitgespielt hat, das Buch mit Brockmanns eigenen Zeichnungen zu illustrieren, mutet zunächst merkwürdig an, weil der Autor wirklich kein Künstler ist. Bild um Bild kann der Leser dem Gekritzelten dann aber immer mehr eigenwilligen Witz abgewinnen.
Gegen Ende des Buchs verzettelt sich der Autor ein bisschen und erliegt leider der Versuchung, einen Dialog mit ChatGPT einzubauen. Und nachdem Brockmann auf weiten Strecken darauf verzichtet hat, den Sozialdarwinismus zu geißeln, fällt sein Plädoyer für Kooperation beim Kampf gegen den Klimawandel dann umso flammender aus. Doch beides stört nicht weiter: Das Buch bietet für jeden, der sein Bild vom Leben auf der Erde auffrischen will, anregenden Stoff in Fülle. CHRISTIAN SCHWÄGERL
Dirk Brockmann: "Survival of the Nettest". Wie die Natur durch Kooperation unsere Welt gestaltet.
dtv Verlag, München 2025. 288 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.