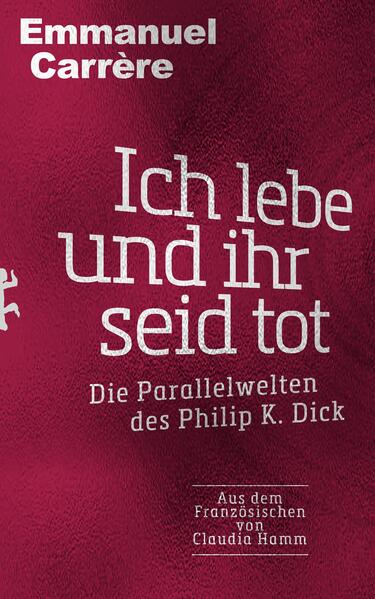
Zustellung: Mo, 04.08. - Mi, 06.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Philip K. Dick (1928-1982) gehört zu den einflussreichsten US-amerikanischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Romane und Kurzgeschichten wurden nicht nur vielfach verfilmt - Blade Runner, Total Recall und Minority Report waren internationale Kinoerfolge -, sondern dienten unzähligen anderen Autoren, darunter Emmanuel Carrère, als Inspirationsquelle. Zeit seines Lebens trieb Dick die Frage um, welche inneren und äußeren Mächte unser Denken, Fühlen und Handeln lenken. In den phantastischsten Szenarien malte er aus, welche verheerenden Auswirkungen es hat, wenn ein Mensch sich dessen, was er glaubt, sieht oder weiß, nicht mehr sicher sein kann, ja wenn er sich fragen muss, ob er überhaupt ein Mensch ist. Seine 1977 in einer legendären Rede geäußerte Mutmaßung, wir lebten in der Simulation einer Künstlichen Intelligenz, lässt sich in ihrer prophetischen Kraft erst heute wirklich ermessen. Doch waren seine mystischen Visionen und seine Überzeugung, von FBI und KGB beschattet zu werden, nur auf drogeninduzierte Psychosen zurückzuführen, oder »erinnerte« er sich wirklich an eine parallele Gegenwart, die anderen verborgen war?
Emmanuel Carrère erzählt Dicks Leben vom Plattenverkäufer bis zum selbsternannten Messias in einem Amerika, das schon vor Jahrzehnten von Paranoia und Spaltung geprägt war, als leichtfüßigen, hypnotischen Roman. Er legt dabei erstaunliche Lesarten für die Gegenwart und die aktuelle Rolle von Technik und Macht frei und wirft existenzielle Fragen auf, die bis zu den Wurzeln der westlichen Zivilisation reichen.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. Februar 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Die Parallelwelten des Philip K. Dick.
Originaltitel: Je suis vivant et vous êtes morts.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
364
Autor/Autorin
Emmanuel Carrère
Übersetzung
Claudia Hamm
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
französisch
Produktart
gebunden
Gewicht
580 g
Größe (L/B/H)
218/139/40 mm
ISBN
9783957578815
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 12.06.2025
Besprechung vom 12.06.2025
Dazu verurteilt, Science-Fiction zu leben
Erinnerungen an ein anderes Jetzt: Emmanuel Carrères biographischer Versuch über Philip K. Dick
Auch wenn es wohl keinen Satz gibt, der sich in Bezug auf die Autorschaft Philip Kindred Dick formulieren lässt und wahrer wäre als sein nachgerades Gegenteil, so kann dieser eine doch für einen Moment stehen bleiben: In dem 1928 in Chicago geborenen, 1982 in Kalifornien gestorbenen Schriftsteller stößt das zwanzigste Jahrhundert auf den beunruhigenden Gedanken, dass es vielleicht nur eine Simulation ist. Literarischen Ausdruck findet dieser Gedanke erstmals in Dicks 1962 erschienenem Roman "The Man in the High Castle" (deutsch "Das Orakel vom Berge"), der in einem nach dem Zweiten Weltkrieg von den siegreichen Japanern und Deutschen besetzten Amerika spielt. So aber, wie in der erzählten Welt ein Mensch existiert, der anderes weiß, der Schriftsteller Hawthorne Abendsen, in dessen Roman "The grasshopper lies heavy" die faschistische Allianz den Krieg verloren hat, so wurde auch Philip K. Dick in Leben und Werk stets von der Überzeugung getragen, eine scheinhafte Wirklichkeit zu bewohnen - oder gleich mehrere davon.
Dick war nicht einfach nur ein Science-Fiction-Autor. Er war vielmehr dazu verurteilt, Science-Fiction zu leben. Und so lässt sich vielleicht noch dieses eine konstatieren: dass die 44 Romane, 120 Erzählungen und Abertausenden Seiten von Selbstprotokollen, die Dick hinterlassen hat, womöglich von ihm geschrieben wurden, aber dass im gleichen Maße diese Literatur auch ihren Autor verfasst und über die Jahre in höchst seltsame Szenarien manövriert hat.
Lässt sich solch eine Existenz bündig, gleichsam als "Vita" erzählen? Daran gewagt haben sich zumindest einige, unter ihnen Emmanuel Carrère, dessen Versuch über Philip K. Dicks "Parallelwelten" nach mehr als drei Jahrzehnten nun leicht gekürzt in einer Übersetzung von Claudia Hamm unter dem Titel "Ich lebe und ihr seid tot" erschienen ist.
Was für ein Buch man da vor sich und, vor allem, was für ein Buch man da nicht vor sich hat, zeigt der Vergleich mit Lawrence Sutins nur unwesentlich älterer Dick-Biographie "Divine Invasions". Diese fungiert als Quellensammlung, zitiert Gedrucktes wie Ungedrucktes, bemüht sich nicht zuletzt auch um genregeschichtliche Kontextualisierung und erweist ihrem Gegenstand Respekt in der Chronistenpflicht. Carrères Buch - das auf Sutins Darstellung zurückgreift - kommt hingegen gänzlich ohne Nachweise aus, überblendet zunehmend äußere Lebensumstände und Romanhandlungen, sucht ihren Wert nicht in der Information, sondern im Erzählen. Ein "Roman" will dieser Text gleichwohl nicht sein, eine Biographie ist er aber dann entgegen eigenem Bekunden auch nicht. Vielmehr nähert er sich zügig einer Darstellungsform an, die man in Frankreich und Skandinavien mittlerweile "Exofiktion" nennt und eine imaginative Ausgestaltung von Persönlichkeiten bezeichnet, bei der die Grenze zwischen Belegbarem und Erdichtetem gezielt überschritten werden.
Nun trifft es sicherlich zu, dass ein solches Erzählverfahren mit Blick auf einen Autor, dem sich die Wirklichkeitsebenen prinzipiell vermischen, Plausibilität beanspruchen kann. Neben der schlingernden Schriftstellerkarriere, die Philip K. Dick von einem Schallplattenladen auf dem Campus von Berkeley über erste Erzählungen in Magazinen des "Golden Age" der Science-Fiction bis hin zum Hugo Award 1963, von der prekären literarischen Leidenschaft bis hin zum Blockbusterautor führt, zielt Carrères Darstellung von Beginn an auf die Spaltung ab, die Dicks Leben durchzieht. Sie beginnt mit dem Grabstein, den er 53 Jahre lang mit seiner nach vier Wochen verstorbenen Zwillingsschwester teilt und der ihn der fortdauernden Spekulation aussetzt, dass in einer anderen Welt er der Tote und die Schwester die Überlebende sei, ja: dass er einer Totenwelt angehöre, die ihrer Erlösung harrt.
Faszinierend bleibt dieser Gnostizismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zweifellos. Nicht allein, dass Dick ihn immer und immer wieder zum Ausgangspunkt seiner Romane - prominent natürlich im 1969 erschienenen "Ubik" - werden lässt: Seine Selbstwahrnehmung untersteht von Grund auf dem Schisma von göttlicher Wahl und verworfener Schöpfung. Wann bekommt man es schon einmal mit jemandem zu tun, der sich für einen versteckten Frühchristen hält, den die römische Herrschaft mit der Massenillusion eines zukünftigen Jahrhunderts umgeben hat, um die Herabkunft des Messias aufzuhalten? Mit einem Menschen, der sämtliche Ereignisse, die ihm begegnen, in diese Erzählung einzupassen vermag, der die Sowjetunion mit dem Römischen Reich identifiziert und in seinen Bewunderern geheime Verfolger erkennt, die er alle dem FBI melden muss? Wer kommt schon auf den Gedanken, dass sich hinter Stanislaw Lem, der Dick als Visionär rühmte, ein kommunistisches Komitee verbirgt?
Im Zweifel natürlich jemand, der wahnsinnig viel Speed konsumiert, dem darüber alles zum Zeichen wird - und der dementsprechend dort denkt, wo andere fühlen. Dick, das bringt Carrère gut auf den Punkt, verwaltet sich wie eine Maschine. Zwar fällt er von Affekt zu Affekt, von Gedankenstrom zu Gedankenstrom und ja: auch von einer Ehe in die nächste (derer fünf sind es insgesamt), doch schreibt er diesen Taumel immer zugleich einer höheren Kontrollinstanz zu, die viele Namen hat: Ubik, Valis, Gott, "the real universe". Einer Macht, die sich durch den Autor und seine kosmische Schreibmaschine mitteilt, aber deren Botschaft sich in dieser bloßen Mitteilsamkeit auch bereits erschöpft.
Die zahllosen Wendungen und sich mit jedem Orakelspruch des "I Ging" wandelnden Selbstdeutungen Dicks sind sicherlich ein betörender, wenn auch auf Dauer etwas zermürbender Stoff. Warum aber muss man ihn noch einmal erzählen? Carrères Antwort auf diese Frage fällt kryptisch aus: Zurückhaltung solle sein Buch gebieten, den Lesern die "geistige Disziplin" auferlegen, das Spiel zwischen Wahn und Wahrheit nicht vorschnell mit einem Urteil zu unterbinden, sondern sich als Prozess entfalten zu lassen. Das schließt das Übergreifen dieses Spiels auf den Erzähler ein: "Keine Mutmaßungen" will dieser anstellen, keine Zeile hinzutun, die nicht dasteht. Aber es steht halt vieles da, und fließend sind die Übergänge zwischen Roman und Dokument, fließend auch die Übergänge zwischen der Welt Dicks und der Carrères. Just über jenem Kapitel, das den folgenschweren Einbruch in Dicks Haus in San Rafael im November 1971 zum Inhalt hat, wird auch der Erzähler zu einem Einbruchsopfer: Koinzidenzen verbinden die Paralleluniversen.
Das derart deutlich zutage tretende Begehren Carrères, sich selbst in dieses Leben einzuschreiben, von einem jugendlichen Apologeten Dicks zu einem seiner Geschöpfe zu mutieren, ist nicht zu unterschätzen, vollzieht sich mit "Ich lebe und ihr seid tot" doch auch Carrères Hinwendung zum "Tatsachenroman", deren erste Frucht dann der im gleichen Jahr begonnene "Der Widersacher" sein wird. Was von dort an Literatur werden wird und sich französisch "Non-fiction" nennt, verdankt Philip K. Dick tatsächlich viel, nämlich zuallererst die Einsicht, dass nichts phantastischer ist als das, von dem man mit großer Gewissheit behauptet, es sei keine Erfindung. Tatsachen können sehr fremd und aufregend sein, es kommt nur drauf an, welcher Welt sie entnommen sind. In dieser Hinsicht ist Dick, der in seiner berühmten 1977 in Metz gehaltenen Rede davon sprach, sich "an ein anderes jetziges Leben zu erinnern", einer der großen Lehrmeister des postmodernen Erzählens geblieben.
Nicht alles an diesem Buch ist groß und gelungen. Spürbare Längen hat es immer noch, und der latent mitleidige, wo nicht degoutante Blick auf die literarische Kultur der Science-Fiction, aus der Dick als Solitär herausgehoben wird, mag so manchen vor den Kopf stoßen. Wer aber wissen will, wie man über der Betrachtung eines ebenso wunderbaren wie wirren Geistes zu sich selbst, zum eigenen Wort findet, der mag der von Carrère aufgenommenen Spur folgen. In welcher Welt diese endet: Diese Frage beantwortet ein anderer. PHILIPP THEISOHN
Emmanuel Carrère:
"Ich lebe und ihr seid tot". Die Parallelwelten des Philip K. Dick.
Aus dem Französischen von Claudia Hamm. Matthes & Seitz,
Berlin 2025. 364 S.,
geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 04.06.2025
Ich glaube nicht das die Intension des Autors war mir zu erklären warum ich Dick nicht mag, hat er aber geschafft. Und dafür sage ich Danke!
am 27.02.2025
Ein Kultautor
Philip K. Dick war lange Zeit ein überaus wichtiger Science-Fiction-Autor und mehr. Seine Ideen und Theorien vermochten zu faszinieren.
Uwe Anton hat mal eine großartige Biografie über ihn geschrieben, aber da stand in erster Linie das Werk im Vordergrund. Emmanuel Carrere hat in diesem im Original schon 1993 erschienen Buch einen anderen Ansatz. Er verquickt Dicks Leben mit seinem Werk und findet eine Form dafür, die funktioniert.
Über seine Romane hinaus tritt Dick hier als agierende Person, als Mensch auf. Man erlebt ihn mit seinen Stärken und Schwächen.
Ein verdienstvolles Buch. Man kann froh sein, dass es jetzt in Deutsch vorliegt, denn Philip K.Dick ist immer noch ein Schriftsteller von Relevanz und einige Bücher von ihm sind unvergessen:
Das Orakel vom Berge, Do Android dream of electric sheep bekannt als Bladerunner, Ubik, Valis und A Scanner darkly.









