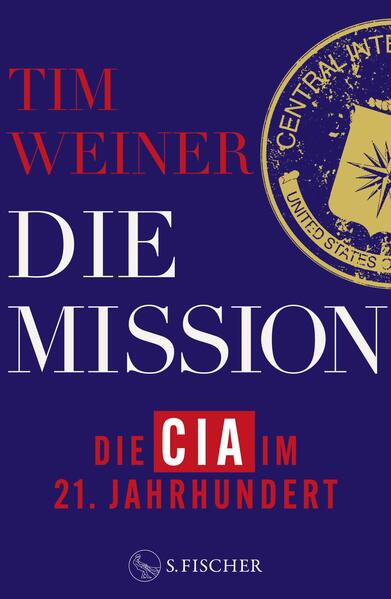
Mitreißend und fast thrillerhaft erzählt Tim Weiner von den Machenschaften der CIA im 21. Jahrhundert.
Der 11. September 2001 veränderte die CIA grundlegend. Aus dem Geheimdienst, der seine Kernaufgaben - Spionage und Spionageabwehr - nach dem Kalten Krieg so gut wie aufgegeben hatte, wurde eine Organisation, die Foltergefängnisse baute und tödliche Drohnenangriffe durchführte. Die Folgen waren gravierend: Chinesische Spione stahlen Akten, amerikanische Hacker verschafften sich Zugang zu sensiblen Daten und zahllose Menschen starben in Afghanistan und im Irak. Heute sieht sich die CIA vor neue, enorme Herausforderungen gestellt: von den Konflikten mit Russland, dem Iran und China bis hin zur Auseinandersetzung mit Trump, der den Geheimdienst als subversive Kraft bezeichnet.
Ein schonungsloser Blick auf einen der mächtigsten Nachrichtendienste der Welt in einem Vierteljahrhundert voller Krisen, Kriege und globaler Machtverschiebungen - von einem der intimsten Kenner des amerikanischen Geheimdienstsystems.
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Was für ein Buch! Man liest es in einem Zug. Ein Knüller Tim Weiner zerlegt die CIA. Alfons Pieper, Blog der Republik
 Besprechung vom 22.07.2025
Besprechung vom 22.07.2025
Spionieren, damit der Präsident recht hat
Eine spannend zu lesende Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes im 21. Jahrhundert
"Wir müssen fähig sein, uns höchst unmoralisch zu verhalten, und uns dabei von den höchsten moralischen Grundsätzen leiten lassen." Mit diesem Motto machte der langjährige Ausbildungsleiter des amerikanischen Geheimdienstes seine Schützlinge von Anfang an vertraut. Was dabei herauskommen kann, schildert dieses Buch sehr eindrucksvoll.
Der Titel ist durchaus doppelsinnig. Einerseits erzählt der Autor, was die CIA - außer der naheliegenden Spionagetätigkeit - noch so alles tat. Dabei kann er auf frühere Arbeiten zur Geschichte des Dienstes seit dem Ende des Kalten Krieges zurückgreifen. Hier schreibt also kein "Grünschnabel". Aber der Autor hat eben auch seine ganz eigene Mission. Er lehnt vieles von dem, was er schildert, leidenschaftlich ab. Und trotzdem - das mag den einen oder anderen deutschen Leser enttäuschen - gerät das Buch nicht zur Abrechnung mit der Institution Geheimdienst an sich.
Vielmehr erinnert er seine Leser und nicht zuletzt auch seine Protagonisten daran, was Geheimdienste eigentlich sein sollten: Instrumente zur Aufklärung, um Unheil vom eigenen Land abzuhalten, dessen Feinde zu schwächen. Dass die Methoden der Beschaffung von Informationen dabei in der Regel juristisch nicht "sauber" sein können, setzt er voraus - und akzeptiert es.
Der Autor hat sorgfältig recherchiert. Er hat mit sehr vielen aktiven und ehemaligen CIA-Leuten gesprochen und viele Dokumente gesehen. Und obwohl er aus naheliegenden Gründen nicht alles in den zahlreichen Fußnoten (insgesamt 46 Seiten) exakt belegen kann, darf man ihm wohl glauben, dass er mit großer Sorgfalt an seine "Mission" herangegangen ist. Herausgekommen ist ein spannend zu lesendes Buch, guter Journalismus also.
Irritierend sind allerdings die vielen wörtlichen Zitate von Präsidenten, Ministern und anderen, garniert mit der Schilderung von Empfindungen der Protagonisten. Bei aller Sorgfalt; der Autor war nicht dabei. Und er hat im Dienst der Spannung ohne Not den Pfad der sachlichen Tugend wiederholt verlassen. Das wäre angesichts der geschilderten Ereignisse gar nicht nötig gewesen, wird aber (vom Verlag?) als Instrument der Vermarktung offenbar für unverzichtbar gehalten.
In der Sache ist ein Buch herausgekommen, das logischerweise aus der Rückschau ziemlich genau zu wissen vorgibt, wann welche Fehler gemacht wurden und wer sie gemacht hat. Man kennt dieses Phänomen von nahezu allen Terroranschlägen der vergangenen Jahre. Nach der jeweiligen Tat erfährt die erstaunte Öffentlichkeit mit beeindruckender Geschwindigkeit viel über die jeweiligen Täter. Das Wissen ist also offensichtlich vorhanden. Dass es aber im wirklichen Geheimdienstleben sehr schwer ist, eins und eins zusammenzuzählen, bevor etwas passiert, ist mittlerweile den meisten klar. Wer anderes behauptet, ist entweder größenwahnsinnig oder dumm - wobei das eine das andere bekanntlich nicht ausschließt.
Das Wissen der CIA über die Terrororganisation Al-Qaida vor den Attentaten vom 11. September 2001 war nach Angaben des Autors sehr überschaubar. Das lag zum einen daran, dass die CIA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem damit einhergehenden Verlust ihres wichtigsten Gegners ein wenig die Orientierung verloren hatte. Zum anderen führt er das aber auch darauf zurück, dass die Regierung von Präsident George W. Bush andere Prioritäten setzte. Der Sohn wollte unbedingt das zu Ende bringen, was sein Vater George H. W. Bush 1991 im Irak aus seiner Sicht nicht geschafft hatte, das Regime Saddam Husseins stürzen.
Das Verhältnis zwischen der Regierung und ihrem Geheimdienst in der Zeit zwischen dem 11. September und dem Einmarsch in den Irak kennzeichnet exemplarisch die Problematik, die sich richtigerweise wie ein roter Faden durch das ganze umfangreiche Buch zieht. Geheimdienste erledigen Aufträge ihrer Regierung. Sie gelangen dabei zu bestimmten Schlussfolgerungen. Diese können, müssen aber nicht mit der Auffassung der Regierung übereinstimmen. Und wenn sich innerhalb einer Regierung erst einmal Misstrauen gegen die Geheimdienste festgesetzt hat, haben die Agenten keine Einflussmöglichkeiten mehr. Daher setzt sich allmählich eine Haltung durch, der Regierung das zu sagen, was diese hören will. Dann werden "halb gare" oder gar falsche Informationen weitergegeben, obwohl die Analytiker in den Reihen der Dienste zuweilen heftig vor einem solchen Vorgehen warnen. Nur so, heißt es oft zur Entschuldigung, könne man zu den Regierenden durchdringen - auch mit zutreffenden Informationen und/oder Prognosen.
Im Zusammenhang mit der Vorbereitung des Krieges gegen den Irak Saddam Husseins tritt uns die CIA hier beinahe als Opfer von Teilen der Regierung (Vizepräsident Cheney und Verteidigungsminister Rumsfeld) gegenüber. Vor allem diese beiden waren wild entschlossen, dem Regime in Bagdad den Garaus zu machen. Als Begründung musste herhalten, der Irak besitze Massenvernichtungswaffen. Es bestehe die Gefahr, dass diese in die Hände von Terroristen gelangen könnten. Diese Haltung fand, wie der Autor detailliert herausstreicht, sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Regierung durchaus Widerhall. Die Unsicherheit, ja Angst nach dem 11. September war weit verbreitet. Viele trauten Al-Qaida noch weitaus schlimmere Anschläge zu.
So reihte sich ein Unheil an das andere. Die CIA fand keine belastbaren Erkenntnisse über Massenvernichtungswaffen. Der Kampf gegen den Terrorismus machte auch nicht die Fortschritte, die Präsident Bush gerne gesehen hätte. Heraus kam "Erkenntnisgewinn" auf Biegen und Brechen. Am 1. August 2002 genehmigte der Präsident "harte" Vernehmungsmethoden. Dass diese Methoden, die der Autor deutlich beschreibt, nicht den Tatbestand der Folter erfüllt haben sollen, wie die Regierung öffentlich behauptete, leuchtete schon vor zwanzig Jahren niemandem ein.
Die Folterverhöre brachten, auch das wird deutlich, wenig verwertbare Erkenntnisse. Amerika musste aber feststellen, dass sich in den Reihen des Dienstes genügend Menschen fanden, die aus Überzeugung solche Methoden anwandten. Diese wurden zwar gerne einmal als "unamerikanisch" bezeichnet. Politisch aufgearbeitet wurden die Praktiken erst unter Präsident Obama. Dieser versprach im Mai 2013, so etwas werde nie mehr passieren. Verbindlich versprechen konnte er das aber natürlich nur für seine Regierung. In diesem Zusammenhang fließt dem Autor eine bemerkenswerte Würdigung der CIA aus der Feder. Viele hatten den Dienst mit einem blindwütigen Elefanten verglichen, der alles niedertrampele, was sich ihm in den Weg stelle. "Die CIA war, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht blindwütig. Wenn Menschen niedergetrampelt wurden, war das nicht die Schuld des Elefanten. Es war die Schuld des Mahout, des Elefantenführers. Und der Elefantenführer war der Präsident der Vereinigten Staaten."
Am Ende taucht dann der Name auf, der die Gegenwart und nähere Zukunft Amerikas und seines Geheimdienstes prägen wird, Donald Trump. Im Zusammenhang mit dessen erster Wahl 2016 nimmt der Autor gründlich den für viele im Westen geradezu mit einem Heiligenschein versehenen Julian Assange auseinander. Dieser habe sich gerne in den Dienst der Wahlbeeinflussung durch Putins Russland gestellt. Allerdings seien die amerikanischen Behörden auch zu lange zu naiv gewesen. Ähnliches konstatiert er im Umgang mit China.
Ein zu allem entschlossener Präsident kann, das zeigt dieses Buch eindrucksvoll, eine Menge Schaden anrichten. Während man aber in der Vergangenheit, auch das wird gezeigt, sicher sein konnte, dass das Pendel zurückschlägt, dass Missstände aufgedeckt werden, ist dies für die nächsten Jahre nicht mehr sicher. Und so legt man das Buch einigermaßen beklommen aus der Hand. Und man fühlt mit den Geheimdienstleuten, die sich moralischen Grundsätzen verpflichtet fühlen sollen, die es aber mit einem Oberbefehlshaber zu tun haben, in dessen Wortschatz diese Vokabel offenbar nicht vorkommt. PETER STURM
Tim Weiner: Die Mission. Die CIA im 21. Jahrhundert.
S. Fischer Verlag, Frankfurt 2025. 608 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








