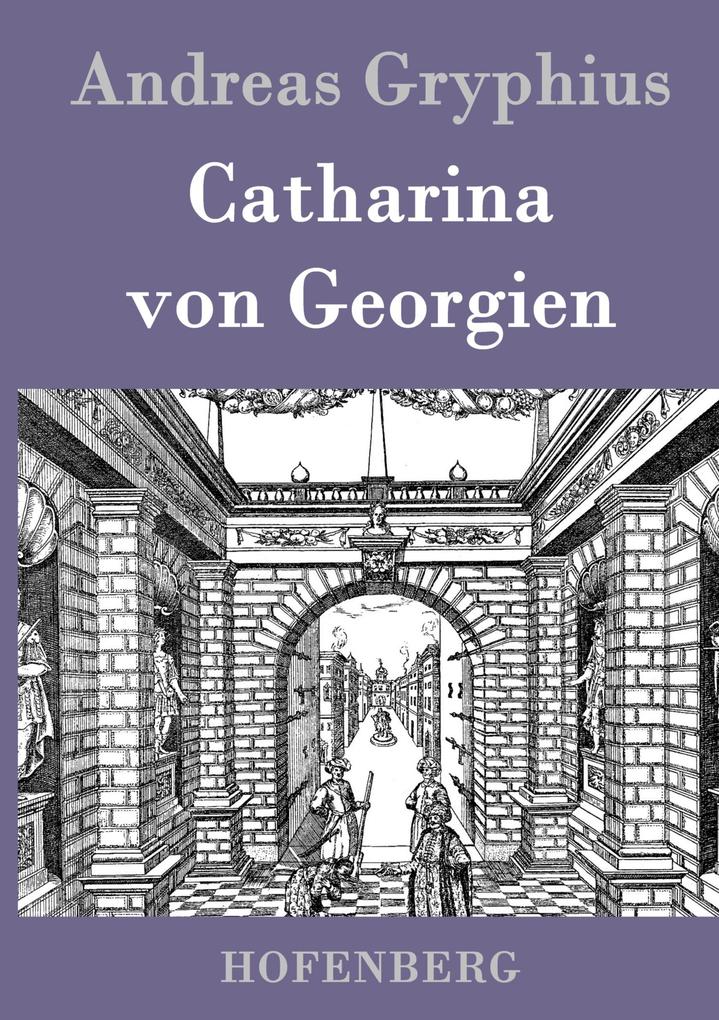
Zustellung: Mi, 13.08. - Sa, 16.08.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Andreas Gryphius: Catharina von Georgien
Das Trauerspiel erzä hlt den letzten Tag im Leben der Kö nigin von Georgien, die 1624 nach Jahren in der Gefangenschaft des persischen Schah Abbas gefoltert und schließ lich verbrannt wird, da sie seine Liebe, das Eheangebot und damit die Krone Persiens aus Treue zu ihrem ermordeten Mann ausschlä gt. Gryphius sieht in seiner Tragö die kein Geschichtsdrama, sondern ein Lehrstü ck » unaussprechlicher Bestä ndigkeit« .
Entstanden 1647. Erstdruck in » Andreas Gryphius: Deutscher Gedichte Erster Theil« , zweiter Band, Breslau (Lischke), 1657. Urauffü hrung 1651, Kö ln durch die Truppe des Joris Jollifous.
Vollstä ndige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016, 2. Auflage.
Textgrundlage ist die Ausgabe:
Andreas Gryphius: Catharina von Georgien. Herausgegeben von Alois M. Haas, Stuttgart: Philipp Reclam jun. , 1975 [Universal-Bibliothek Nr. 9751].
Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgefü hrt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Katharina von Georgien, Stich von Joh. Using um 1700.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Ü ber den Autor:
1616 wird Andreas Gryphius in die Wirren des Dreiß igjä hrigen Krieges in Glogau in Schlesien hineingeboren. Wä hrend seines Studiums lernt er die liberale, florierende Handelsstadt Danzig und das empirische Weltbild Galileis und Keplers kennen. 1637 nimmt er sechs Jahre wä hrende Studien an der damals hochmodernen Universitä t in Leiden auf und verö ffentlicht fü nf Gedichtsammlungen, die ihm ersten Ruhm einbringen. Gegen Ende des Krieges kehrt er von einer ausgedehnten Studienreise nach Frankreich und Italien nach Schlesien zurü ck. 1664 stirbt Andreas Gryphius wä hrend einer Sitzung der glogauischen Landstä nde, deren Syndikus er seit 14 Jahren ist. Das Leid und der moralische Verfall sind die zentralen Themen seiner Dichtung. Der Schrecken des Krieges und die Vergä nglichkeit allen menschlichen Handels spiegeln sich in dem umfangreichen Werk des bereits zu Lebzeiten gefeierten Autors, der 1662 als » Unsterblicher« in die » Fruchtbringende Gesellschaft« , die grö ß te literarische Gruppe des Barock, aufgenommen wurde.
Das Trauerspiel erzä hlt den letzten Tag im Leben der Kö nigin von Georgien, die 1624 nach Jahren in der Gefangenschaft des persischen Schah Abbas gefoltert und schließ lich verbrannt wird, da sie seine Liebe, das Eheangebot und damit die Krone Persiens aus Treue zu ihrem ermordeten Mann ausschlä gt. Gryphius sieht in seiner Tragö die kein Geschichtsdrama, sondern ein Lehrstü ck » unaussprechlicher Bestä ndigkeit« .
Entstanden 1647. Erstdruck in » Andreas Gryphius: Deutscher Gedichte Erster Theil« , zweiter Band, Breslau (Lischke), 1657. Urauffü hrung 1651, Kö ln durch die Truppe des Joris Jollifous.
Vollstä ndige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016, 2. Auflage.
Textgrundlage ist die Ausgabe:
Andreas Gryphius: Catharina von Georgien. Herausgegeben von Alois M. Haas, Stuttgart: Philipp Reclam jun. , 1975 [Universal-Bibliothek Nr. 9751].
Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgefü hrt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Katharina von Georgien, Stich von Joh. Using um 1700.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Ü ber den Autor:
1616 wird Andreas Gryphius in die Wirren des Dreiß igjä hrigen Krieges in Glogau in Schlesien hineingeboren. Wä hrend seines Studiums lernt er die liberale, florierende Handelsstadt Danzig und das empirische Weltbild Galileis und Keplers kennen. 1637 nimmt er sechs Jahre wä hrende Studien an der damals hochmodernen Universitä t in Leiden auf und verö ffentlicht fü nf Gedichtsammlungen, die ihm ersten Ruhm einbringen. Gegen Ende des Krieges kehrt er von einer ausgedehnten Studienreise nach Frankreich und Italien nach Schlesien zurü ck. 1664 stirbt Andreas Gryphius wä hrend einer Sitzung der glogauischen Landstä nde, deren Syndikus er seit 14 Jahren ist. Das Leid und der moralische Verfall sind die zentralen Themen seiner Dichtung. Der Schrecken des Krieges und die Vergä nglichkeit allen menschlichen Handels spiegeln sich in dem umfangreichen Werk des bereits zu Lebzeiten gefeierten Autors, der 1662 als » Unsterblicher« in die » Fruchtbringende Gesellschaft« , die grö ß te literarische Gruppe des Barock, aufgenommen wurde.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
01. Juli 2013
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
108
Autor/Autorin
Andreas Gryphius
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
332 g
Größe (L/B/H)
226/160/14 mm
ISBN
9783843019859
Entdecken Sie mehr
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Catharina von Georgien" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









