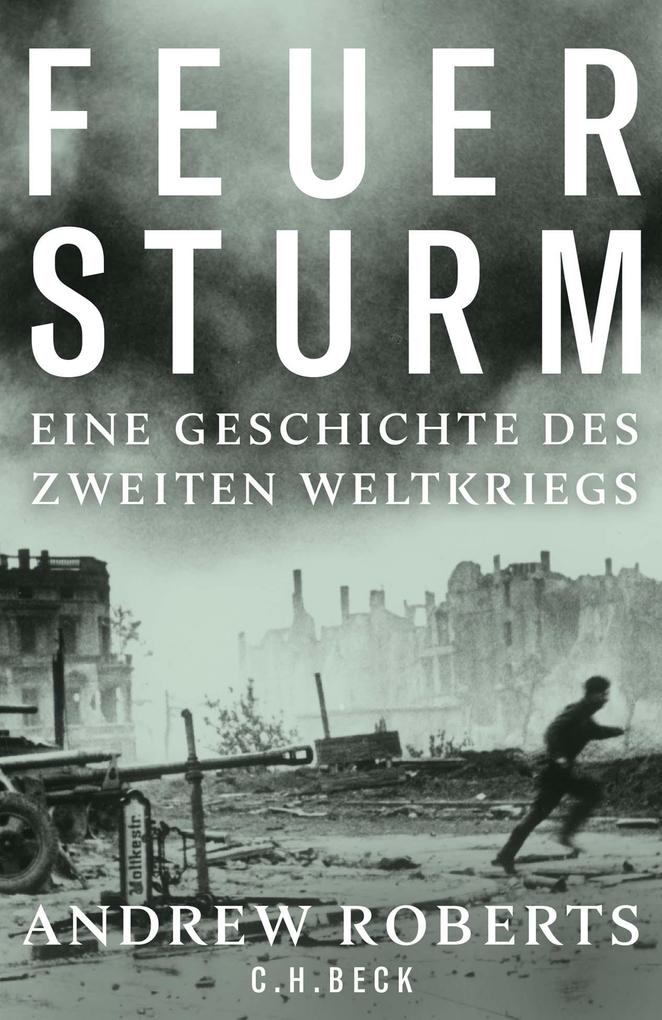Bereits 2009 erschien die englische Version dieses Buches des Historikers Andrew Roberts. Nun endlich die deutsche Ausgabe "Feuersturm", erschienen im Verlag C.H. Beck. Nachdem ich bereits etliche Bücher über diese Zeit lesen durfte, war ich gespannt auf Andrews Werk, um einen anderen Blickwinkel auf das Geschehen zu bekommen. Und was soll ich sagen? Es ist ihm hervorragend gelungen, eine gut zu lesende Zusammenfassung darzustellen.
Andrews gelingt es die großen Zusammenhänge plausibel hervorzuholen und verständlich abzuleiten, die Entwicklung und der Verlauf des Krieges werden ebenso erläutert, wie die getroffenen Entscheidungen - hier geht er sehr ins Detail und erklärt genau wer was ausgelöst hat. Somit ist der Verlauf des Krieges gut nachzuvollziehen, militärische Strategien werden analysiert und Beweggründe dargestellt.
Der Autor bedient sich auch etlicher Zeitzeugenberichte (Tagebücher, ), um das Grauen nachvollziehbar darstellbar zu machen - wenn ihm dies auch sicherlich nur ansatzweise gelingen kann. Etliche Zitate der obersten Führungsriege sind ebenfalls nachzulesen, sowie Befehle und Pläne. Positiv finde ich, dass nicht nur die Gräuel des NS-Regimes ausgeführt wurde, sondern die aller kriegsführenden Nationen (beispielsweise Japan). Hier geht der Autor sehr ins Detail. Natürlich darf auch alles rund um den Holocaust nicht fehlen oder das Grauen des Russlandfeldzuges. Roberts stellt klar, dass hochtitulierte Offiziere sehr wohl wussten, worauf sie sich einließen - auch wenn diese im Nachhinein alles gerne anders darstellten.
Doch Roberts zeigt auch auf, welche Fehlentscheidungen getroffen wurden (nicht nur jene Hitlers). Dass anfangs Hitlers Truppen durch diverse Überraschungsangriffe punkten konnten und so eine militärische Überlegenheit aufzeigten, bringt ihnen das Lob des Autors ein. Doch der weitere Verlauf, der Größenwahn Hitlers, bis hin zu planlosem Dahingemetzel kritisiert der Autor massiv. Interessant auch, dass der Autor Szenarien aufzeigt, wenn gewisse Entscheidungen anders gefallen wären.
Ich finde das Buch sehr gelungen, man erhält ordentlich zusammengefasst ein Werk, welches das gesamte Spektrum rund um den Zweiten Weltkrieg abdeckt. Es bleibt jedem selbst überlassen, welche Schlüsse man daraus für unser heutiges Europa zieht. Der Krieg liegt lange zurück, doch manches Mal scheint es, gewisse Dinge wiederholen sich. 5 Sterne