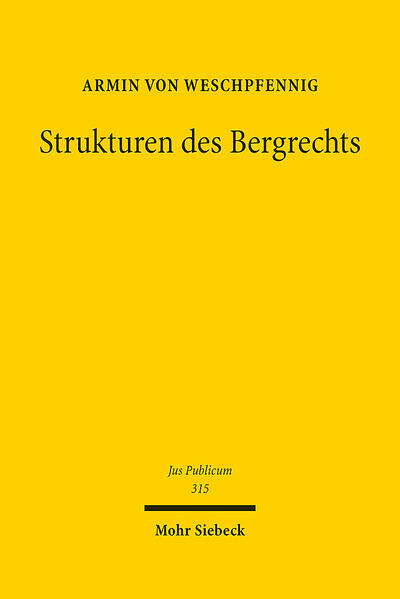Das deutsche Bergrecht ist ein über Jahrhunderte gewachsenes Regelungssystem, das oft mit einem modernen Verständnis vom Umgang mit Ressourcen kollidiert. Armin von Weschpfennig beleuchtet die Regelungsstrukturen und führt die Dogmatik des Bergrechts wieder näher an die Strukturen insbesondere des Planungs- und Umweltrechts heran.
Das deutsche Bergrecht ist ein über Jahrhunderte gewachsenes Rechtssystem und stellt im Kern einen rechtlichen Rahmen für die Gewinnung zahlreicher Bodenschätze bereit. Dabei erweist es sich gegenüber grundlegenden Reformen seit nunmehr über 40 Jahren als weitgehend resistent. Selbst das europäisierte Umweltrecht schlägt sich nur punktuell im Bundesberggesetz nieder. Armin von Weschpfennig beleuchtet die übergreifenden Strukturen des Bergrechts, untersucht verfassungsrechtliche Anforderungen und bindet das teils sehr spezielle Regelungssystem in die Dogmatik des allgemeinen Verwaltungsrechts sowie des Planungs- und Umweltrechts ein. Dabei unterzieht er die zunehmende rechtspolitische Kritik einer differenzierten Bewertung. Überdies rückt er das bergrechtliche Potenzial für die Energiewende - etwa bei Untergrundspeichertechnologien für regenerativ erzeugten Strom oder Wasserstoffspeichern - verstärkt in den Fokus.
Inhaltsverzeichnis
1. Kapitel: Grundlegung
A. Einleitung und Forschungsgegenstand
B. Überblick über die rechtsgeschichtliche Entwicklung des Bergrechts
C. Funktionen des Bergrechts
D. Einführung in die Vorhabenzulassung nach dem Bundesberggesetz
E. Umweltpolitisch motivierte Reformvorschläge
2. Kapitel: Bergbauberechtigungen und polygonale Interessenkonflikte
A. Grundlegendes zur Bergbauberechtigung
B. Ausgleich kollidierender Interessen bei der Konzessionierung?
C. Abschaffung des Berechtsamswesens?
D. Bilanz: Beibehaltung des Berechtsamswesens
3. Kapitel: Vorhabenzulassung und Konfliktlösung
A. Voraussetzungen der Betriebsplanzulassung
B. Bergrechtliche Verfahrensstufung
C. Außerbergrechtliche Anforderungen und parallele Zulassungsentscheidungen
D. Synthese: Weitreichende Entscheidungskonzentrationen de lege ferenda?
E. Bergnachbarrecht und Nutzungskonkurrenzen
F. Betriebseinstellung und dauerhafte Verantwortlichkeit
4. Kapitel: Grundlegende Bemerkungen zur Steuerung der Ressourcen- und Untergrundnutzung
A. Unterirdische Raumordnung
B. Mengensteuerung durch Bedarfsplanung
C. Kompetenzielle Grenzen der Steuerung durch Bergrecht - die Erforderlichkeit nach Art. 72 Abs. 2 GG
D. Ergebnis
Zusammenfassende Thesen