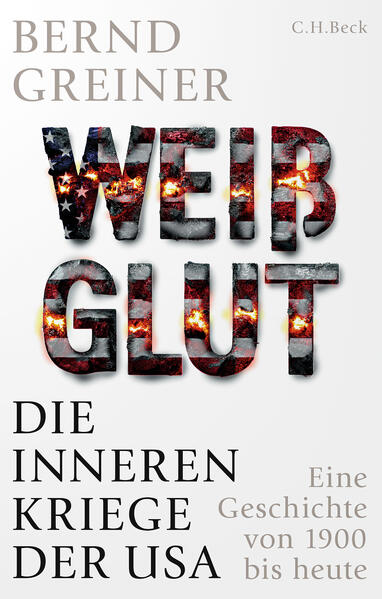Besprechung vom 11.11.2025
Besprechung vom 11.11.2025
Wie der Klassenkampf zum Kulturkampf wurde
Bernd Greiner zeichnet die Ursprünge der politischen Spaltung in den Vereinigten Staaten nach
Der Mord am rechten Aktivisten Charlie Kirk könnte weitreichende Folgen haben für die politische Kultur der Vereinigten Staaten. Die Richtung hat Präsident Donald Trump vorgegeben. Man müsse nun gegen alle vorgehen, die zu Gewalt aufrufen, und diese feierten, kündigte er an. Sein Vizepräsident J.D. Vance schlug in dieselbe Kerbe: Er kritisierte die Steuervergünstigungen zweier der größten linksliberalen Stiftungen des Landes. Außerdem sollten die Amerikaner Mitbürger bloßstellen, die die Ermordung Kirks gutheißen, und auch deren Arbeitgeber darüber informieren.
Willfährige Republikaner haben den Ball aufgenommen und landesweit dazu aufgerufen, Namen von Leuten öffentlich zu machen, die sich kritisch über Kirk äußerten. Kongressmitglieder versprachen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit diese Leute ihren Arbeitsplatz verlieren. Medienberichten zufolge ist das in mehreren Fällen auch schon vorgekommen. Die Partei, die in den vergangenen Jahren stets eine angebliche linke Diskurshoheit, Cancel Culture und eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, zementiert im ersten Verfassungszusatz, beklagt hat, schickt sich an, genau das zu tun.
Diese Entwicklung hat kein Vorbild in der jüngsten amerikanischen Geschichte. Allerdings, das zeigt Bernd Greiner in seinem neuen Buch "Weißglut: Die inneren Kriege der USA - Eine Geschichte von 1900 bis heute", ist dieser Furor nicht neu und erlebte schon wesentlich heftigere Ausprägungen.
Greiner, der an der Universität Hamburg die Geschichte der Vereinigten Staaten gelehrt hat, fängt seine Erzählung dabei schon in den Jahrzehnten vor der Jahrhundertwende an. Im sogenannten Vergoldeten Zeitalter ("Guilded Age") hatten sich einige wenige Industrielle und Bankiers einen sagenhaften Reichtum erworben - auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung. Deren Forderung nach höheren Löhnen oder Reduzierung der Wochenarbeitszeit wurden aber bedingungslos abgelehnt. Den Staat wussten die Arbeitgeber auf ihrer Seite. "Allein die Nationalgarde rückte zwischen 1870 und 1917 mehr als hundertmal gegen streikende Arbeiter aus", schreibt Greiner. So wurden die Streikenden etwa bei einem Kohlestreik in Colorado 1914 von der Nationalgarde und Schlägerbanden gejagt, verprügelt, gelyncht, ihre Frauen vergewaltigt.
Denn das sei das Besondere an der amerikanischen Reaktion auf die Arbeiterbewegung. Gewalt habe es auch in anderen Staaten gegeben. Aber die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Privaten sei einzigartig. Gerade auch, weil sie sich aus der Mitte der Gesellschaft heraus entwickelt habe. Gut situierte Bürger seien als Vigilanten aufgetreten, die für sich in Anspruch nahmen, das Recht durchzusetzen.
Dabei gelang es diesen Aktivisten laut Greiner immer wieder, den Staat vor sich herzutreiben. Besonders wenn sie sich in Organisationen zusammenfanden wie der "American Protective League" (APL). Dieser ging es um "Sicherung der Macht an der Heimatfront" im Ersten Weltkrieg. Wahre und imaginierte Feinde im Inneren sollten ausfindig gemacht und der Justiz zugeführt werden. "Als Ziele im Kampf kamen alle infrage, die in irgendeiner Weise die Kreise der Regierung störten oder aus anderen Gründen als unzuverlässig galten: Einwanderer aus Feindnationen wie Deutschland, Österreich oder Ungarn, Pazifisten, Suffragetten, Kriegsdienstverweigerer, Bibelforscher, ethnische Minderheiten, nicht zu vergessen Spione und Agenten im Dienst auswärtiger Mächte", so Greiner. Der Staat, der in der Fläche schwach war, war für diese Hilfe dankbar und nahm sie gern an.
Wiedergänger der APL gab es im Laufe der weiteren amerikanischen Geschichte unter verschiedenen Namen immer wieder: Private Vereinigungen im Kampf gegen alles, was sie als "un-amerikanisch" und unpatriotisch betrachteten. Und viele Amerikaner machten mit. Mitbürger wurden aufgrund nichtigster Anlässe denunziert und öffentlich an den Pranger gestellt. Sie wurden sozial geächtet, verloren ihren Arbeitsplatz, wurden vor Parlamentsausschüsse in Washington gezerrt, mussten öffentlich Besserung geloben oder wurden gleich vor Gericht gestellt - egal, ob sie sich wirklich etwas zu Schulden hatten kommen lassen oder aus anderen Beweggründen denunziert worden waren. In den Verdacht "un-amerikanischen" Verhaltens geraten zu sein, hieß, schuldig zu sein. Das gab es während der beiden Weltkriege und als Reaktion auf den "New Deal" im McCarthyismus der Fünfzigerjahre und ist genau das, was Trump und seine Büchsenspanner jetzt wieder fordern.
Mitgedacht werden muss dabei immer ein gewisser Rassismus, schreibt Greiner. Zur Jahrhundertwende sei es gegen die schwarze Bevölkerung gegangen, weil befürchtet wurde, diese könne nach dem Bürgerkrieg politische Teilhabe verlangen, und in den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts sollte ihr demnach nach den Bürgerrechtsgesetzen die kulturelle Teilhabe verwehrt werden.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde so der Klassenkampf in einen Kulturkampf transformiert, ist Greiners Schlüsselthese. Die republikanische Partei sei dabei von Kräften gekapert worden, die die Herrschaft der weißen, meist protestantischen, Bevölkerung in den Vereinigten Staaten perpetuieren wollten. Damit einhergegangen sei eine wachsende Skepsis dem Staat gegenüber, der der weißen Mittelschicht aus deren Sicht das Geld nehmen wolle, um es der andersfarbigen Unterschicht zukommen zu lassen. Den Wählern der Konservativen sei über die Jahrzehnte ein manichäisches Weltbild eingeimpft worden, es gehe immer um "wir" gegen "die". In der Wählerschaft und der Partei sei damit ein fruchtbarer Boden geschaffen worden für den Populismus eines Donald Trump.
Hauptschuldig ist für Greiner an dieser Entwicklung und an den gegenwärtigen Zuständen in den Vereinigten Staaten die republikanische Partei, die die Forderungen der "Extremisten der Mitte" übernommen habe. Die Demokraten bekommen aber auch ihr Fett weg. Diese hätten sich zwar in den Siebzigern für neue Wählerschichten der gehobenen Mittelschicht geöffnet, darüber aber ihre alten Wähler aus der Arbeiterschaft vergessen. Spätestens in den Neunzigern habe sie dann noch die neoliberale Sichtweise der Republikaner übernommen und damit die Arbeiter alleingelassen.
Schwächen hat "Weißglut" vor allem im Mittelteil, in dem der in der linken "Marburger Schule" promovierte Greiner das Verhalten der USA im Kalten Krieg kritisiert. Es hätte mehr Bemühen um Ausgleich mit der Sowjetunion geben müssen, fordert er und wirft den Amerikanern - mit dem Wissen von heute - Angst vor, nämlich vor der angenommenen Zahl nicht existenter, sowjetischer Atomwaffen. Seine Kritik an der Vorstellung, mehr Rüstung schaffe Abschreckung, trägt mit Blick auf das heutige Russland nicht.
Greiner hat mit "Weißglut" trotzdem ein gut lesbares Buch für all jene vorgelegt, die sich fragen, wie die USA dorthin gekommen sind, wo sie jetzt stehen. Und vielleicht lässt sich aus "Weißglut" ja auch Trost ziehen: Es war schon einmal schlimmer, und es wurde trotzdem wieder besser. OLIVER KÜHN
Bernd Greiner: Weißglut. Die inneren Kriege der USA. Eine Geschichte von 1900 bis heute.
C.H. Beck Verlag, München 2025. 432 S.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.