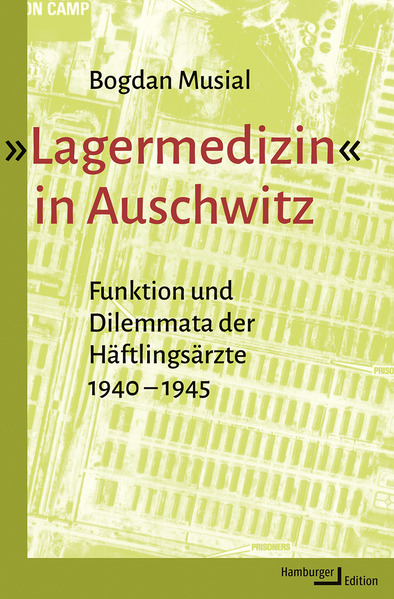
Zustellung: Di, 22.07. - Do, 24.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Dieser Ort werde die Hölle auf Erden sein, erklärte im Juni 1940 ein SS-Angehöriger Häftlingen, die beim Bau des Lagerzauns eingesetzt waren. Nach 1945 ist Auschwitz zum Synonym für die unvorstellbaren Grauen des Holocaust geworden.
Unter den Häftlingen waren alle Berufsgruppen vertreten, auch Ärztinnen und Ärzte. Wer eine Beschäftigung im Krankenbau fand, steigerte seine Überlebenschancen deutlich, konnte aber auch sein medizinisches Wissen einsetzen, um anderen zu helfen. Als Auschwitz 1942 zum Vernichtungskomplex ausgebaut wurde, ging die Behandlung der kranken Insassen praktisch in die Hände der Häftlingsärzte über, auch wenn SS-Mediziner die Aufsicht ausübten. Die Kooperation reichte oft tief und stürzte die Häftlingsärztinnen und -ärzte in Dilemmata: Einerseits konnten sie helfen, andererseits waren sie durch Befehle gezwungen, tödliche Entscheidungen mitzutragen.
Der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial beleuchtet erstmals umfassend die Rolle der Häftlingsärzte und rekonstruiert so auch die Geschichte von Auschwitz von den Anfängen bis zur Evakuierung im Januar 1945: Er beschreibt den Häftlingskosmos, die Arbeitseinsätze, die Selektionen, das Erproben von Mordmethoden, »medizinische Experimente« und die Vernichtung. Musials monumentale Studie ist ein herausragender Beitrag zur Forschung über Auschwitz und den Holocaust insgesamt.
Unter den Häftlingen waren alle Berufsgruppen vertreten, auch Ärztinnen und Ärzte. Wer eine Beschäftigung im Krankenbau fand, steigerte seine Überlebenschancen deutlich, konnte aber auch sein medizinisches Wissen einsetzen, um anderen zu helfen. Als Auschwitz 1942 zum Vernichtungskomplex ausgebaut wurde, ging die Behandlung der kranken Insassen praktisch in die Hände der Häftlingsärzte über, auch wenn SS-Mediziner die Aufsicht ausübten. Die Kooperation reichte oft tief und stürzte die Häftlingsärztinnen und -ärzte in Dilemmata: Einerseits konnten sie helfen, andererseits waren sie durch Befehle gezwungen, tödliche Entscheidungen mitzutragen.
Der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial beleuchtet erstmals umfassend die Rolle der Häftlingsärzte und rekonstruiert so auch die Geschichte von Auschwitz von den Anfängen bis zur Evakuierung im Januar 1945: Er beschreibt den Häftlingskosmos, die Arbeitseinsätze, die Selektionen, das Erproben von Mordmethoden, »medizinische Experimente« und die Vernichtung. Musials monumentale Studie ist ein herausragender Beitrag zur Forschung über Auschwitz und den Holocaust insgesamt.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 7
KL Auschwitz: Intentionen, Aufbau und Funktionsweise 29
»Gesundheitswesen« unter tödlichen Bedingungen 99
Der Vernichtungskomplex Auschwitz 209
Mörderische Medizin: Häftlingsärzte unter Zugzwang 429
Epilog: Schicksale, Aufklärung und Ahndung 597
Anhang
KL Auschwitz: Intentionen, Aufbau und Funktionsweise 29
»Gesundheitswesen« unter tödlichen Bedingungen 99
Der Vernichtungskomplex Auschwitz 209
Mörderische Medizin: Häftlingsärzte unter Zugzwang 429
Epilog: Schicksale, Aufklärung und Ahndung 597
Anhang
Produktdetails
Erscheinungsdatum
23. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
656
Autor/Autorin
Bogdan Musial
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
32 Abbildungen, 2 Karten
Gewicht
1012 g
Größe (L/B/H)
220/151/51 mm
ISBN
9783868543940
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 08.04.2025
Besprechung vom 08.04.2025
Die Schreibstube im Krankenbau war eine Fälschungswerkstätte
Bogdan Musial untersucht auf der Grundlage umfassender Quellenstudien Funktion und Handlungsspielräume von Häftlingsärzten in Auschwitz
In seinem 2019 veröffentlichten Tatsachenbericht "Mengeles Koffer" erzählte der deutsch-polnische Historiker Bogdan Musial die Geschichte von ihm angebotenen unbekannten Dokumenten zu den verbrecherischen Menschenversuchen des berüchtigten Lagerarztes Josef Mengele im Konzentrationslager Auschwitz. Auch wenn er die Papiere, die ein jüdischer Häftlingsarzt verfasst haben sollte, als Fälschung entlarvte, war Musials Interesse für das "Gesundheitswesen" in Auschwitz und die Rolle der Ärzte und Pfleger geweckt, die als Häftlinge in den Krankenbauten des Lagers unter Aufsicht der SS ihren Dienst verrichten mussten.
In einem Grundlagenwerk geht Musial nun zahlreichen Aspekten der Zwangssituation nach, in der sich inhaftierte Frauen und Männer befanden, die als medizinisches Personal für ihre Mitgefangenen sorgen mussten, aber von den SS-Ärzten auch gezwungen wurden, an Menschenversuchen mitzuwirken, Selektionen für die Gaskammern vorzubereiten oder Kranke zu ermorden. Musial berichtet in allen denkbaren medizinischen Einzelheiten und in vielen kaum erträglichen Details von diesem ethischen Dilemma der Häftlingsärzte, die sich nicht zum Werkzeug der Deutschen machen lassen wollten, aber um ihr eigenes Überleben kämpften mussten und sich trotz akutem Mangel an Nahrung, Medikamenten, medizinischen Geräten und Hilfsmitteln und unter völlig unzureichenden hygienischen Bedingungen um eine Linderung der Leiden ihrer Mitgefangenen bemühten. An eine Anwendung der erlernten medizinischen Behandlungen durch die Häftlingsärzte war in einem auf Ausbeutung und die Vernichtung menschlichen Lebens ausgerichteten Lager wie Auschwitz nicht zu denken, sodass sich eine ganz eigene "Lagermedizin" herausbildete, die mit improvisierten und unkonventionellen Behandlungsmethoden zumindest notdürftig zu helfen versuchte.
Unmittelbar nach der Errichtung des Lagers Auschwitz im Juni 1940 auf dem Gelände und in den Gebäuden einer ehemaligen Kaserne war es von der SS zunächst untersagt worden, dass ausgebildete polnische Mediziner im Krankenbau als Häftlingsärzte beschäftigt werden. Das Lager war gerade mit dem Ziel errichtet worden, die polnische Führungselite und Intelligenz zu vernichten. Die Versorgung der Kranken unterlag deshalb meist deutschen Funktionshäftlingen, die zuvor Handwerksberufe ausgeübt hatten und über keinerlei medizinische Fachkenntnisse verfügten. Polnische und jüdische Mediziner durften bis Ende 1941 beziehungsweise Herbst 1942 allenfalls als Häftlingspfleger oder unter Angabe eines falschen Berufes als Ärzte in den Krankenblöcken des um das Vernichtungslager Birkenau und das Arbeitslager Monowitz erweiterten Lagerkomplexes Auschwitz arbeiten. Ab 1943 gab es ernsthafte und teils erfolgreiche Versuche der SS, die Häftlingssterblichkeit im Lager auch mithilfe dieser professionellen Häftlingsärzte zu senken, um keine weiteren dringend benötigten Arbeitskräfte für die Rüstungsindustrie zu verlieren.
Für seine umfangreiche Darstellung hat Musial Quellen aus mehr als zwanzig Archiven weltweit zusammengetragen. Er kann so die ganze Bandbreite ärztlichen Verhaltens von williger Kollaboration bis hin zu geheimen Sabotageakten anhand zahlreicher einzelner Biographien von Häftlingsärzten nachzeichnen. Viele seiner vor allem polnischsprachigen Quellen, unter ihnen die unveröffentlichten Manuskripte der Erinnerungen der Häftlingsärzte Wladyslaw Dering (1903-1965) und Rudolf Diem (1898-1984) und zahlreiche Prozessakten aus der Nachkriegszeit, sind in dem Buch erstmals systematisch für die Forschung ausgewertet worden. Darunter ist auch das Operationsbuch der chirurgischen Abteilung im zentralen Häftlingskrankenbau, das alle operativen Eingriffe im Stammlager Auschwitz, etwa einfache Blinddarmentfernungen, aber auch erzwungene Kastrationen, verzeichnete.
Zugleich zeigt Musial am Beispiel der in der Schreibstube des Krankenbaus ausgestellten Totenscheine, in welch gigantischem Umfang Dokumente gefälscht wurden, um die Massenverbrechen in Auschwitz zu vertuschen. Morde, etwa die verbreiteten Exekutionen durch direkte Phenolinjektionen in das Herz erkrankter Häftlinge, und Hungertode wurden durch die Angabe falscher "natürlicher" Todesursachen kaschiert. "In den Jahren 1942/43 entwickelte sich die Krankenbauschreibstube [...] zur wohl größten Fälschungswerkstatt in der Weltgeschichte", so Musial.
Durch die Etablierung einer perfiden Lagerhierarchie nach rassischen Gesichtspunkten als eine Art "Herrschaftsinstrument" gelang es den Deutschen nicht nur unter den Lagerinsassen, sondern auch unter den Häftlingsärzten nahezu jeden Gedanken an Solidarität zu zerstören und teils erbitterte Feindschaft zu stiften. Insbesondere zwischen den polnischen und jüdischen Häftlingsärzten herrschte oft ein angespanntes Verhältnis. Unter den erkrankten Häftlingen wurde in der Behandlung und in der Zuteilung medizinischer Ressourcen zwischen "Reichsdeutschen", polnischen und jüdischen Lagerinsassen unterschieden. Die Krankenbauten für die verschiedenen Häftlingsgruppen waren räumlich getrennt, und jüdische Lagerinsassen durften nur von jüdischen Häftlingsärzten betreut werden.
Zugleich wurden die Krankenbauten zu Zentren des Lagerwiderstands, weil sie zum Teil recht autonom agieren konnten. Als das Fleckfieber in Auschwitz grassierte, betraten SS-Ärzte die Krankenreviere aus Angst vor Ansteckung nicht mehr. Häftlingsärzte, die vergleichsweise gut mit Nahrungsmitteln versorgt wurden und so dem sonst allgegenwärtigen Tod durch Hunger und Entkräftung entgehen konnten, verfassten Berichte über die Geschehnisse im Lager, sammelten Papiere und Beweise zur Dokumentation der Verbrechen und hielten die Namen der verantwortlichen Täter fest. In einigen Fällen liquidierten sie besonders brutale Funktionshäftlinge und Spitzel der SS unter den Häftlingen, wenn diese als Kranke in den Krankenbau eingeliefert worden waren.
Musials chronologische Studie stützt sich vor allem auf die Zeugnisse von überlebenden Zeitzeugen unter den Häftlingsärzten, die er mit langen Zitaten immer wieder zu Wort kommen lässt. Zugleich hinterfragt er diese Quellen stets kritisch, insbesondere die Berichte von kommunistischen Überlebenden, fügt Korrekturen ein, weist auf Widersprüche hin und legt tendenziöse Aussageabsichten offen. Eine Idealisierung, gar Heroisierung einzelner Häftlingsärzte wird so zugunsten einer sachlichen, an keiner Stelle moralisierenden Bestandsaufnahme der eigentlich unlösbaren Zwangslage der Häftlingsärzte im Lagerkosmos vermieden. RENÉ SCHLOTT
Bogdan Musial: "'Lagermedizin' in Auschwitz". Funktion und Dilemmata der Häftlingsärzte 1940-1945.
Hamburger Edition, Hamburg 2024. 656 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
am 13.12.2024
Sehr ergreifendes Epos
Mein Fazit:
Zitat:"Dieser Ort werde die Hölle auf Erden sein, erklärte im Juni 1940 ein SS-Angehöriger Häftlingen " Ein Ort unvorstellbarer Gräueltaten der Nazi-Schergen, politischer Häftlinge gegenüber ihren Landsleuten und Ärzten: ob Deutsche zum Beispiel (Mengele), polnische oder andere Ärzte
Ich habe schon viel über das KL Auschwitz gelesen. Aber dieses Buch toppt alles. Chronologisch erzählt der Autor über die Anfänge des KL, den Aufbau des Lagers, die grausame Ermordung der Juden, die Grausamkeiten der SS-Schergen
Zitat: "Sie griffen unsere Kameraden mit wildem Gelächter an, schlugen sie auf den Kopf, traten die am Boden Liegenden in die Nieren sprangen ihnen mit den Stiefeln auf den Brustkorb und Bauch " Viele Insassen fielen bei den Misshandlungen um. Wie grausam können Menschen sein? Und wie viel kann ein Mensch ertragen, bevor die Seele bricht? Wie viele unschuldige Seelen wurden im Lager gequält, zu Tode gefoltert, verhungern lassen und einfach verbrannt, um Beweise zu vernichten. Da kommen einem die Tränen. Was für ein tragisches Kapitel in der deutschen Geschichte.
Wir lernen auch den Lagerkommandanten Rudolf Höß kennen. 1940 baut er das Lager zum Vernichtungslager aus, schickt 100000 in den Tod, wird 1947 hingerichtet Die Kapitel über die Lagerärzte fand ich sehr traurig. Neugeborene zu töten, um die Mutter retten zu können, sonst wären beide ins Gas gegangen. Eine polnische Mutter, die ihr Neugeborenes erdrosselt, um für ihre drei kleinen Kinder leben zu können ... wie müssen sich diese Frauen gefühlt haben? Macht einfach nur sprachlos.
In diesem Buch sind alle Fakten vom Autor zusammengefasst worden, der Schreibstil ist flüssig, leicht verständlich geschrieben, sehr berührend und emotional.Ich bin echt begeistert. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, sollte dieses Buch unbedingt lesen. Es gibt kein Besseres.









