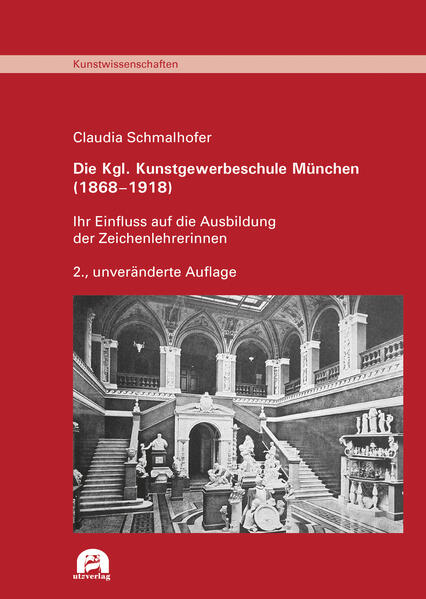
Zustellung: Mo, 28.07. - Do, 31.07.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Die Kgl. Kunstgewerbeschule in München (1868-1946) war neben der Münchner Akademie der Bildenden Künste und der Nürnberger Kunstgewerbeschule die bedeutendste künstlerische Ausbildungsinstitution in Bayern. Wenngleich mit Schwerpunkt auf der Ausbildung der Zeichenlehrerinnen geschrieben, werden Geschichte und kunstgewerbliche Ausbildung in den Jahren von ihrer Gründung bis 1918 nicht nur ausführlich dargestellt, sondern durch umfangreiche Dokumente und statistische Erhebungen im Anhang derart vervollständigt, dass das Werk für diesen Zeitraum Handbuchcharakter beanspruchen kann. Vorliegende Arbeit darf als veritable Pionierarbeit der kunstpädagogischen Sachforschung eingeschätzt werden, da sie mit der dort erstmals an einer staatlichen Institution stattfindenden Ausbildung (ab 1872) und Prüfung von Zeichenlehrerinnen (ab 1878) eines der ureigensten Felder kunstpädagogischer Gender-Forschung erschließt.
Mehr aus dieser Reihe
Produktdetails
Erscheinungsdatum
20. September 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2., unveränderte Auflage (Erstauflage 2005)
Seitenanzahl
564
Reihe
Kunstwissenschaften, 13
Autor/Autorin
Claudia Schmalhofer
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
67 SW-Abb.
Gewicht
1179 g
Größe (L/B/H)
50/170/240 mm
ISBN
9783831686858
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Claudia Schmalhofer mit ihrer Dissertation zur Königlichen Kunstgewerbeschule München und ihrer Zeichenlehrerinnenausbildung eine klaffende Lücke in der Erforschung des Ausbildungswesens im München des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts zu schließen vermag. Trotz der erklärten und wohl zu Recht ausgesparten Analyse der künstlerischen Arbeiten von Lehrkräften und Studierenden [. . .], gelingt es der Autorin durch beispielhafte Quellenarbeit - etwa anhand der überlieferten Auflistung der benutzten Lehrmittel - die künstlerische Position der Königlichen Kunstgewerbeschule und ihre pädagogische Ausrichtung zu ermitteln.
Detailreich in allen Zusammenhängen und quellenkundlich fundiert, wird hier dargelegt, was der Fachforschung bislang kaum einmal einen Aufsatz wert war: die enge, konfliktreiche Beziehung zwischen staatlicher Zeichenlehrerausbildung und weiblichem Berufsverständnis in der »Kunststadt« München. Dabei ist es das besondere Interesse der Autorin, den Wandel der institutionellen Strukturen und internen Selbstbestimmungsversuche dozierender und studierender Frauen nachzuzeichnen. [ ] Die Autorin kann mit soziologischem Zugriff erklären, wie in München ein verwirrender Prozess zwischen geschlechtsspezifischen Karrieren, Institutionskonkurrenzen (Akademie, Technische Hochschule, Kunstgewerbeschule) und Ortsrivalitäten (München versus Nürnberg) ablief. Neben den Fortschritten und Hemmnissen in der Reformpolitik ist die Zuwendung zum »neuen« Ornament von besonderem küstlerischen Interesse. Die Geschichte des Münchner Jugendstils kann ohne diese Befunde nicht mehr geschrieben werden. [ ] Fazit: Das Buch bietet wichtige Aufschlüsse zur Münchner Bildungs- und Institutionengeschichte des 19. Jahrhunderts.
Detailreich in allen Zusammenhängen und quellenkundlich fundiert, wird hier dargelegt, was der Fachforschung bislang kaum einmal einen Aufsatz wert war: die enge, konfliktreiche Beziehung zwischen staatlicher Zeichenlehrerausbildung und weiblichem Berufsverständnis in der »Kunststadt« München. Dabei ist es das besondere Interesse der Autorin, den Wandel der institutionellen Strukturen und internen Selbstbestimmungsversuche dozierender und studierender Frauen nachzuzeichnen. [ ] Die Autorin kann mit soziologischem Zugriff erklären, wie in München ein verwirrender Prozess zwischen geschlechtsspezifischen Karrieren, Institutionskonkurrenzen (Akademie, Technische Hochschule, Kunstgewerbeschule) und Ortsrivalitäten (München versus Nürnberg) ablief. Neben den Fortschritten und Hemmnissen in der Reformpolitik ist die Zuwendung zum »neuen« Ornament von besonderem küstlerischen Interesse. Die Geschichte des Münchner Jugendstils kann ohne diese Befunde nicht mehr geschrieben werden. [ ] Fazit: Das Buch bietet wichtige Aufschlüsse zur Münchner Bildungs- und Institutionengeschichte des 19. Jahrhunderts.
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die Kgl. Kunstgewerbeschule München (1868-1918)" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.











