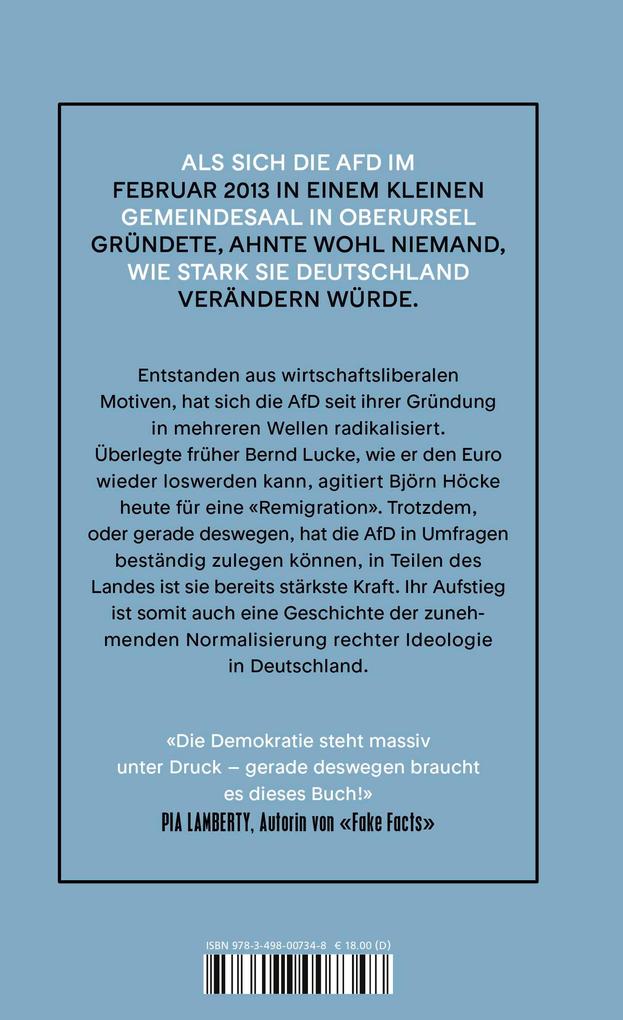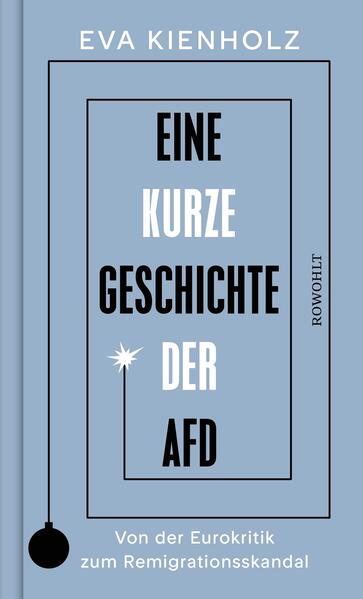
Zustellung: Mi, 14.05. - Fr, 16.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Eva Kienholz fasst in ihrer «Kurzen Geschichte der AfD» prägnant und anschaulich die zunehmende Radikalisierung der Alternative für Deutschland zusammen.
Die AfD hat die politische Landschaft in Deutschland seit ihrer Gründung 2013 tiefgreifend verändert. Entstanden als wirtschaftsliberale Partei, deren Hauptziel es war, den Euro in Deutschland wieder abzuschaffen, hat sie sich seitdem in mehreren Wellen radikalisiert. Von Bernd Lucke über Frauke Petry, Jörg Meuthen und Tino Chrupalla sind ihre Aussagen immer extremer geworden. Björn Höcke agitiert heute für die «Remigration» von Menschen mit Migrationshintergrund und gilt als gesichert rechtsextrem: Er hat das Ringen um die Macht in der Partei gewonnen. Trotzdem, oder gerade deswegen, hat die AfD in der Gunst der Wählerinnen und Wähler beständig zulegen können und breite Bevölkerungsschichten erreicht. Bei den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland im Herbst 2024 erreichte sie in zwei Bundesländern über 30 Prozent der Stimmen, in Thüringen wurde sie sogar stärkste Kraft - ein Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik.
Eva Kienholz zeichnet die Entwicklung der Partei nach, die sich immer weiter nach rechts bewegt hat und nun offen nach der Macht im Land greift. Ein wichtiges Buch zum Verständnis der politischen Landschaft in Deutschland.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
13. August 2024
Sprache
deutsch
Auflage
2. Auflage
Seitenanzahl
268
Autor/Autorin
Eva Kienholz
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
292 g
Größe (L/B/H)
189/121/24 mm
ISBN
9783498007348
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Das Buch gibt einem die Chance, zu verstehen, wie und mit welchen Mitteln es die AfD geschafft hat, so erfolgreich zu werden." Bodo Morshäuser, Deutschlandfunk Kultur "Lesart"
Dieser Essay gehört zum Scharfsinnigsten und sprachlich Einnehmendsten, was über Kriegsalbtraum und Friedenstüchtigkeit, Demokratie und Kapitalismus, Ost und West, Frauen und Männer jetzt in dieser Republik zu lesen ist. der Freitag
"Schaum vor dem Mund haben viele, aber die Fakten kennen nicht alle." Bodo Morshäuser, Deutschlandfunk Kultur "Lesart"
Dieser Essay gehört zum Scharfsinnigsten und sprachlich Einnehmendsten, was über Kriegsalbtraum und Friedenstüchtigkeit, Demokratie und Kapitalismus, Ost und West, Frauen und Männer jetzt in dieser Republik zu lesen ist. der Freitag
"Schaum vor dem Mund haben viele, aber die Fakten kennen nicht alle." Bodo Morshäuser, Deutschlandfunk Kultur "Lesart"
 Besprechung vom 05.11.2024
Besprechung vom 05.11.2024
Eine Partei radikalisiert sich
Eva Kienholz schildert die Geschichte der AfD von ihren eurokritischen Anfängen bis zum Siegeszug Höckes
Wie es sich für gute Gruselgeschichten gehört, beginnt auch diese aufregend mysteriös. Ein Tag im Winter. 18 Männer. Versammelt unter einem Kruzifix. Geeint in ihrem Wunsch nach einer anderen Finanzpolitik. Und so gründen sie an diesem Tag, dem 6. Februar 2013, im Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Oberursel, eine Alternative in Parteiform: Die AfD.
Die Journalistin Eva Kienholz geht mit ihrem Buch "Eine kurze Geschichte der AfD" zu den Anfängen der Alternative für Deutschland zurück. Elf Jahre erschienen nicht besonders lang, um die Geschichte einer Partei aufzuschreiben, räumt sie im Vorwort ein: "Im Fall der Alternative für Deutschland aber gilt es, schon heute genau hinzuschauen." Nicht nur, weil sie selbst in ihrer kurzen Parteiengeschichte schon einen rasanten Wandel hingelegt habe, schreibt Kienholz. Sondern weil sie das auch mit Deutschland vorhabe.
Kienholz erzählt die Geschichte der AfD in fünf Kapiteln, oder vielmehr in fünf Karrieren. Denn jedes Kapitel ist einem Vorsitzenden gewidmet. Sie beginnt bei einem der Gründerväter: Bernd Lucke - oder "Der gescheite Professor Lucke". Kienholz zeichnet Luckes Bemühungen nach, sein politisches Profil zu finden und gleichzeitig dem hohen Erwartungsdruck standzuhalten - "er versuchte den Spagat zwischen Wirtschaftsprofessor und Populist", fasst sie zusammen.
Kienholz nutzt Lucke aber auch, um mit ihm die Entwicklung der Partei um ihn herum nachzuzeichnen. Dass die AfD vor allem als eurokritische Partei angefangen hat, überrascht dabei weniger als die von Kienholz beschriebene Gegenveranstaltung der damaligen NPD, die sich schon am Gründungstag der AfD ein paar Häuser weiter traf. Offenbar sahen die Rechtsextremisten in der AfD schon damals eine gefährliche Konkurrenz. In diesem Zusammenhang ist es ebenso interessant, dass die AfD, wie Kienholz recht knapp erwähnt, bereits in ihrem ersten Wahlprogramm die "ungeordnete Zuwanderung in unsere Sozialsysteme" unterbinden wollte. Ohne es explizit zu formulieren, verdeutlicht sie damit auch: Die AfD hat die Migrationspolitik nicht, wie häufig angenommen, plötzlich für sich entdeckt, sondern ihre diesbezüglichen Forderungen über die vergangenen Jahre vielmehr radikal verschärft.
Genau acht Seiten dauert es, bis Kienholz Björn Höcke als Luckes großen Gegenspieler ins Feld führt. Wenige Wochen nach Gründung der AfD trat er in die Partei ein, 2015 rief er mit der Erfurter Resolution den radikalen Flügel ins Leben. Lucke versuchte, mit einer Deutschland-Resolution und dem Verein Weckruf, einem Zusammenschluss der Gemäßigten, dagegenzuhalten - und scheiterte schließlich, wie Kienholz sehr plastisch darstellt, beim großen Showdown in der Essener Grugahalle.
Auf Lucke folgte Frauke Petry. Im zweiten Kapitel wird die 2015 zur Parteivorsitzenden gewählte Chemikerin als ambitioniert und - im Umgang mit Höcke - zumindest vorsichtiger als ihr Vorgänger porträtiert. Exemplarisch dafür beschreibt Kienholz, wie Höcke im selben Jahr öffentlich einen "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp" herbeiphantasierte und dafür von Petry nicht mehr als eine milde Rüge erhielt: Gemeinsam mit ihrem Ko-Vorsitzenden Jörg Meuthen tat sie die Aussage damals als "politische Torheit" ab. Kienholz charakterisiert jeden der fünf Akteure vor allem in ihrem Umgang mit Höcke - und das aus gutem Grund. Schließlich war Höcke bei jedem der früheren Vorsitzenden maßgeblich daran beteiligt, sie aus der Partei zu drängen. So brachte er schließlich auch Petry zu Fall, die sich nicht gegen die radikalen Kräfte durchsetzen konnte - und nach Petry, wie Kienholz ausführlich im dritten Kapitel darstellt, Jörg Meuthen.
Höcke wird schleichend zum heimlichen Protagonisten des Buches, dem zwar kein eigenes Kapitel gewidmet wird und der doch in jedem prominent auftaucht. Damit folgt die Struktur des Buches gewissermaßen seinem Inhalt. Es unterstützt das Bild eines manchmal fast diabolisch anmutenden Strippenziehers, der sich lauernd im Hintergrund bereithält.
Immer wieder lockert Kienholz ihre Analysen durch kleine Kuriositäten auf. So erinnert sie im Zusammenhang mit Petry auch an ihren ebenfalls früher in der AfD aktiven Ehemann Marcus Pretzell, der ihr in der "Bunten" etwas "dämonenhaft Schönes" attestierte. Droht das Buch stellenweise zu einer etwas ermüdenden Aneinanderreihung von Parteitagen und anderen Veranstaltungen zu werden, lockert Kienholz sie durch szenische Beobachtungen auf. Höckes Ankunft bei einem von der AfD organisierten Volksfest in Cottbus 2019 beschreibt sie so: "Nach über einer Viertelstunde warten fuhr eine schwarze Limousine vor - just in dem Augenblick, als die Sonne zwischen den Wolken hervorbrach."
Was bei Kienholz hingegen wenig Platz findet, ist der politische und gesellschaftliche Kontext, in dem die AfD sich entwickelt hat - Kienholz geht weder explizit auf die Wählerschaft der AfD noch ihre Beziehung zu anderen Parteien ein. Die Linse, durch die Kienholz auf die AfD blickt, ist recht schmal. Der inhaltlichen Qualität tut das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es erlaubt ihr einen engmaschigen Rückblick auf die internen Kämpfe der AfD in den vergangenen elf Jahren.
Ihren vorläufigen Endpunkt erreicht die Parteiengeschichte schließlich mit den beiden derzeitigen Vorsitzenden Tino Chrupalla (der vermeintlich rechtskonservative "Everybody's Darling") und Alice Weidel. Kienholz beschreibt sie als anpassungsfähige Frau, die aus den Fehlern der anderen gelernt und mit Höcke eine Art Nichtangriffspakt geschlossen haben soll. Im Gegensatz zu ihren Vorgängern habe Weidel eines begriffen, schreibt Kienholz: "Wer in der AfD weiterkommen will, darf sich nicht gegen Höckes Flügel stellen."
Mit dem Wahlerfolg der AfD bei den Europawahlen im Juni schließt Kienholz die Geschichte der AfD zunächst ab. Das Radikale habe die AfD inzwischen zum Normalzustand erklärt, resümiert Kienholz. Und so endet ihr Buch, wie es sich für eine gute Gruselgeschichte gehört: angemessen düster. ANNA NOWACZYK
Eva Kienholz: Eine kurze Geschichte der AfD. Von der Eurokritik zum Remigrationsskandal
Rowohlt Verlag, Reinbek 2024. 271 S.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.