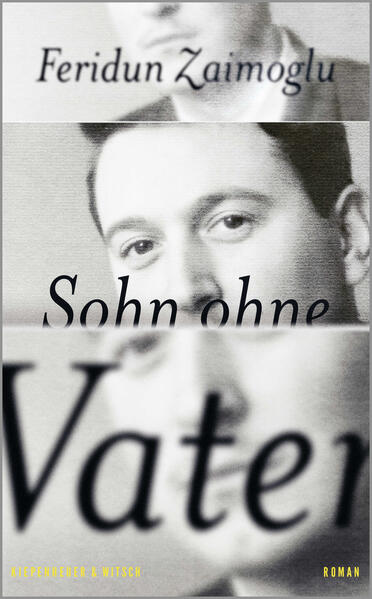Besprechung vom 15.04.2025
Besprechung vom 15.04.2025
Wir weinen, als wollten wir unsere Gesichter erbrechen
Alles wahr, wenn auch auf ganz besondere Art: Feridun Zaimoglus Roman "Sohn ohne Vater" ist ein großes Fabulierkunstwerk,
zusammengehalten vom Handlungsfaden einer phantasmagorischen Trauerreise in den Süden.
Dies ist ein Buch des wunderlichen Pathos. Es beginnt schon beim Titel "Sohn ohne Vater". Er lässt an das Schicksal eines Jungen denken, der vaterlos aufwächst. Tatsächlich ist dieser Sohn aber ein Mann um die sechzig, der vom Tod seines fast neunzigjährigen Vaters aus der gewohnten Existenz "geschleudert" wird: "Wir weinen, als wollten wir unsere Gesichter erbrechen. Wir haben keinen Vater mehr in diesem Leben. Wir wollen ihn wiederhaben." Die Berechtigung, das eigene Leben fortzusetzen, scheint dem Erzähler fraglich: "Müsste ich mir die Kehle durchschneiden?" Und: "Das ist mir ein stinkendes Leben ohne meinen Vater."
Angesichts des gesegneten Alters des Hingeschiedenen irritiert solch wüste Trauer. "Die Trauer macht mich türkisch", gesteht denn auch der Ich-Erzähler, der dem Kieler Schriftsteller Feridun Zaimoglu in vielem sehr ähnlich ist. Und entsprechend verhalten sich auch die Menschen, denen er in der deutschen Parallelgesellschaft begegnet. "Kehrst du zu deinem Volk zurück?", wird er einmal gefragt, als habe er sechs Jahrzehnte in der unzukömmlichen Fremde gelebt.
Erzählerisch wirkt der Exzess der Trauer als Katalysator. Wer dermaßen erschüttert ist, erleidet Risse in der Existenz, durch die Erinnerungen freigesetzt werden und durch die ein Sog des Phantastischen strömt. So ersteht in prägnanten Bildern die Gestalt des Vaters, der in den Sechzigerjahren als "Arbeitstürke" nach Deutschland kam und wegen seiner guten Deutschkenntnisse bald zum Sprachmittler und Übersetzer aufstieg; mitunter musste er sich auch von kriminellen Analphabeten Briefe diktieren lassen. Mit seinen "sensationellen Koteletten" entfaltete der Vater Wirkung auf Frauen, insbesondere auf "ansehnliche Witwen". Aber er war kein oberflächlicher Charmeur, sondern ein Mann voller "Gemütstiefe", der regelmäßig arme und manchmal halbverrückte Fremde zum Essen mit nach Hause brachte. Diese Offenheit gegenüber allen Erscheinungen des Menschenlebens prägte auch den Schriftsteller-Sohn, dem der Vater in einem anrührenden Moment des Romans gewissermaßen die Absolution erteilt: "Mein Sohn hat sich, anstatt das Medizinstudium abzuschließen, der Schriftstellerei verschrieben. Er fabuliert. Er macht aber keine falschen Angaben über mich." Alles wahr also, lässt sich über dieses Buch sagen, wenn auch auf ganz besondere Art.
"Sohn ohne Vater" ist ein Fabulierkunstwerk, das zusammengehalten wird vom Handlungsfaden der Reise zur trauernden Mutter in die Türkei. Es ist eine Fahrt voller Hindernisse. Der Erzähler leidet an schwerer Flugangst, hat schlechte Erfahrungen mit Schiffsreisen gemacht und kann selbst kein Auto steuern. Was liegt da näher, als mit zwei hilfreichen Bekannten ein Wohnmobil zu chartern? Wer es sich beschwerlich macht, bekommt etwas zu erzählen.
Je weiter über den Balkan die Reise geht, desto bizarrer werden die Erlebnisse. Von einer "Banditensippe" - einer schauerlichen Alten mit einem Trupp kahler Kinder - wird der Erzähler in einen Hinterhalt gelockt und ausgeraubt. Auch die Erinnerungspfade führen tiefer ins Groteske, zu den Kindheitsängsten. "Kameraden aus Erbsenpüree" hat sich der Junge im Grundschulhort geknetet, um sich nicht so allein zu fühlen. In der Pubertät laborierte eine heilkräftige Frau vergeblich an seiner Akne und demütigte ihn dabei nachhaltig: "Sie sagte, dass ich übler aussehe als erwartet: wie ein halb wilder Mensch, der Beeren auf seinem Gesicht ausgedrückt hat."
Unterwegs meldet sich die Mutter regelmäßig über das Mobiltelefon. Auch die Dialoge mit ihr wirken zeremoniös, schon weil sie vom Sohn gesiezt wird ("Ich bin bald bei Ihnen, Mutter"). Sie dagegen macht ihm Vorwürfe: "Du hast mir und deinem Vater selig ein Enkelkind vorenthalten. Es ist nicht zu spät. Stell dich einer Frau aus Eritrea vor." An der türkischen Grenze droht die Reise noch knapp zu scheitern, aber nicht, weil das Enkelkind fehlt, sondern der Fahrzeugschein. Der Wohnmobil-Verleiher hat ihnen nur eine Farbkopie mitgegeben.
Als der Sohn endlich bei der Mutter ankommt, gilt es neben den Trauerritualen weitere heikle Situationen zu bestehen. Mittels einer Überwachungskamera ertappt die Mutter eine Frau dabei, wie sie am Ferienhaus der Familie den Olivenbaum plündert. Die verdutzte Diebin wird krass zur Rechenschaft gezogen: "Ich könnte dir die Haut aufreißen. Ich könnte sie dir abziehen bis zur Stirn, dass sie auf deinem Kopf aufliegt wie eine Schondecke", droht die Mutter, während der Sohn eher verlegen danebensteht. Darf man anmerken, dass solche Verwünschungen ziemlich "orientalisch" anmuten? Die phantasmagorische Trauerreise führt in einen Süden, dessen "mörderische Maßlosigkeit" dem Erzähler fremd ist, auch wenn sie wie ein Familienerbe über ihn kommt. "Das alles ist mir zu südlich . . . Die Hitze setzt den Türken zu", meint er, um in nächsten Moment selbst martialisch zu räsonieren: "Ich schnitte mir am liebsten das Gesicht aus dem Kopf und würfe es dem Pinscher hin." Für diesen Satz hätte sogar Kafka Zaimoglu beneidet.
Viele Figuren in diesem Roman klingen so, als würden sie aus alten Büchern zitieren und sich mittels dunkler Dichter- oder Sängerworte verständigen. Überhaupt ist Zaimoglus Deutsch ein Wortschatz-Wunderwerk, kraftvoll und sensibel, altertümelnd und zeitgemäß zugleich - und man wundert sich nicht, dass zu seinen zahlreichen Werken auch ein Luther-Roman ("Evangelio") gehört. Natürlich musste ein sprachbegabter Einwanderer-Sohn wie er, auch wenn er schon mit sechs Monaten nach Deutschland kam, ein spezielles Verhältnis zur hiesigen Muttersprache entwickeln, die nicht die seiner Mutter war.
"Sohn ohne Vater" sei sein bisher "persönlichster" Roman, hat Zaimoglu gesagt. Auf jeden Fall ist es ein Buch, das Trauer und Komik aufs Schönste und Ungewöhnlichste vereint. Über ein paar Längen sieht man gern hinweg. Man möchte ja nicht als Pedant oder - mit einem Ausdruck des Vaters - als "kleinschädeliger Kakerlakendompteur" gelten. WOLFGANG SCHNEIDER
Feridun Zaimoglu:
"Sohn ohne Vater".
Roman.
Kiepenheuer & Witsch, Köln 2025.
288 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.