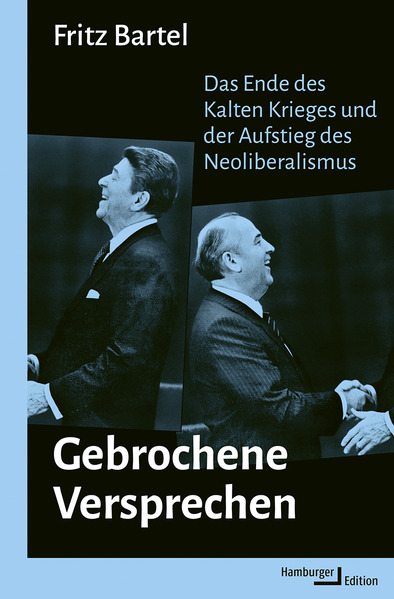
Zustellung: Sa, 02.08. - Di, 05.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Warum kam der Kalte Krieg zu einem friedlichen Ende? Und warum hat die neoliberale Wirtschaftspolitik im späten 20. Jahrhundert die Welt erobert? In diesem bahnbrechenden Buch argumentiert Fritz Bartel, dass die Antwort auf diese Fragen ein und dieselbe ist. Der Kalte Krieg begann als Wettstreit zwischen kapitalistischen und kommunistischen Regierungen, um ihren Bürgerinnen und Bürgern ein besseres Leben zu ermöglichen. Doch die wirtschaftlichen Erschütterungen der 1970er Jahre machten solche Versprechen auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs unhaltbar. Die Energie- und Finanzmärkte übten immensen Druck auf die Regierungen aus.
Der Historiker Fritz Bartel erzählt, wie der Druck, Versprechen zu brechen, das Ende des Kalten Krieges einleitete. Im Westen gab der Neoliberalismus Ronald Reagan und Margaret Thatcher das politische und ideologische Rüstzeug, um Industrien abzuwickeln, Sparmaßnahmen durchzusetzen und die Interessen des Kapitals über die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen. Doch in Osteuropa wehrten sich Revolutionäre wie Lech Walesa gegen jeden Versuch, die Regeln des Marktes durchzusetzen. Und Michail Gorbatschow gelang es letztlich nicht, das sowjetische System zu reformieren.
Der Historiker Fritz Bartel erzählt, wie der Druck, Versprechen zu brechen, das Ende des Kalten Krieges einleitete. Im Westen gab der Neoliberalismus Ronald Reagan und Margaret Thatcher das politische und ideologische Rüstzeug, um Industrien abzuwickeln, Sparmaßnahmen durchzusetzen und die Interessen des Kapitals über die der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stellen. Doch in Osteuropa wehrten sich Revolutionäre wie Lech Walesa gegen jeden Versuch, die Regeln des Marktes durchzusetzen. Und Michail Gorbatschow gelang es letztlich nicht, das sowjetische System zu reformieren.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung: Versprechen geben, Versprechen brechen 7
Teil I Die Privatisierung des Kalten Krieges 27
1 Der Ölschock im Kalten Krieg 29
2 Jahre der Illusionen und der Abrechnung 59
3 Eine Geschichte zweier Krisen 85
4 Die kapitalistische Perestroika 123
5 Der ökonomische Kalte Krieg 149
Teil II Das Ende des Kalten Krieges 185
6 Die sozialistische Perestroika 187
7 Eine Phase außergewöhnlicher Politik 221
8 Der Zwang der Kreditwürdigkeit 255
9 Abwanderung, Gewalt und Austerität 283
10 Disziplin oder Rückzug 317
Schluss: Gebrochene Versprechen 357
Danksagung 377
Literaturverzeichnis 382
Anmerkungen 393
Personenregister 436
Teil I Die Privatisierung des Kalten Krieges 27
1 Der Ölschock im Kalten Krieg 29
2 Jahre der Illusionen und der Abrechnung 59
3 Eine Geschichte zweier Krisen 85
4 Die kapitalistische Perestroika 123
5 Der ökonomische Kalte Krieg 149
Teil II Das Ende des Kalten Krieges 185
6 Die sozialistische Perestroika 187
7 Eine Phase außergewöhnlicher Politik 221
8 Der Zwang der Kreditwürdigkeit 255
9 Abwanderung, Gewalt und Austerität 283
10 Disziplin oder Rückzug 317
Schluss: Gebrochene Versprechen 357
Danksagung 377
Literaturverzeichnis 382
Anmerkungen 393
Personenregister 436
Produktdetails
Erscheinungsdatum
12. Mai 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Das Ende des Kalten Krieges und der Aufstieg des Neoliberalismus.
13 Abbildungen.
Seitenanzahl
440
Autor/Autorin
Fritz Bartel
Übersetzung
Felix Kurz, Utku Mogultay
Illustrationen
13 Abbildungen
Verlag/Hersteller
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Abbildungen
13 Abbildungen
Gewicht
712 g
Größe (L/B/H)
217/146/37 mm
ISBN
9783868544022
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
» Was das außerordentlich gut recherchierte Buch auszeichnet, ist [Bartels] parallele Analyse der Art und Weise, wie die Krise im demokratischen Westen und im autoritären Osten gehandhabt wurde und wie sie schließlich zum Ende des Kalten Krieges und zum Fall des Kommunismus führte. « Branko Milanovi
»Kühn und überzeugend« Adam Tooze
»Kühn und überzeugend« Adam Tooze
 Besprechung vom 11.07.2025
Besprechung vom 11.07.2025
Thatcher wusste eben, wie Perestroika geht
Wo der Osten versagte: Fritz Bartel erzählt das Ende des Kalten Kriegs als Effekt der globalen Finanzmärkte.
Personen und Ideen, so heißt es üblicherweise, haben den Kalten Krieg beendet. Das westliche Modell offener Gesellschaften hätte den kommunistischen Regimen nach und nach die Legitimation entzogen, was herausragende Personen wie Michail Gorbatschow und heldenhafte Zivilgesellschaften wie in der DDR zu nutzen wussten, um Reformen zu erzwingen, die schließlich zur deutschen Wiedervereinigung und zur Auflösung der Sowjetunion führten. Personen und Ideen sind die Schlüsselfiguren solcher Erzählungen schon deswegen, weil der Zusammenbruch des Warschauer Pakts, dieses Großereignis des zwanzigsten Jahrhunderts, dadurch den Charakter einer sinnstiftenden politischen Erzählung erhält.
Der in Texas lehrende Historiker Fritz Bartel zeigt in seiner Studie "Gebrochene Versprechen" jetzt, dass man dieselbe Geschichte auch aus einem anderen Blickwinkel erzählen kann. Nicht Personen und Ideen beherrschen bei ihm die Bühne, sondern die Geldströme der globalen Finanzmärkte. Eine Episode kurz vor dem Mauerfall veranschaulicht diesen Perspektivwechsel: Als im Februar 1989 die polnische Führung beschloss, sich mit der Opposition an den berühmt gewordenen Runden Tisch zu setzen, spielte nicht nur der Druck auf der Straße und die mangelnde Unterstützung seitens der Sowjetunion eine wichtige Rolle. Unmittelbar vorangegangen waren Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds, der dringend benötigte Finanzhilfen nur unter der Kondition versprach, dass Polen schmerzhafte Wirtschaftsreformen in Gang bringen würde, die auf eine substanzielle Senkung des Lebensstandards der Bevölkerung hinausliefen.
"Die Aussicht auf westliche Finanzhilfen war", wie Bartel schreibt, "der Schlüssel, um den hartnäckigen Widerstand des Parteiapparats zu überwinden." Denn um solche drastischen Einschnitte zu legitimieren, war eine indirekte Beteiligung der katholischen Kirche und vor allem der Gewerkschaft Solidarnosc an der Regierungspolitik unumgänglich. "Der Hauptzweck der Gespräche am Runden Tisch", so zitiert Bartel einen Vertreter des polnischen Finanzministeriums Anfang Februar 1989, "besteht darin, ein politisches Zugeständnis zu machen, um die Implementierung der wirtschaftlichen Pläne der Regierung zu fördern." Die demokratische Machtübernahme in Polen, so die Pointe des Buches, war Nebeneffekt eines IWF-Programms der Schuldenrestrukturierung. Die sozialistische Führung suchte nach demokratischer Legitimation, um ihr Sparprogramm durchzusetzen.
Eine ähnliche Gemengelage macht Bartel auch beim Mauerfall und der Rücknahme der Breschnew-Doktrin aus, die eine Intervention der Sowjetarmee für den Fall vorsah, dass Aufstände den Fortbestand des Sozialismus gefährdeten. In beiden Fällen war es die notorische Suche nach Haushaltsmitteln und Devisen, die den Weg zum Ende des Kalten Krieges ebnete. Detailgenau schildert das Buch, wie stark etwa die DDR-Führung im Vorlauf der Grenzöffnung davon motiviert war, an westliche Finanzhilfen zu kommen, um einen Staatsbankrott abzuwehren. Fast alle Parteiapparate im Osten, so Bartel, waren spätestens seit den Achtzigerjahren pausenlos auf der Suche nach neuen privaten oder staatlichen Kreditgebern, mit deren Hilfe sie die Handelsdefizite ihrer Länder weiter finanzieren konnten. Die friedlichen Reformen und Revolutionen, die den Kalten Krieg schließlich beendeten, waren überwiegend entglittene Versuche, den Haushalt zu konsolidieren.
Wie aber kam diese finanzielle Abhängigkeit zustande, die Ende der Achtzigerjahre dann so bedeutende Folgen zeitigte? Bartels Studie ist nicht wegen der Schilderung der - überwiegend bereits bekannten - Finanzierungsprobleme der Ostblock-Regierungen lesenswert, sondern wegen der übergreifenden Erzählung, die eine Antwort auf diese Frage versucht. Noch bis in die Siebzigerjahre konnte von einem dramatischen ökonomischen Ungleichgewicht zwischen West und Ost keine Rede sein. Während des großen Nachkriegsbooms der "industriellen Moderne", so die These des Buches, konkurrierten die kapitalistischen und staatssozialistischen Regierungen miteinander darum, wer das Versprechen eines guten Lebens besser erfüllen konnte. Im Windschatten enormer Wachstumsraten rangen beide Blöcke um die Frage, wer höhere Lohnsteigerungen, weniger Arbeitslosigkeit und ein höheres Konsumniveau zustande bringen würde. Anders als oft behauptet, schnitten die Staaten des Warschauer Pakts in diesem Wettrennen nicht bedeutend schlechter ab. Das Pro-Kopf-Einkommen etwa wuchs mit ähnlichem Tempo wie im Westen.
Die Ursache des Problemkomplexes, der schließlich zum Ende des Kalten Krieges führte, datiert der Autor auf den Herbst des Jahres 1973. Der von der OPEC initiierte Ölpreisschock stellte mit einem Schlag die Grundlage des westlichen wie des östlichen Gesellschaftsvertrags infrage. Die industrielle Massenproduktion von Konsumgütern mitsamt Vollbeschäftigung, Konjunkturpolitik und schnellen Lohnsteigerungen wurde von ihrem wichtigsten Rohstoff, in großer Menge billig verfügbarer Energie, abgeklemmt. Irgendjemand musste die gestiegenen Kosten tragen. Und womöglich war sogar Deindustrialisierung unvermeidbar, um Kapital und Arbeitskräfte in produktivere Sektoren umzulenken - sofern sie dort überhaupt noch Verwendung fanden. Ost wie West standen vor der Frage, wer in der Lage wäre, den wachstumsverwöhnten Massengesellschaften eine solche Hiobsbotschaft zu überbringen.
Von nun an, so Bartel, ging es nicht mehr darum, wer die Versprechen auf ein besseres Leben besser erfüllen, sondern darum, wer sie brechen konnte, ohne die Kontrolle über sein Land zu verlieren. "Regierungen, denen es gelang, ökonomische Disziplin durchzusetzen, ohne eine destabilisierende gesellschaftliche Gegenreaktion herauszufordern, sicherten ihr Überleben; jene, denen dies nicht gelang, brachen zusammen." Zunächst dachte man, dass die autoritären Einparteienstaaten des Ostens bessere Voraussetzungen hätten, ihre Bevölkerungen zu disziplinieren, als die demokratisch gewählten Regierungen des Westens. Doch schon in den Achtzigerjahren zeigte sich, dass das genaue Gegenteil stimmte.
Im Westen gewannen Thatcher und Reagan mit dem Versprechen Wahlen, die unpopuläre Dauerinflation zu beenden - auch wenn dies bedeutete, die Macht der Gewerkschaften zu brechen und Massenarbeitslosigkeit herbeizuführen. Im Osten dagegen spielten die Regierungen auf Zeit. Sie versuchten, ähnliche Sparkurse so lange wie nur möglich zu vermeiden - auch wenn dies bedeutete, wiederholt neue Auslandsschulden aufzunehmen. Auch Bartels Erklärung für diese Differenz ist überzeugend: Während man im Westen auf die Gesetze des Marktes und die Eigenverantwortung des Individuums verweisen konnte, um Einschnitte zu rechtfertigen, stand im Osten kein analoges ideologisches Vokabular zur Verfügung.
"Der Kommunismus ergab in einer solchen Ära der sozialen Einschnitte keinerlei Sinn mehr" - denn die einzige Legitimationsquelle der staatssozialistischen Parteien bestand darin, die weltgeschichtlichen Interessen des Proletariats zu vertreten. Eine marktwirtschaftliche Schocktherapie konnte folglich nur im Westen gelingen. Dies gab man hinter verschlossenen Türen sogar neidvoll zu: 1987 berichtete der sowjetische Generalsekretär seinen Genossen im Politbüro, Thatcher führe erfolgreich jene "Perestroika" durch, mit der man selbst noch hadere. Der Preis ihrer Vermeidung waren angehäufte Staatsschulden und, als dieser Weg nicht mehr beschritten werden konnte, die Beteiligung der Opposition an den Staatsgeschäften, um einen verspäteten Austeritätskurs doch noch zu legitimieren.
Wie jedes Geschichtswerk hat auch dieses seine blinden Flecken: Zu stark scheinen etwa stellenweise die Kreditmärkte das Handeln der Akteure zu determinieren; das Handeln der gegen das Regime aufbegehrenden Demonstranten wird abgedimmt, um dem ökonomischen Erzählstrang den nötigen Platz zu verschaffen. Und dennoch ist das Ergebnis der Studie zugleich äußerst interessant und irritierend: In der Tat brach, wie es im Buch heißt, mit dem Jahr 1990 eine "Ära der Volkssouveränität und Selbstbestimmung" an. Doch souverän wurde das Volk deswegen, weil nur so seine Unterordnung unter die Gesetze des Finanzkapitals erreicht werden konnte. "Das Ende des Kalten Krieges", so heißt es bei Bartel überspitzt, "war der Moment, in dem die Macht des Volkes ihren Höhepunkt erreichte - und zugleich überwunden wurde."
Die liberale Demokratie ging aus dem Kalten Krieg als Siegerin hervor. Allerdings nicht, weil sie imstande war, die Hoffnungen und Träume der Regierten zu erfüllen, sondern weil sie vermochte, gegen die Versprechen ökonomischer Sicherheit und sozialen Fortschritts weiter zu regieren. Gut möglich, dass sich auf diese Weise auch die Entwicklung seit dem Ende des Kalten Krieges besser verstehen lässt. Womöglich ist die Politik der gebrochenen Versprechen nun auch im Westen an ihr Ende gekommen: Vielleicht lassen sich keine Wahlen mehr mit der Botschaft gewinnen, dass man den Gürtel enger schnallen muss, weil die Kreditlinien ausgeschöpft und die Steuern zu hoch sind, um substanzielle Versprechen auf ein besseres Leben einzulösen. Doch was dann? Wie Bartel zeigt, ging ein Weltreich an dieser Frage zugrunde. Ein zweites könnte folgen. OLIVER WEBER
Fritz Bartel: "Gebrochene Versprechen". Das Ende des Kalten Krieges und der Aufstieg des Neoliberalismus.
Aus dem Englischen von F. Kurz und U. Mogultay. Verlag Hamburger Edition, Hamburg 2025. 440 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Gebrochene Versprechen" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









