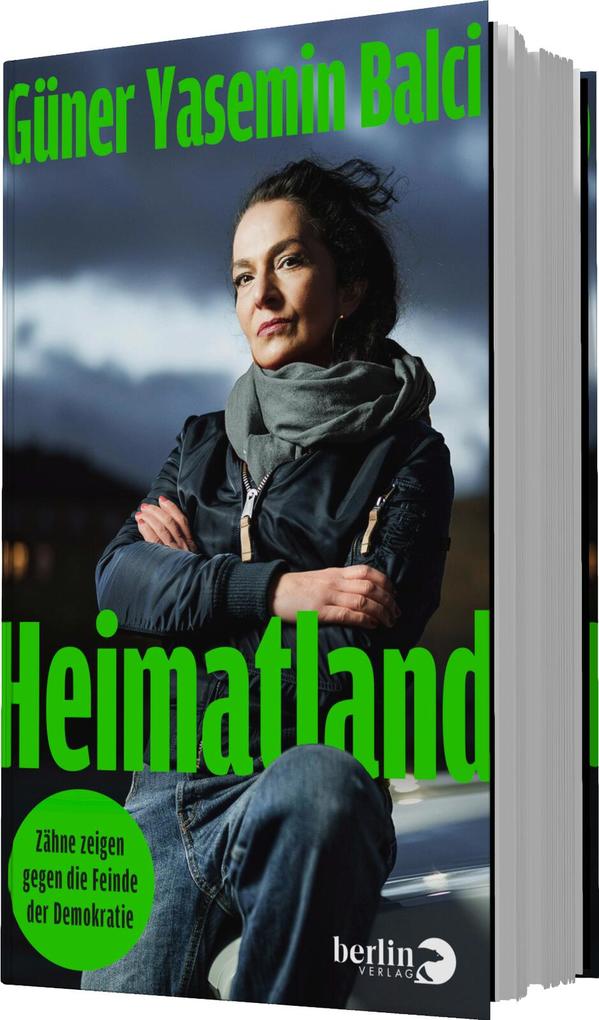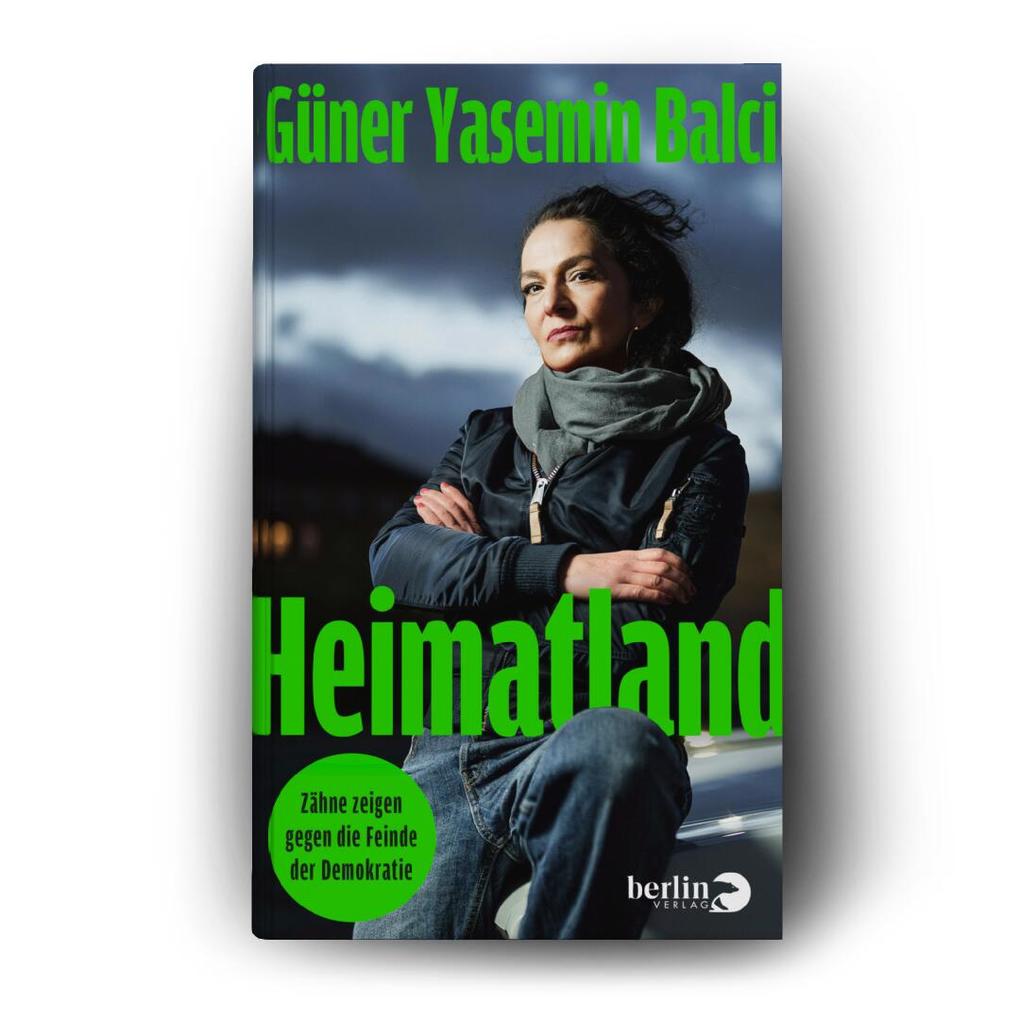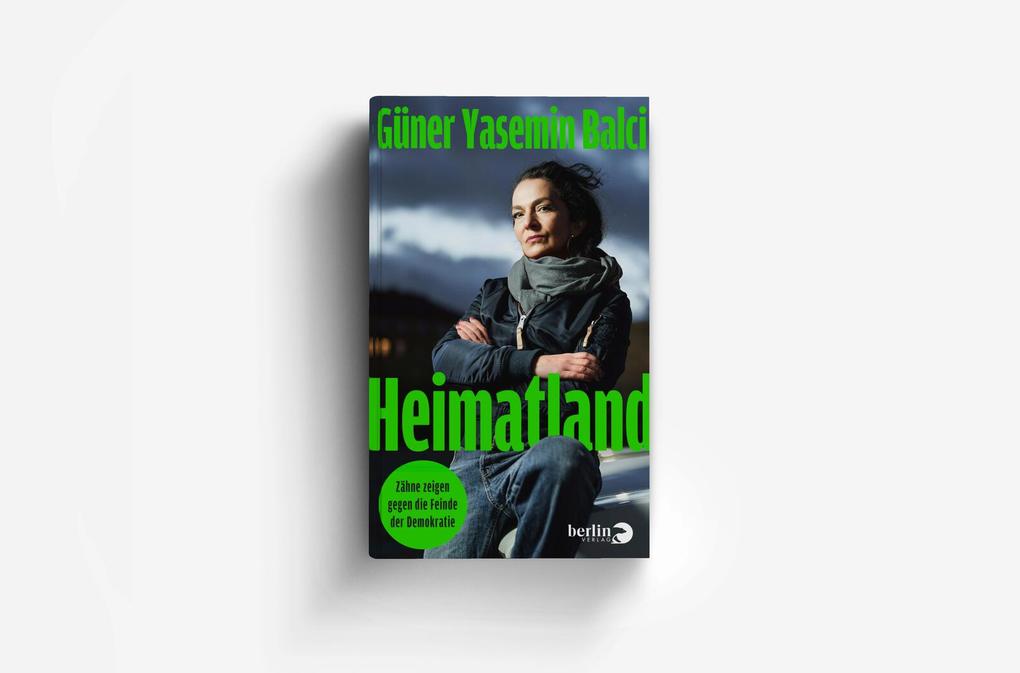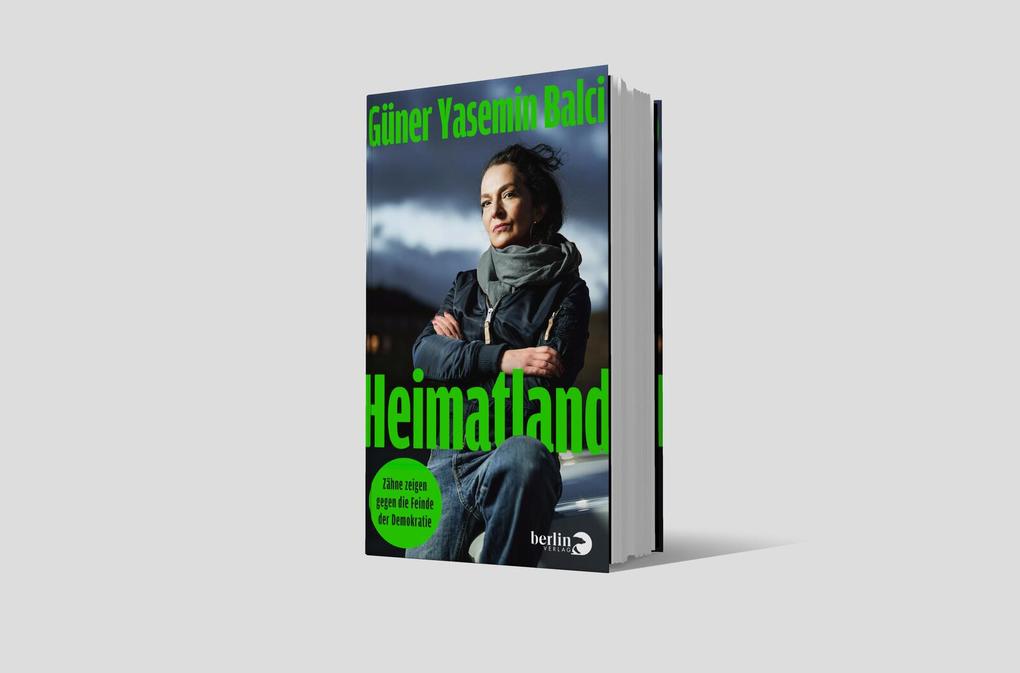Besprechung vom 27.09.2025
Besprechung vom 27.09.2025
Kindheit voller Optionen
Leichter Ton, klare Gedanken: In einer Art Autobiographie zeichnet Güner Yasemin Balci ein scharf konturiertes Bild vom Leben in Neukölln und warnt vor einem Rassismus der niedrigen Erwartungen.
Güner Yasemin Balci - Journalistin, Schriftstellerin, Filmautorin, seit 2020 Integrationsbeauftragte für Berlin-Neukölln - ist einer der klarsten politischen Köpfe unseres Landes. Sie hat ein Buch mit dem Titel "Heimatland" (Berlin Verlag, 24 Euro) geschrieben. Das Buch beschreibt ihren Blick auf Neukölln, einen Teil Deutschlands, in dem sich einige Probleme dieses Landes mit sehr scharfen Konturen zeichnen, und sie beschreibt ihren Lebensweg, der sie befähigt hat, diese Konturen auch scharf zu sehen.
Das Buch passt in kein Klischee, auch in kein Genre. Obwohl es eine Autobiographie zu sein scheint. Güner Yasemin Balci schreibt aus ihrem Leben, und sie schreibt - in leichtem Ton, in freundlichen Worten, in klaren Gedanken - ein Resümee eines Lebens nicht zwischen, sondern in vielen Kulturen, Milieus, Erfahrungswelten.
Das Buch beginnt wie eine Idylle: "Mein Heimatland sind tanzende Schneeflocken im Scheinwerferlicht einer stürmischen Winternacht." Wo diese Schneeflocken sind, erfahren wir nicht gleich. Es könnten Schneeflocken auf einer Fahrt in den Teil Anatoliens gewesen sein, aus dem ihre Eltern vor Jahren gekommen sind, "da gab es offensichtlich schneebedeckte Berge, reißende Flüsse, abenteuerliche Landschaften". Waren es nicht, es waren Schneeflocken aus Neukölln, genauer aus dem dortigen Rollbergviertel, dem Balci beinahe schwärmerische Erinnerungsbilder widmet. Beinahe, auf den ersten Leseblick. Nein, keine Idylle, eine komplexe Kindheit in einer komplexen, anstrengenden Umgebung, die aber eines ist: ein Geflecht von Optionen.
Zunächst: zu viele Kinder auf einem Schlitten, "vollaufgedrehte Autoradios mit Django-Reinhardt-Musik, Brigitte Mira und Harald Juhnke, Fernsehabende mit Hans Rosenthal, während im Radio Orhan Gencebay Saz spielt". Haben Sie was gemerkt? Django Reinhardt, ein Sohn elsässischer Sinti, Brigitte Mira, die 1941 als Halbjüdin in die "Gottbegnadetenliste" aufgenommen wurde (eigentlich zur Deportation Vorgesehene, die man aber auf der Bühne nicht missen mochte), Harald Juhnke, der Liebling aller Bundesdeutschen, Hans Rosenthal, der Jude, der die Jahre vor 1945 nur im Versteck überleben konnte, auch er Liebling aller Bundesdeutschen, Orhan Gencebay, Sänger, Schauspieler, Saz-Virtuose (und Mitglied einer von Erdogan einberufenen Kommission zur Verständigung mit der PKK). Güner Balci schreibt unprätentiös, auf keine Pointierung hin, aber ihre Sätze sind voller Pointen.
Eine anstrengende Kindheit voller Optionen. Optionen haben bedeutet Freiheit. Nur muss man sie auch so wahrnehmen können, sonst sind sie verwirrend oder beängstigend und wecken den Wunsch nach Schutz, Beschränkung, Enge. Der Vater kam aus Pülümür, einem Ort im östlichen Drittel der Türkei, er wollte dort nicht bleiben, wollte, man wird es so einfach sagen dürfen: ins Freie, haute ab, schlug sich bis und in Istanbul durch - ein wohlhabender jüdischer Geschäftsmann hilft ihm dabei, prägt seinen Blick auf die Welt; schließlich fährt er nach München, dann nach Berlin. Auch sein Bruder macht sich auf die Reise, mit Frau und Kind. Versehentlich steigen sie auf freier Strecke aus, der kleine Sohn wird von einem Zug überfahren. Ein Freund mag Deutschland nicht, emigriert nach Australien. Der Vater bleibt, ist angekommen, fühlt sich am richtigen Ort. Die Mutter kommt nach, irgendwann trennt sich das Paar, die Mutter sorgt für die Kinder.
Optionen muss man wahrnehmen können. Und wollen. Der Vater tut das, auch wenn ihm am Ende ein großer Wunsch, der nach einem eigenen Garten, nicht recht geraten will; die Mutter tut es, als sie in Deutschland ankommt, spricht sie weder Türkisch noch Deutsch: Die Balcis sind Aleviten, ihre Sprache ist Zazaki, Deutsch und Türkisch lernt sie am Fließband einer Papierfabrik. Beide können nicht gut schreiben, doch beide haben bei Elternabenden ein Notizbuch dabei, und beide haben ein Ziel für ihre Kinder: "Eure Hände sollen Stift und Papier halten, nicht den Wischmopp!"
Die Eltern der Kinder, mit denen Güner Balci aufwächst, kommen von überallher, Herkunft, Religion spielen, wie man liest, eine geringere Rolle als Klassenzugehörigkeit. Eine Schulkameradin hat Eltern, die Lehrer sind, das Geburtstagsfest bei ihr wird zu einer Erfahrung eigener Art: Ein eigenes Zimmer hat sie (mit Schaukel!), sie bekommt Geschenke (Spielzeug!), nicht bloß Wollsocken. Die kleine Güner bittet den Vater, ihr auch ein Geburtstagsfest zu schenken, und der versucht es, spricht vor dem Schultor andere Eltern an, tut es unbeholfen - und niemand kommt. Wir lesen viele solche Geschichten, solche und auch andere, wie dass die Verfasserin als Teenager bei einem Prince-Konzert auf die Bühne springt und ausgelassen tanzt. Balci mischt Geschichten zum Mosaik einer Welt des Aufwachsens in einer Welt, die für den Verfasser dieser Rezension fremd ist - und vermutlich für die meisten Leserinnen und Leser dieser Zeitung auch. Aber exotisch ist da nichts; eben bloß anders. In vielfacher Hinsicht.
Es treffen unterschiedliche kulturelle Muster aufeinander, es kreuzen sich dramatisch unterschiedliche Lebenswege. Man liest verblüfft davon, wie viele verschiedene Erfahrungen in ein junges Leben hineinpassen. Balci schreibt klar, unsentimental, Freundliches, Erfreuliches, Erschütterndes nebeneinander, wie es im Leben nebeneinander geschieht. "Ich habe gesehen, wie Menschen sich kleinmachen lassen und wie Menschen zerstört werden. Ich habe Kinder aufwachsen sehen bei Eltern, die schon morgens zur Flasche griffen. Bei manchen war klar, dass sie bereits vor der Geburt zu viel von dem Zeug abbekommen hatten und die bleibenden Schäden sie daran hindern würden, jemals ein normales Leben zu führen.
Bei anderen staunte man, welch kluge und fürsorgliche Kinder aus den schlimmsten Haushalten kommen konnten." Das Buch spricht von dem, was täglich geschieht - "... weil ein Schrank umgekippt und auf einen Säugling gefallen war", heißt es wie nebenbei -, und von dem, was geschehen könnte - der Fünfzehnjährige, der den Auftrag erhält, seine ältere Schwester zu ermorden, weil sie die Familienehre beschmutzt habe, und sie rettet. Die Lakonik der Formulierungen macht, dass das, was erzählt wird, im Lesenden von selbst nachhallt.
Wenn ein türkischer Freund plötzlich sagt, Aleviten seien Verräter an der Nation, wird deutlich: Die Balcis sind in kultureller, sprachlicher, religiöser Hinsicht Teil einer Minderheit der Minderheit. Balci schreibt über die historischen Schatten, unter denen unsere gemeinsame Welt liegt. Der Mord an den europäischen Juden - und der endemische und der importierte Antisemitismus -, der Mord an den Sinti und Roma - und die vorurteilslose Mutter, die hier an ihre Grenze kommt: Die Nachricht, dass ihre Tochter einen "Zigeuner" als Freund habe, bringt sie mit Bluthochdruck in die Notaufnahme -, das Bild von Kemal Atatürk an der Wand, vom Vater mit Pfauenfedern verziert: "Er hat der Türkei die Moderne verschafft, den Frauen die Freiheit!" Atatürk hatte 1936 eine ethnische Säuberung ("Züchtigung und Deportation") durchführen lassen, die Zehntausende Aleviten das Leben kostete. 1993 zünden fanatische Sunniten vor laufenden Kameras ein Hotel an, in dem sich Teilnehmer an einem kulturellen Festival im Andenken an einen im 15. Jahrhundert von der osmanischen Herrschaft hingerichteten alevitischen Dichter versammelt hatten und verbrannten. Vergangenheiten und Gegenwarten, Vergewaltigungen auf dem Tahrir-Platz und in Köln, Hamburg und anderswo.
Das Buch ist die Geschichte eines Gelingens. Die Minderheit einer Minderheit zu sein ist eine Schwierigkeit eigener Art - aber auch ein Beobachtungsposten eigener Art, wenn man ihn zu nutzen weiß. Balci gibt in diesem Buch Auskunft über das, was sie als Kind, als Heranwachsende erlebt und gesehen hat, was sie nun - als Integrationsbeauftragte in Neukölln - sieht. "Neukölln ist ein Ort, an dem globale Konfliktthemen wie im Brennglas wahrgenommen werden können. Vieles, was das Land bewegt, hat hier einen Echoraum und Tiefenwirkung. Kein Ort in Deutschland hat mehr Kontroversen um integrationspolitische Prozesse entfacht als dieser, nirgendwo sonst in der Republik gibt es eine so lange unaufgeregte Tradition, sich den öffentlichen Debatten über eine Einwanderungsgesellschaft zu stellen."
Das Buch ist ein Lob der (um die klassische Formel zu verwenden) offenen Gesellschaft, ihres Heimatlands Deutschland. Und es ist eine Warnung vor den Feinden der offenen Gesellschaft: Fundamentalismen aller Arten, Misogynie, Männlichkeitsirresein, Antisemitismus - und auch wohlwollender Kulturrelativismus, der oft auf eine "devote Haltung gegenüber Reaktionären" hinausläuft. Man merke sich den Ausdruck: der "Rassismus der niedrigen Erwartungen". JAN PHILIPP REEMTSMA
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.