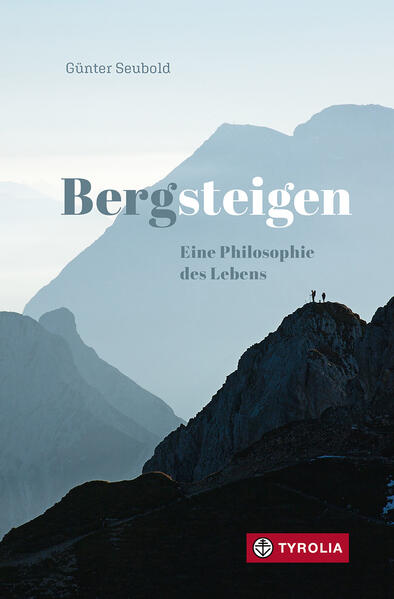
Produktdetails
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
TheoPhil
" ein leicht verständliches Buch, das man gerne in der Hand hat, ja vielleicht sogar fast verschlingt. [ ] also quasi ein Must have für alle, die die Berge lieben und gedanklich etwas tiefer in sie einsteigen wollen."
Reisefüher Wanderbücher Blog
"Der emeritierte Philosophie-Professor Günter Seubold hat mit diesem Werk eine höchst subjektive , aus seinen eigenen Bergtouren gewonnene Philosophie des Bergsteigens niedergeschrieben."
aplinwelt
 Besprechung vom 20.07.2025
Besprechung vom 20.07.2025
NEUES REISEBUCH
In geistigen Höhen
Bergsteigen sei mehr als eine Freizeitbeschäftigung, schreibt Günter Seubold, "Bergsteigen ist Leben in konzentrierter Form, und zwar ein Leben in und mit der Welt und nicht bloß gegen die Welt". Das ist die Ausgangslage, auf der Seubold - passionierter Bergsteiger und habilitierter Philosoph, Germanist und katholischer Theologe - sein Buch aufbaut.
Diese unabdingbare Voraussetzung wird vom Autor nicht infrage gestellt. Was aber logisch ist, für Bergsteiger. Neigen doch gerade sie dazu, ihren Sport zu überhöhen, was man so vom Golfen vielleicht nicht sagen kann. Beim Bergsteigen zähle nicht der Rekord, sondern die Art und Weise des Tuns, so Seubold. Ein bisschen Namedropping betreibt er aber auch, in die philosophischen Betrachtungen fließen Passagen über seine Aufsteige ein, und da müssen es dann schon das Matterhorn, der Biancograt, die Watzmann-Ostwand und der Fuji sein. Doch welcher Berg auch immer, wenn man ihn bestiegen hat, so schreibt er, wird dieser zu einem Teil der eigenen Biographie.
Zunächst betrachtet Seubold das reine Gehen, auch als Über-sich-Hinausgehen. Dann geht es in die Vertikale, mit dem Einsatz der Hände, denn der Mensch sei das Tier, das denken und zwei Hände gebrauchen kann. Dabei gelte, vor allem in der Vorbereitung, der Leitsatz "Respice finem", also das Ende immer im Blick zu haben. Denn wie sagte schon der andere Bergphilosoph Hans Kammerlander: Ein Gipfel gehört dir erst, wenn du wieder unten bist.
Seubold beleuchtet viele Aspekte, betrachtet die ökologische und ökonomische Seite, blickt auf Kontrastierung und Askese, um aber immer wieder zu dem Schluss zu kommen: Das Einswerden mit der Umgebung, der Umwelt, gehöre zu den höchsten Glücksmomenten des Lebens. "Ein Glück, das einem nicht mehr genommen werden kann."
Er setzt sich allerdings auch mit dem Hadern auseinander. "Warum das Matterhorn besteigen, warum sich den Strapazen, der Gefahr aussetzen? - Ja, wenn man das nur wüsste!" Da zitiert er Ingeborg Bachmann: "Erklär mir, Liebe, was ich nicht erklären kann." Denn erklären kann man es nicht, der einzige Grund des Bergsteigens sei: Ich will den Berg besteigen.
Manches Argument klingt nach Vorwärtsverteidigung, obwohl doch Leser, die dem Bergsteigen nahestehen, selten widersprechen würden. So gerät Seubold in einen Zirkelschluss, wenn er schreibt, Bergsteigen gewähre sinnliche Erlebnisse, die nicht vergleichbar seien mit Sportarten wie Reiten oder Radfahren - weil Bergsteigen mehr sei als eine Sportart. Es ist sinnlich - weil es sinnlich ist. Und er versteigt sich in eine gewagte Aussage: Wer für das Spirituelle im Bergsteigen nicht offen sei, so der Theologe, degeneriere das Tun zum "Turnen an der Wand und zum bloßen Spaß-haben-Wollen".
Dieser Hedonismus-Vorwurf ist natürlich Unsinn, als wäre zu tiefen Gedanken nicht fähig, wer nicht auch in geistigen Höhen wandelt. An anderer Stelle behauptet er, das "Staunen über das Erhabene der Bergwelt, die Hingerissenheit, Entzücktheit, Ekstase bei einem Sonnenaufgang" sei eine "kosmisch-spirituelle Dimension des Bergsteigens". Auch das folgt dem Irrglauben, Atheisten und Naturwissenschaftler seien zu tiefen Empfindungen auf den hohen Gipfeln nicht in der Lage.
Einhellig zustimmen werden wohl alle, die selbst auf Berge steigen, bei Seubolds Fazit: Bergsteiger gehen nicht in die Berge, weil sie lebensmüde sind, sie gehen in die Berge, weil sie das Leben lieben und mit jeder Bergtour das Leben bewusster erleben. Barbara Schaefer
Günter Seubold: Bergsteigen - Eine Philosophie des Lebens. Tyrolia-Verlag, Innsbruck 2025
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.










