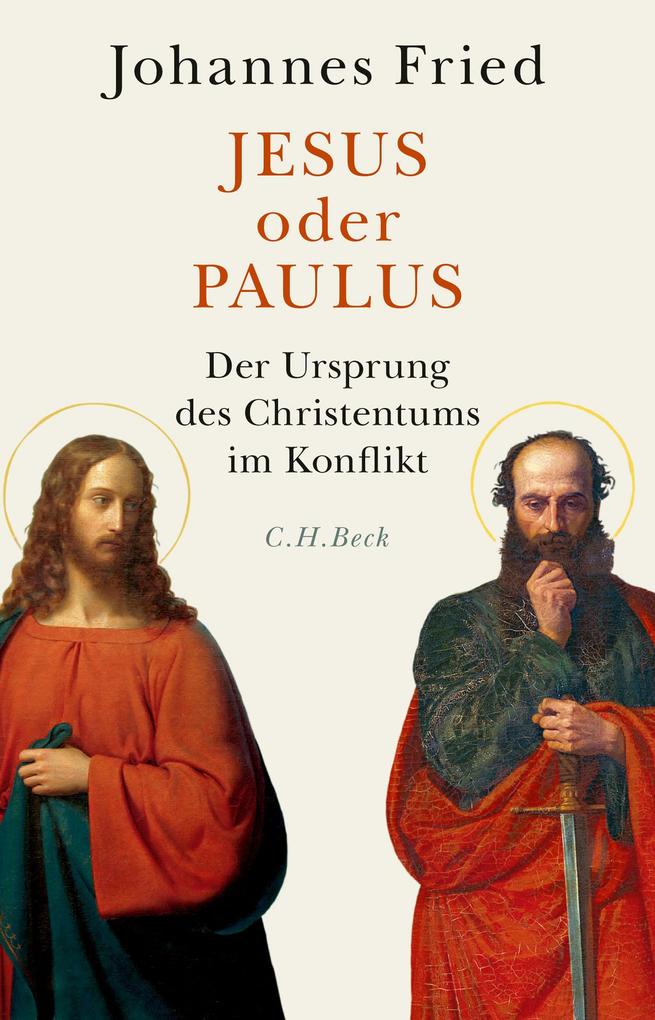Besprechung vom 19.03.2021
Besprechung vom 19.03.2021
Ein Auferstandener lässt sich doch nur fälschen
Auf gnostischen Spuren: Der Historiker Johannes Fried nimmt sich in seinem zweiten Buch zur Frühgeschichte des Christentums die Mission des Paulus vor
Auf das Gerippe reduziert, ist die These dieses Buchs nicht neu: Der Aramäisch sprechende jüdische Wanderprediger Jesus von Nazareth, den manche für den Messias hielten und der in Jerusalem als Aufrührer hingerichtet wurde, hätte kaum Kristallisationskern eines neuen, sich rasch über die ganze Welt verbreitenden, von den Gläubigen mit seltener Inbrunst vertretenen Bekenntnisses werden können. Er vermochte dies nur in seiner paulinischen Gestalt, als vom Tode Auferstandener, an dessen Heilsversprechen alle Menschen teilhaben sollten; deswegen verzichtete diese Mission auf den Umweg über das strenge Judentum und richtete sich in griechischer Sprache auch an Adressaten, die religiös anders sozialisiert und durch die Idee eines Mensch gewordenen, am Ende den Tod überwindenden Gottessohnes zu gewinnen waren.
Johannes Fried räumt dies ein, wenn er rhetorisch fragt, wie sich das Christentum und seine Kirchen ohne den Stimulus realer Todüberwindung ihres Herrn neben den zahlreichen anderen Glaubensangeboten hätten behaupten können. Das Problem verschärft sich noch, da der gelernte Mediävist an der in seinem früheren Buch "Kein Tod auf Golgatha" (F.A.Z. vom 13. März 2019) dargelegten Ansicht festhält, Jesus sei damals gar nicht gestorben. Vielmehr hätten das Auspeitschen und das Hängen am Kreuz bei ihm einen hämorrhagischen Pleuraerguss hervorgerufen, in dessen Folge Atemnot und schließlich eine Kohlendioxid-Narkose eintraten. Der Lanzenstoß in die Seite ließ jedoch Blut und Wasser abfließen, was die Lunge entlastete. Der für tot Gehaltene sei für die Bestattung versorgt worden - Druckverband und Eiterkanülen waren durchaus bekannt - und konnte so überleben. Danach habe er sich in einem Exil verborgen, dort noch zu und mit einigen Anhängern gesprochen, die das jedoch ebenfalls für sich behalten mussten. Irgendeine Wirkung konnte von dem pensionierten Prediger nicht mehr ausgehen; er "musste machtlos und schweigend seine Vergöttlichung hinnehmen".
Ob Fried diese Version der Geschichte "auf der Suche nach dem, was war, nicht nach dem, was wir aufgrund jahrtausendealter Gewöhnung erwarten und wünschen, dass es gewesen sei", überhaupt braucht, ist nicht recht ersichtlich. Denn auch die Überlieferungen zu Jesu Worten und Taten vor Golgatha hält er für völlig unzuverlässig und Produkte einer Zeit, als sich die Vorleute der Jesusbewegung heftig um den wahren Meister stritten und nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 (nicht 73, wie an einer Stelle angegeben) der jüdische Kontext der Ereignisse rasch verdampfte. "Jesu schlichtes Leben" verlor sich so "weithin spurenlos in Raum und Zeit".
Dem selbstbewussten Historiker kommt zupass, dass der in Jahrhunderten geformte Konsens theologischer Forschung von außen inzwischen leicht als konventionelles Konstrukt abgetan werden kann und längst nicht mehr fest gemauert in der Erden steht. Man fragt sich auch, auf welche Epoche sich sein Ausbruch bezieht, immer noch werde "geächtet, diskriminiert und ausgestoßen", wer "die Lehrmeinung irgendwelcher kirchlicher Obrigkeiten nicht fraglos hinnimmt" - die Kirchen hierzulande in unserer Zeit, denen das Dogma zum Fremdwort geworden ist, kann er jedenfalls nicht ernsthaft meinen. Was aber auch einem wohlwollenden Leser sauer aufstößt, ist ein alles durchwirkender modischer Konstruktivismus, gestützt auf das alte Steckenpferd des Autors, die Gedächtnisforschung: Wenn eine Geschichte "vollends im Fluss immerzu fortfließender, nie ruhender Erinnerungen" verläuft, erscheint es erlaubt, ja zwingend, die Überlieferung in ihre tatsächlichen und vermeintlichen Bausteine zu zerlegen, um diese neu zu gewichten und am Ende ganz anders als üblich zusammenzusetzen. Die synoptischen Evangelien stehen dann auf einmal als spät zu datierende, theologisch zusammengestoppelte Elaborate da, während ein anonymes Proto-Evangelium, das Markion mitbrachte, sowie das Johannes-Evangelium mit dem Passionsbericht des namenlosen Lieblingsjüngers (Lazarus?) als glaubwürdigere Steinbrüche vorgestellt werden.
Frieds Paulus wusste von Jesus sowie dem Geschehen vor und nach Golgatha nicht das Geringste, sondern berief sich einzig auf seine eigene visionäre Erfahrung des Auferstandenen, des übermenschlichen, gottgleichen und von Gott gesandten Christus. Erst die durch ihn verheißene Erlösung habe für den Erfolg gesorgt und jenen, die mit Details zu Jesu Leben und Lehren aufwarteten, rasch den Rang abgelaufen. Man sieht zunächst nicht recht, wie Fried Paulus beurteilt. Mit ihm habe sich das Christentum gespalten, durch seine Teilnahmslosigkeit gegenüber dem Geheimnis von Kreuzigung, Grab und Überleben sei "die lebendige Wirklichkeit und das authentische Wissen der Jünger" überwältigt worden (das der Autor aber wenige Seiten zuvor noch so eindringlich dekonstruiert hat) - doch nur Paulus' Weg führte "aus der Schau zum unaufhaltsamen Welterfolg, der andere aus dem Leben zu einem allmählich dahinsiechenden Ende". Ein auf Authentizität gepolter Zeitgeist wird andererseits vielleicht das "bodenständige, aramäisch geprägte Judentum" dem hellenistisch geprägten Theologiekonstrukt des einstigen Christenverfolgers Paulus vorziehen, der mit seinem "Visionsevangelium" Zwietracht gesät, eine "Sprache des Hasses" gepflegt und einen "ungeheuerlichen Exklusivitätsanspruch" vertreten habe.
Soll das mephistophelische Dialektik sein? Die bald zweitausend Jahre andauernde, durchaus mühsame und an Umwegen reiche theologische Konsensbildung verdecke die historische Wahrheit, während sich das werdende Christentum Fried zufolge zu Beginn in immer tieferen Spaltungen verlor. Welche Wahrheit soll hier wen frei machen - und wozu?
Gegen Ende offenbart Fried dann doch noch den Kern seiner Agenda: Das Thomas-Evangelium lasse in Jesu authentischen Worten gnostische Lehren aufblitzen, "keine Offenbarung, sondern Selbsterkenntnis als Erkenntnis des Gottessohnes im eigenen Ich". Das sei natürlich vertuscht und unterdrückt worden, während parallel der historische, jüdische Jesus im Sinne paulinischer Theologie zum Übermenschen und göttlichen Wesen umgemodelt wurde. Am Ende stand (neben der Entrechtung der Frauen, die unter und nach dem Kreuz noch so eine große Rolle gespielt hatten) die Königsherrschaft Gottes; mit ihr war der Mensch "allein Gott unterworfen; der Weg nach innen, zur Freiheit, zur alten, in der Schöpfung angelegten Gottgleichheit war versperrt". Also eine verlorene Aufklärung in ihrer prometheischen, gar faustischen Variante. - Karl Christ, der langjährige althistorische Rezensent dieser Zeitung, hätte dieses Alterswerk wohl als ein "sehr persönliches Buch" bezeichnet.
UWE WALTER.
Johannes Fried: "Jesus oder Paulus". Der Ursprung des Christentums im Konflikt.
C. H. Beck Verlag, München 2021. 200 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.