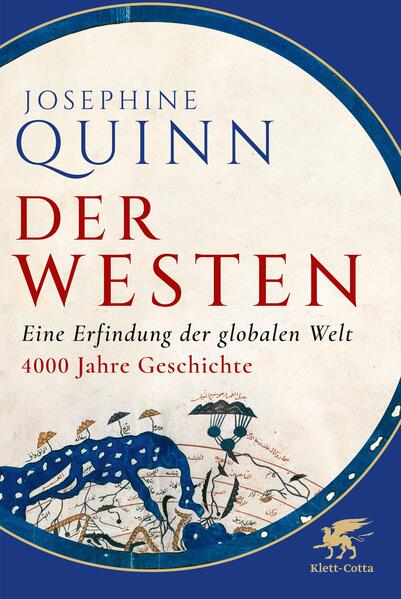Besprechung vom 23.12.2025
Besprechung vom 23.12.2025
Hat es den Westen nie gegeben?
Josephine Quinn tadelt das Denken in Kulturen, stößt aber an die Grenzen des Dekonstruierens.
In der Stunde seiner Gefährdung wird der Westen wieder viel beschworen. Gegen die Bedrohung von innen (Trump) und von außen (Putin) wollen gerade auch linksliberale Politiker und Kommentatoren die westlichen Werte verteidigen, während Konservative unter Berufung auf eine schützenswerte europäische Zivilisation für ein hartes Grenzregime eintreten. Doch was, wenn der Westen, der hier bewahrt werden soll, in Wahrheit eine Chimäre ist?
Für Josephine Quinn ist die Rede von "westlichen Werten" ein typisches Beispiel von civilisational thinking. Das "kulturalistische Denken", wie es in der deutschen Übersetzung heißt, teilt die Welt demnach in verschiedene Kulturkreise auf, die mehr trenne als verbinde und die in der Geschichte häufiger gegen- als miteinander agiert hätten. Mit ihrem fulminanten Buch möchte Quinn, Professorin für Alte Geschichte an der Universität Cambridge, dieses Denken überwinden und die Existenz abgrenzbarer Kulturen grundsätzlich hinterfragen ("Der Westen: Eine Erfindung der globalen Welt").
Vor allem richtet sich ihre Kritik gegen die Idee des Westens. "Eine einzigartige, reine westliche oder europäische Kultur" habe es nie gegeben, postuliert sie gleich zu Beginn: "Die Werte, die wir heute westlich nennen - Freiheit, Rationalität, Gerechtigkeit und Toleranz - sind nicht allein und ursprünglich westlich; und der Westen selbst ist zum großen Teil Produkt langjähriger Verbindungen zu einem weit größeren Netz aus Gesellschaften; im Süden und Norden ebenso wie im Osten." Um diese Thesen zu untermauern, präsentiert Quinn eine alternative Geschichte des Westens, eine Vernetzungsgeschichte, die zeigen soll, wie stark die Gesellschaften des Mittelmeerraums seit jeher von wechselseitigem Austausch geprägt worden sind.
Anfangs ist das ein ebenso willkommener wie inspirierender Perspektivwechsel. Denn während die Geschichte an Universitäten noch heute meist mit der Entstehung der griechischen Schrift im 8. Jahrhundert vor Christus beginnt, setzt Quinn mit dem Aufkommen der Segelschifffahrt fast 2000 Jahre vorher ein. So erfährt man, dass das älteste erhaltene Gesetzbuch der Welt um 2100 im mesopotamischen Ur entstand und babylonische Gelehrte den "Satz des Pythagoras" 1000 Jahre vor Pythagoras formulierten. Grabbeilagen in Mykene belegen die weitreichende Vernetzung der angeblich prähistorischen Welt ebenso wie Korrespondenzen zwischen Königen, die im ägyptischen Amarna gefunden wurden.
Doch heißt das auch, dass sich die griechisch-römische Kultur so nahtlos in die Gemeinschaft mediterraner Gesellschaften einfügte, dass von separaten Kulturen kaum die Rede sein kann? Wenn Quinn zum traditionell "klassisch" genannten Altertum kommt, wirkt ihre Perspektive stark verkürzend. Stets betrachtet sie nur die Anfänge griechisch-römischer Entwicklungen, überbetont äußere Einflüsse und verkennt, dass Neuerungen auch durch innere Konflikte, einschneidende Ereignisse oder die Leistungen Einzelner entstehen konnten.
Über die griechische Kunst etwa bemerkt Quinn lediglich, dass die archaischen Kouroi, frühe, noch etwas steife Statuen bartloser Jünglinge, an ägyptische Bildhauertraditionen angeknüpft hätten - und geht nicht auf die weitere Entwicklung hin zu lebensnahen Bildnissen ein, die für die Kunstgeschichte noch entscheidender ist, aber eben nicht einfach auf den Kontakt mit fremden Kulturen zurückgeführt werden kann. Dass die Vorsokratiker von ägyptischem und babylonischem Wissen profitierten, hebt sie zu Recht hervor - verliert aber kein Wort über Sokrates, Platon und Aristoteles, deren Philosophie sich noch viel weniger durch Adaptationen von Altbekanntem erklären lässt, die westliche Denktraditionen jedoch ungleich stärker prägte. Und wenn sie beschreibt, dass es lange vor den Stadtstaaten in Griechenland Formen der Bürgerbeteiligung in der Levante gab, so vermisst man einen Vergleich, der neben Gemeinsamkeiten auch die Unterschiede zwischen diesen politischen Formationen zeigt. Denn das Athen des fünften Jahrhunderts vor Christus mit seinen ausgeklügelten demokratischen Mechanismen hatte tatsächlich nur sehr wenig mit einer zwar nicht absolutistisch, aber doch monarchisch regierten Stadt wie Tyros ein paar Jahrhunderte zuvor zu tun.
Dass sich der Westen im Austausch mit anderen Regionen entwickelte, heißt deswegen noch nicht, dass er an entscheidenden Stellen nicht doch einen eigenständigen Weg einschlug. So zum Beispiel, als die Griechen im frühen fünften Jahrhundert die Perser bei Marathon und Salamis besiegten: Zwar weist Quinn zu Recht darauf hin, dass die Kriege aus persischer Sicht nichts als eine Strafexpedition waren, der die griechischen Akteure mit mehr Opportunismus als Idealismus begegneten. Doch ausgehend von diesen Kriegen und im Rückblick auf sie entwickelten die Griechen eine starke gemeinsame Identität, die Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung betonte und sich gerade auch in Abgrenzung zu den Persern verstand. Dass sich hier Ost und West zu scheiden begannen, wie der Althistoriker Christian Meier einmal sagte, ist deswegen schon wegen der Rezeptionsgeschichte der Schlachten in der Antike plausibel.
Wenn es hingegen Kulturen überhaupt nie gab, dann konnten sie sich auch nicht gegenseitig beeinflussen, dann hätten immer nur kleinere Gruppen aufeinander wirken können. In dieser Hinsicht ist Quinn merkwürdig inkonsequent. Einerseits bestreitet sie vehement, dass "ein Denken in Kulturen überhaupt dazu beiträgt, irgendetwas zu erklären". Doch wenn sie andererseits sagt, dass "persische Frauen" größere Freiheiten genossen hätten als athenische, oder dass Alexander der Große eine "gemischt griechisch-persische Kleidung" getragen habe, dann ergibt beides nur Sinn, wenn "persisch" eine relevante Kategorie ist. Implizit scheint sie also immer wieder anzuerkennen, was sie explizit widerlegen möchte: dass das Denken in Kulturen von heuristischem Wert sein kann, weil es zusammenfasst, was sich in bestimmten Zusammenhängen sinnvoll zusammenfassen lässt, und sei es idealtypisch.
So ist Quinns Erzählung, die ab der römischen Zeit kursorischer wird und um 1500 nach Christus relativ abrupt endet, zugleich ein Lehrstück vom Nutzen und Nachteil jener dekonstruktivistischen Tendenz, die seit Jahrzehnten die Geisteswissenschaften bestimmt. Dass sie immer wieder gewohnte Narrative in Frage stellt, macht ihr Buch zu einer stimulierenden Lektüre. Dass Kulturen keine isolierten, gottgegebenen Einheiten sind, zeigt sie überzeugend. Doch sollte man sie deswegen ganz aus der Geschichte verabschieden? Wenn Grenzen unscharf sind, heißt das nicht, dass das Abgegrenzte gar nicht existiert.
Fragen wie diese stellen sich in verschärfter Form auch heute. Denn wer die Existenz von Kulturen in der Geschichte leugnet, macht es sich auch in der Gegenwart gerne zu leicht. Quinn selbst verbindet ihr Buch in Interviews mit Plädoyers für offene Grenzen: "Menschen daran zu hindern, nach Europa zu kommen, ist ein ethisches Verbrechen." Ob vollkommen offene Grenzen und der damit vermutlich einhergehende Zusammenbruch westlicher Gesellschaften ethisch so vorteilhaft wären, sei dahingestellt. Politisch jedenfalls ist eine solche Forderung illusorisch. Denn abgesehen von allen tatsächlichen Unterschieden, existieren Kulturen mit ihren Grenzen, wie alle sozialen Entitäten, schon deshalb, weil viele Menschen an sie glauben und entsprechend handeln. Zwar kann man versuchen, den Menschen diesen Glauben auszutreiben. Zielführender aber wäre, darüber nachzudenken, wie die historisch gewachsenen Kulturen bestmöglich miteinander auskommen können.
Allzu häufig haben sich dekonstruktivistische Ansätze darauf beschränkt, zu zeigen, dass Religionen, Nationen, Geschlechter und anderes keine natürlichen Formationen darstellen. Es unterblieb ein zweiter Schritt mit der Frage, warum solche Konstrukte dennoch wirkmächtig und vielleicht sogar sinnvoll sind, ob in heuristischer oder in politischer Hinsicht. Heute stehen die Geisteswissenschaften daher einigermaßen ratlos vor Entwicklungen, die zeigen, dass viele Menschen sich dieser Kategorien nicht einfach entledigen wollen. Was sozial konstruiert ist, muss deswegen nicht non-existent, irreführend oder falsch sein. Das gilt auch für Kulturen. JANNIS KOLTERMANN
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.