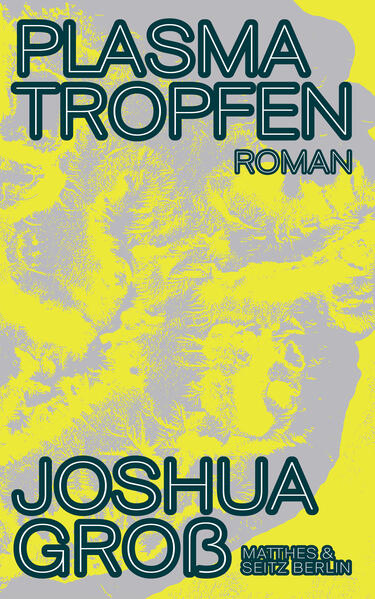
Zustellung: Fr, 18.07. - Mo, 21.07.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Helen ist Malerin. Und sie hat übernatürliche Kräfte. Zwei Tage vor der Eröffnung ihrer Ausstellung werden alle ihre Bilder gestohlen. Anstatt sich um die Aufklärung des Falls zu kümmern, fliegt sie zurück in ihre griechische Heimatstadt Egio. Während sich Helen wieder ihrer künstlerischen Arbeit widmet, untersucht ihr Partner Lenell die tektonische Grenze, auf der Egio liegt. Das Privatleben des Paares ist bewegt, sie können sich ihren eigenen Verletzungen und den Versehrungen der Welt immer weniger entziehen. Und die Frage, die sich einmal gestellt hat, bleibt: Ist es möglich, angesichts der Bruchstellen, die uns umgeben, nur nach persönlicher Erfüllung zu streben? Und wofür soll man die eigenen Kräfte einsetzen - zumal wenn sie, wie in Helens Fall, sogar telekinetisch sind?
Plasmatropfen erzählt von inneren und äußeren Verwerfungszonen, von Plattentektonik und Sehnsucht, Permafrost und Kunst. Joshua Groß protokolliert nicht, was war, sondern imaginiert, was passieren könnte, in einer Welt, die sich immer mehr dem Surrealen und Märchenhaften annähert.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
29. August 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
263
Autor/Autorin
Joshua Groß
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
412 g
Größe (L/B/H)
215/142/24 mm
ISBN
9783751809818
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Ein sprachlich kühnes Buch, das viel Raum zum Nachdenken eröffnet. « - Simon Leuthold, SRF Simon Leuthold SRF 20241101
 Besprechung vom 01.10.2024
Besprechung vom 01.10.2024
Keiner Wahrheitsvegetation zuzuordnen
Menschen aus Gelee: Joshua Groß erzählt in "Plasmatropfen" von seltsamen Partnerschaften
Plasmatropfen, so informiert die Website eines industriellen Tierzuchtbetriebs, sind Reste von Zellplasma, die während der Spermienreifung im Nebenhoden abgestreift werden und die, sollte das nicht der Fall sein, zu verminderter Fruchtbarkeit bei Zuchtebern führt. Ob es also Nebenhodensekret von Zuchtebern ist oder gar das von männlichen Menschen, vielleicht aber doch nur ein Enhancement für Millennials, weiß der Geier - oder der 1989 geborene Autor des Romans "Plasmatropfen", dessen weibliche Hauptfigur sich nämliches Präparat in die Augen träufelt, "um ihre schwindenden Augenhöhlen zu befestigen, um sie nachwachsen zu lassen, ihre Augenhöhlen, die sich immer tiefer in ihren Kopf zurückziehen wollten, die ausfransten".
Dieser Satz gibt zu denken, nicht nur, weil man mit der Bedeutung von Plasmatropfen hadert, sondern auch mit dem Bild von sich tief in den Schädel zurückziehenden Augenhöhlen, die gleichzeitig ausfransen. Um es kurz zu machen: Dieser Roman über zwei junge Menschen, ihre Verletzungen, ihre Ängste vor Ausfransung ist in vielem ein surreales Kammerspiel der Psyche. Er ist halb realistisch (ein junger depressiver Seismologe, Lenell, lebt mit einer erfolgreichen Malerin, Helen, zwischen Agaven und Palmen auf dem Peloponnes) und halb absurd (ein Mann mit Spechtkopf, der eine im Permafrost aufgetaute Kiefernart in Griechenland renaturiert, wird zum Gamechanger im Leben der beiden).
Auf der realen Ebene präsentiert Joshua Groß ein Paar, das mit unterschiedlichen Eigenschaften ausgestattet ist. Lenell hat ein ausgeprägtes Feingefühl für tektonische Dramen. Helen ist mit Telekinese begabt. Zusammen könnten sie glücklich sein. Jedenfalls sind sie achtsam miteinander, und achtsamen Sex haben sie auch: "Helen versuchte, ihm zu helfen, nahm seinen Penis in den Mund, spürte dabei eine geleeige, fleischliche Erschrockenheit."
Trotzdem sind da "innere Verwerfungen", die diese beiden Existenzen nicht auf eine gemeinsame Zukunft zulaufen lassen. "Es konnte gelingen, Lenell wieder empfänglich zu machen für superempathisches Reinimmersieren, oder er rutschte ab in Selbsthass, was den Sex beendete und stattdessen zu Eigenvorhaltungen führte, zu Trennungsangeboten etc."
Ansatzweise erzählt Joshua Groß immer wieder Episoden aus dem Leben des Seismologen, der als Kind unter einer borderlinigen Mutter gelitten hat und als Frühwarnsystem für die Ausbrüche dieser Mutter sich selbst verloren ging. Zusammen mit dem Autor rutschen wir für Momente in den psychotherapeutischen Roman, aber das Gefühl, Zusammenhänge zu erfassen und Ausgänge zu antizipieren, verlässt einen schnell wieder. Denn hier geschieht allerlei merkwürdiges Zeug. So fremdartig, dass es keiner Erzählökonomie und keiner Wahrheitsvegetation klar zuzuordnen ist.
Lenell, so heißt es, habe keinen "Zugriff mehr auf einen Kern", oder, dass dieser ehemalige Kern ins Fleisch ausfranse und eine "Verschmelzung der depressiven Störung mit allen Denkbereichen, mit allen Bewegungsbereichen, mit allen Sinnesbereichen" stattfinde. Lenell, nun entkernt, bestellt sich folgerichtig ein Exoskelett im Internet und legt es erst ganz am Schluss des Romans - eine erotische Erfahrung mit Spechtmensch und einen Klinikaufenthalt später - wieder ab. Helen hingegen versucht ihre telekinetischen Fähigkeiten unentdeckt zu lassen - und zwar auch vor den Lesern unentdeckt. Offenbar aus Angst, damit Erwartungen zu wecken bei ihren Mitmenschen, womit natürlich Lesererwartungen geweckt sind, bevor diese dann durch nichtaktivierte Telekinese bitter enttäuscht werden.
Die Heldin fürchtet auf Seite 85 schon, nur noch "ein Kuddelmuddel aus Energien zu sein, irgendeine unangemessene Symbiose von Unwirklichkeit und Wirksamkeit". Und der Eindruck deckt sich mit dem Lektüreeindruck: Unwirklichkeit bei gleichzeitiger Wirksamkeit.
Ganz gewiss ist in diesem Roman jedenfalls nie, wie man sich den Dingen und Bildern nähern soll, die er aufruft. Manchmal fragt man sich, während die Romanfiguren sich wie Teletubbies benehmen, ob das Ganze nicht eine infantile Form von Satire sei. Nach dem Motto: "Das Leben ist eine Mutter, die Luftballons zerstört."
Wohlmeinende Kritiker rühmen hingegen Groß' "Welthingabe", seine neuartige Kunst des Morphens von allem in alles. In seinem letzten Roman "Prana Extrem" ließ Groß hyperrealistische Riesenlibellen mit Skispringern in einer vom Klimawandel veränderten Alpenlandschaft kollidieren, und sämtliche Protagonisten beschäftigten sich angesichts einer gnadenlos brennenden Sonne neurotisch mit ihrer Hautpflege.
Diese Verwaschung von Natur und Kultur, Körper und Geist, von Mythos und Logos, Realität und Einbildung hatte aber auch etwas Enervierendes. In "Plasmatropfen" erleben die ewig hadernden Figuren sich als "geleeig". Wer aber aus Gelee ist, der ist nicht greifbar oder eben nur in dem Ausmaß, in dem sich ein Wackelpudding an eine Wand nageln lässt. Über Helen heißt es an einer Stelle: "Es war ihr genehm und nichtgenehm zugleich." Ja, was denn nun? Und kann Unentschlossenheit sich zur Pathologie ausweiten?
Eines lässt sich sagen: Dort, wo kein substanzielles Denken mehr möglich ist, weil die Substanz "zerbrochen ist", da schlagen die Gefühle Purzelbäume. Die Figuren haben "invertierte Höhenangst", sie fühlen sich "wie ein Mahlwerk, in dem Schlafgranulat fein gemahlen wurde", auch "der auftauende Boden ließ sie traurig und ruhelos werden", sogar "der Sessel, auf dem Helen Platz genommen habe, sei sehr empfindsam", heißt es. Denn er würde Helens Herzschlag, ihren Puls sowie ihre Atmung "protokollieren". Was nichts daran ändern kann, dass Helen verunsichert ist: "Das Gefühl des Versinkens befiel sie."
Bei Joshua Groß wird in besorgniserregender Weise "gefühlt", "empfunden" und "gespürt". Knapp zweihundert Mal kommen diese Verben in Variationen auf 263 Seiten vor. Das ist enorm und inflationär, wobei das dem Autor nicht einfach unterlaufen sein dürfte. Im Gegenteil, es ist Resultat einer Haltung zu den Lebensverhältnissen und ihrer planetarischen Probleme. Sie sind auch in "Plasmatropfen" Thema, in dem die holländische Küstenstadt Lelystad vom Hochwasser verschluckt wird. Das macht Angst und lähmt.
Doch wer zu viel fühlt, der fühlt bald gar nichts mehr. Als Lenell seine Freundin Helen aus einer nichtdepressiven Euphorie heraus am helllichten Tag anruft, ist er sofort betrübt, weil er dem Gefühl in sich misstraut. Er empfindet es als "unwahrscheinlich".
Für dieses wackelige Weltverhältnis findet Groß zusammen mit dem Frankfurter Autor Leif Randt derzeit vielleicht den radikalsten Ausdruck. Ein Leben zwischen Angst und Exzentrik, das hatte Randt einst in seiner "Post-Pragmatic-Joy-Theorie" versucht zu formulieren. Es ging darin um Techniken, mit denen die Ambivalenzen unseres Zeitalters miteinander versöhnt werden sollen: "Rauscherfahrung und Nüchternheit, Selbst- und Fremdbeobachtung, Pflichterfüllung und Zerstreuung." Etwas Ähnliches versuchen auch die Figuren bei Groß. Mit Plasmatropfen, Exoskeletten und einer Bereitschaft, die Wahrnehmung auf surreales Terrain auszuweiten, das zwar keinen traditionellen Durchblick mehr gewährt, aber Ekstasen des Geistes in uneigentlichen Gefilden. KATHARINA TEUTSCH
Joshua Groß:
"Plasmatropfen."
Roman.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2024. 263 S.,
geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.Bewertungen
am 29.08.2024
Von Permafrost und Spechtmenschen
Plasmatropfen ist eine moderne, sehr konzentrierte Prosa, die manchmal kalt und seelenlos wirkt. Sie ist das aber nicht durchgehend.
Im Mittelpunkt steht die Malerin Helen. Eigentlich sollte sie eine Ausstellung in einem Museum haben, doch da gab es einen Einbruch und alle Bilder wurden gestohlen.
Dann gibt es noch Helens Freund Lenell, der schlimme Depressionen hat. Die Beziehung ist daher nicht einfach.
Dem Autor gelingt es ganz auf seine eigene Art, die Zustände des Malens als auch der Depressionen zu zeigen.
Es gibt viel bizarres im Buch, zum Beispiel Helen im Permafrost oder Lenells Begegnung mit einem Spechtmensch, die sich zu einer Beziehung ausgestaltet.
Es gibt zum Teil bemerkenswerte Beschreibungen. Der Autor wagt einiges.
Es ist ein Buch, auf das man sich einlassen muss.









