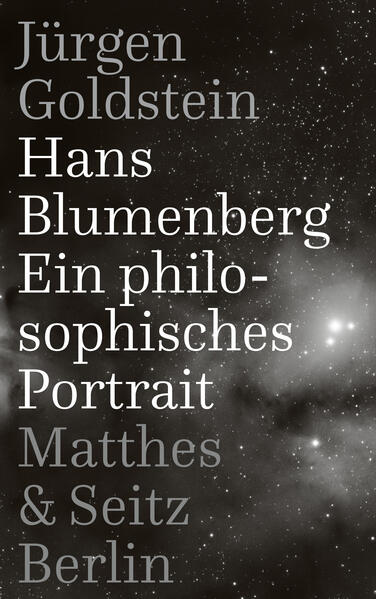
Zustellung: Sa, 14.06. - Do, 19.06.
Versand in 3 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Das Werk Hans Blumenbergs steht wie ein Monolith in der philosophischen Landschaft. Während er immer mehr als einer der wichtigsten deutschsprachigen Philosophen des 20. Jahrhunderts entdeckt wird, erscheinen seine Bücher als ungemein faszinierend und schwer zu lesen, äußerst anregend und zumeist umständlich sowie überaus stilbewusst und oftmals sehr um fangreich. Jürgen Goldstein, der selbst bei Blumenberg studierte, zeichnet ein philosophisches Portrait dieses Autors, indem er dessen geistige Physiognomie hervortreten lässt: Meisterhaft und anschaulich folgt er als ausgewiesener Kenner den Gedankenlinien des reichhaltigen Werkes, von den frühesten akademischen Schriften über die klassischen Bücher bis zu den essayistischen Miniaturen der späten Jahre und den bereits aus dem Nachlass gehobenen Schriften. Dabei wird nicht nur beleuchtet, was Blumenberg dachte, sondern auch, wie er es tat. So eröffnet seine Denkbiografie nicht nur Eingeweihten des Werks neue Perspektiven, sondern dient auch als Handreichung für jene, die bei einem seiner Bücher ins Stocken geraten sind. Auf diese Weise wird dem Gelehrten, der zeit seines Lebens den Zugriff auf seine Person scheute, Genüge getan: denn Blumenberg wollte nicht durchschaut, er wollte gelesen werden.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
09. Juli 2020
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
619
Autor/Autorin
Jürgen Goldstein
Verlag/Hersteller
Originalsprache
deutsch
Produktart
gebunden
Gewicht
924 g
Größe (L/B/H)
221/146/60 mm
ISBN
9783957577580
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 10.07.2020
Besprechung vom 10.07.2020
Das Selbstverständliche auflösen
Für Blumenberg-Leser: Eine intellektuelle Biographie und ein philosophisches Porträt
Dem Publikum zu gefallen zu sein, heißt nicht dasselbe, wie ihm gefällig zu sein." So steht es einmal bei Hans Blumenberg. Unmittelbar geht es da zwar um eine Äußerung Goethes, nämlich des Weimarer Theaterdirektors, der dem Publikum nahelegt, sich vor der Aufführung zu Hause über den auf der Bühne verhandelten mythischen Stoff aufzuklären. Aber klar ist, dass Blumenberg hier auch von eigenen Ansprüchen an ein lesendes Publikum spricht, das der Erwartung des Autors gerecht zu werden hat, "etwas zu merken und bemerken", was ihm nicht einfach ausbuchstabiert wird.
Das ist allerdings nicht unbedingt immer leicht. Man kann bei Blumenberg von verschachtelten Sätzen und wunderbar rücksichtsloser Gelehrsamkeit überfordert werden, zwischen den Haupt- und Nebenwegen der großen Bücher sich verirren, über deren Verhältnis zueinander und zu den von Blumenberg gepflegten kleinen Formen ins Grübeln geraten; und die seit seinem Tod 1996 erschienenen zahlreichen Editionen aus dem Nachlass wollen mittlerweile zudem in eine Vorstellung von den Denk- und Schreibwegen ihres solitären Autors integriert werden.
Pünktlich zum hundertsten Geburtstag Blumenbergs am kommenden Montag sind zwei stattliche Monographien erschienen, die Orientierung über diese Wege versprechen. Rüdiger Zill vom Potsdamer Einstein Forum, seit vielen Jahren mit Blumenberg befasst, legt in dessen Hausverlag eine "intellektuelle Biographie" vor, der an der Universität Koblenz-Landau lehrende Philosoph Jürgen Goldstein, dessen Beschäftigung mit Blumenberg bis zu Studientagen zurückreicht, als er dessen Vorlesungen in Münster hörte, ein "philosophisches Portrait".
Bilder von Blumenberg zeichnen beide auf unterschiedliche Weise. Rüdiger Zill zieht biographisches Material heran, soweit es ihm Aufschluss verspricht über Neigungen, Entscheidungen und Arbeitsweisen des Autors Blumenberg, manchmal auch ein wenig darüber hinaus. Entsprechend entschieden ist sein Zugriff auf unpubliziertes Material aus dem Nachlass, nicht zuletzt auch auf Korrespondenzen.
Jürgen Goldstein dagegen hält sich, von wenigen Ausnahmen und einigen Seitenblicken abgesehen, an die publizierten Texte. Dass auch ein solcher Weg zu einem Bild Blumenbergs führt, das über die an Zitaten reiche Nachzeichnung von Motiven und Werkumrissen hinausgeht, liegt an einer Eigenart dieser Texte, die Goldstein gebührend hervorhebt: dass ihr Autor in ihnen auf hintergründige Weise immer präsent ist, im unverkennbaren Stil und den idiosynkratischen Weisen, sich seine Gegenstände zurechtzulegen, sie zu inszenieren und zu verknüpfen. Es gibt Goldstein die Möglichkeit, charakteristische Züge von Blumenbergs Philosophieren in prägnanten Zwischenbetrachtungen zu behandeln, etwa das Lob der Umwege oder die Pflege einer Nachdenklichkeit, die das Selbstverständliche um seine Selbstverständlichkeit bringt.
Überzeugend traktiert werden diese Motive auch im letzten der drei großen Abschnitte, in die Zill sein Buch unterteilt hat, und das Charakteristika von Blumenbergs Denken in einem chronologischen Durchgang nachzeichnet. Da liegen dann aber schon zwei Drittel des Buchs hinter dem Leser, in denen es zwar durchaus auch um die Herausbildung zentraler Motive und um Einblicke in die Arbeitsweise Blumenbergs geht, die aber biographischen Leitlinien folgen.
Das Elternhaus wird eingangs kurz behandelt, ausführlicher schon die Jahre am Lübecker Katharineum, die mit der schweren Kränkung enden, als "Halbjude" 1939 um das Recht des Jahrgangsbesten gebracht zu werden, die - von Zill ausführlich referierte - Abiturrede zu halten. Im Jahr darauf muss Blumenberg darum auch sein Studium abbrechen, findet in einem kriegswichtigen Industriebetrieb Anstellung, kommt in den letzten Kriegsmonaten noch in ein Arbeitslager, bevor er versteckt das Kriegsende erreicht. Dann beginnt, nach einer leichten Verzögerung noch, der akademische Weg, mit der im Eiltempo bewältigten Doktorarbeit (siehe die nebenstehende Besprechung) und der drei Jahre darauf mit etwas Mühe durchgefochtenen Habilitation, aber auch das Publizieren in Zeitungsfeuilletons. Etwas später setzt die Serie der Aufsätze ein, welche Themen der erst ab Mitte der sechziger Jahre erscheinenden Bücher vorzeichnen.
Die Darstellung dieser Formationsphase, die Zill recht genau in den Blick nimmt, unterlegt mit einer materialreichen Darstellung von Blumenbergs Weg auf universitärem wie publizistischem Terrain, bietet vielleicht die meisten Aufschlüsse, selbst wenn auch später noch wichtige Entscheidungen fallen. Man kann verfolgen, wie Blumenbergs Fragestellungen aus der Diagnose einer als krisenhaft beschriebenen Gegenwart hervorgehen, die durchaus nicht aus der damaligen Zeit fällt, doch ohne melancholischen Gestus auskommt und ihren anfangs getragenen Stil zusehends verliert. Was aber erhalten bleibt - auch noch in den Versuchen zu einer Geistesgeschichte der Technik, die dann einer explizit anthropologischen Wendung weicht -, ist ihr großformatiger Zuschnitt, der eben auf nicht weniger als Epochenfragen zusteuert; bei gleichzeitiger Kleinteiligkeit schließlich großer erzählerischer Bögen.
Das ist freilich nur eine, wenn auch wesentliche Schicht in Blumenbergs Textmassiv - sie zu verstehen, helfen beide Darstellungen, selbst wenn die Genese bei Zill detaillierter nachgezeichnet wird (der sich dafür weniger bei den resultierenden Büchern aufhält, auch Blumenbergs phänomenologisches Philosophieren eher außen vor lässt); und auf erhellende Weise werden auch die späteren großen Würfe wie die sich verselbstständigenden kleinen Formen behandelt. Die Vorzüge der beiden Bücher möchte man ohnehin nicht gegeneinander aufrechnen. Zill gehört einfach ins Blumenberg-Regal, und Goldstein hat sich einen Platz dort auch verdient.
HELMUT MAYER
Rüdiger Zill: "Der absolute Leser". Hans Blumenberg. Eine intellektuelle Biographie.
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 816 S., Abb., geb., 38,- [Euro].
Jürgen Goldstein: "Hans Blumenberg". Ein philosophisches Portrait.
Matthes & Seitz Verlag, Berlin 2020. 624 S., geb.
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt.








