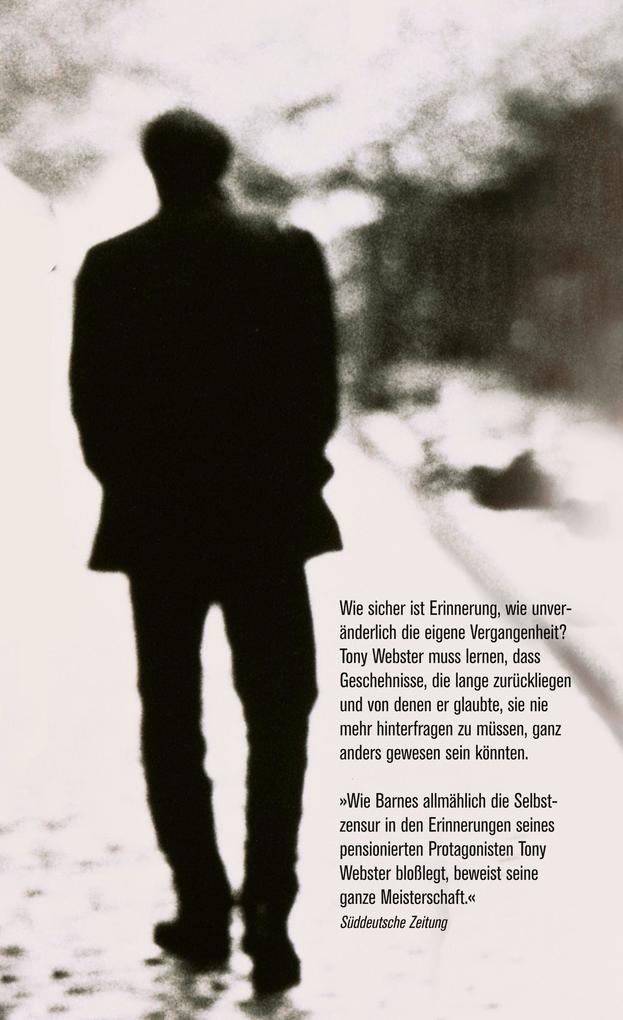Besprechung vom 11.01.2026
Besprechung vom 11.01.2026
Leben mit Julian Barnes
"Abschied(e)" soll das letzte Buch des englischen Autors sein. Sagt er selbst. Und schaut darin zurück und voraus. Ich auch.
Staub. Er hängt in Girlanden an zwei Stapeln Bücher auf dem Schreibtisch. Das neueste, "Abschied(e)", liegt ganz oben und erscheint in den nächsten Tagen, das älteste, "Metroland", habe ich vor fast genau dreißig Jahren gelesen, beide hat Julian Barnes geschrieben und alle anderen, an denen der Regalstaub hängt, auch.
"Februar '96" steht auf der ersten Seite von "Metroland". Ich hatte meinen Namen mit Tinte hineingeschrieben, es war ein Mängelexemplar aus dem Haffmans- Verlag, das erste Buch, das ich je von Barnes gekauft habe, gefunden auf dem Wühltisch bei Strickling, dem Kaufhaus meines Heimatorts. Es waren Semesterferien, ich hatte mir kurz vor Weihnachten beim Fußball das Sprunggelenk gebrochen und war die paar Hundert Meter von zu Hause gehumpelt. Sah das Cover, mochte den Titel, kaufte und las sofort und danach, so schnell es geht, auch alles andere von diesem Julian Barnes, dessen Namen ich auch mochte. Aber alles andere genauso, die leise, präzise Prosa, die kluge Wärme und Schonungslosigkeit, den Humor, die lange Nase.
Jetzt, dreißig Jahre später, formt sich das alles zu einer Episode von der Art, wie sie Julian Barnes in seinem neuen und letzten Buch auch wieder erzählt, ein Buch, das, wie so viele des englischen Schriftstellers, Erinnerungen, Zufälle, Details und die Lektüren anderer Bücher und Biographien zu einer Antwort formt, was das Leben sein könnte. Oder wie es gewesen sein könnte, dieses Leben, im Falle des abtretenden Schriftstellers Barnes, der am 19. Januar achtzig Jahre alt wird. Barnes zu lesen, heißt, nichts, was über das Leben und die Liebe geschrieben und erinnert wird, für das letzte Wort zu halten. "Vielleicht ist Ihnen aufgefallen", schreibt er jetzt in "Abschied(e), "dass ich die Angewohnheit habe, mich selbst zu korrigieren." Für seine Liebes- und Lebensgeschichten galt das immer, und deswegen, wer weiß, ob das so bleibt mit diesem Abschied?
In der Erinnerung an "Metroland" und den Februar 1996 fühlte sich es an, als würde mir da selbst eine Geschichte von Julian Barnes passieren, ein Mängelexemplar, das ein Mängelexemplar liest, dessen Geschichte ihm ähnlich sieht. Ich hatte damals, trotz oder wegen meines Germanistikstudiums, keine große Lust mehr zu lesen - und meine erste große Liebe, die in Paris studierte, hatte mir gerade das Herz gebrochen. In "Metroland" erzählte Barnes eine ähnliche Tragikomödie: von Christopher aus einem Pendler-Vorort von London, dem Metroland, der nicht weiß, was er mit den Büchern anfangen soll, die er liest, und im Mai 1968 die Liebe in Paris findet - und wieder verliert. Danach geht das Leben weiter, anders, besser, solange es gut geht, und dann wieder von vorn, was bleibt uns anderes übrig.
Gebrochene Herzen, gebrochene Sprunggelenke, Staub. Eigentlich hatte Strickling keine Bücher im Sortiment, was aber den Zufall noch größer machte: dass ich dieses Buch also ausgerechnet dort fand, zwischen Bettwäsche, Büromaterial und Küchenkram, für ein paar Mark fünfzig. Dieses eine Buch, das zur rechten Zeit kam. Ein paar Bücher von Julian Barnes später verstand ich dann, dass es ihm immer darum geht, dass es so etwas wie den "Zufall" oder "die rechte Zeit" im Leben gar nicht gibt und der Mensch dazu neigt, das eine mit dem anderen zu verwechseln. Und sich aber Theorien dafür zurechtzulegen, die nur mit Skepsis, vorsichtiger Zustimmung und mit Selbstironie zu behandeln sind.
"Ich bin jetzt achtundsiebzig", schreibt Julian Barnes heute, auf den letzten Seiten von "Abschied(e)", "und dies ist definitiv mein letztes Buch - mein offizieller Abgesang, mein letztes Gespräch mit Ihnen." Über zwanzig Bücher hat Julian Barnes seit 1980 veröffentlicht: Das erste war ein Krimi, "Duffy", erschienen unter dem Pseudonym Kavanagh, dem Nachnamen von Julians Frau Pat. Danach kamen meist Romane, selten waren sie besonders lang, oft spielten sie in der englischen Mittelschicht, einmal in der Zukunft, mehrfach in der Vergangenheit berühmter Künstler wie Arthur Conan Doyle oder Schostakowitsch.
Seine ganz eigene Form hatte Barnes schon 1984 mit "Flauberts Papagei" gefunden und danach verfeinert. Auch "Abschied(e)" ist jetzt eine Variation: ein spielerisch montiertes Zwischending aus Fiktion und Reflexion. In "Flauberts Papagei" ("1/97", auch in Tinte) erzählt ein pensionierter Arzt namens Geoffrey von seiner Leidenschaft für den französischen Schriftsteller Flaubert, erzählt dessen Leben nach, plus Zeittafel, Glossar und vielen Zitaten, steigt tief in seine Werke hinein - der Vogel aus dem Titel stammt aus Flauberts Novelle "Ein schlichtes Herz" und ist ausgestopft.
"Abschied(e)" folgt dieser Form aus Erzählung und Erörterung jetzt wieder, auch wenn fiktionale Elemente nicht leicht auszumachen sind, der Pensionär diesmal Barnes selbst ist und das Werk sein eigenes. Ein Werk, das sich, wie Barnes es hier zusammenfasst, hauptsächlich "um den Tod oder die Liebe oder Frankreich oder die Erinnerung" gedreht hat. Tatsächlich ist Frankreich die zweite Heimat des Engländers Barnes, oder besser: die französische Literatur, vor allem die vor 1900. "Flauberts Papagei" ist 1984 für den Booker Prize nominiert gewesen, bekommen hat Barnes ihn dann viel später, 2011, für "Vom Ende einer Geschichte", den Roman einer Dreiecksgeschichte.
Auch das ist typisch für Barnes: Paare sind bei ihm selten allein in ihrer Beziehung, er hat diesen Stoff wieder und wieder variiert (und die Liebesgeschichten, wie sich selbst, dabei korrigiert, oft mehrfach). Er tut es im neuen Buch am Beispiel eines Paares, das er Anfang der 1960er-Jahre im Oxford-Studium gekannt hatte, Stephen und Jean, und das Jahrzehnte später durch ihn wieder zusammenkommt - um sich wieder zu trennen. Von den unhaltbaren Zuständen der Liebe zu erzählen, das hat Barnes am zartbittersten 1992 in "Darüber reden" ("5/97", in Tinte) geschafft, da ging es um Stuart, Oliver und um Gillian, die erst mit dem einen, dann mit dem anderen zusammen ist. An einer unvergesslichen Stelle dieses Romans, der von allen dreien erzählt wird, sagen sie alle, hintereinander: Wenn hier jemand verletzt wird, bin ich es.
Barnes' Prosa ist wie Schnee, fühlt sich kalt an, ist aber weich, perfekt also, um von Glück, Betrug und Selbsttäuschung zu erzählen, dabei keinen Beteiligten zu verraten oder, am wichtigsten, je den Glauben aufzugeben, im Leben könnte es etwas Besseres als die Liebe geben.
Oder doch? Die Relativität von Wahrheit, wenn es um Liebe und Erinnerung geht, das ist Barnes' ewiges Thema, es scheint unerschöpflich, auch im neuen Buch geht es darum. Die Geschichte von Stuart, Oliver und Gillian jedenfalls hat Barnes Jahre später weitererzählt, in "Love, etc", aber da hatte ich längst aufgehört, meinen Namen in seine Bücher zu schreiben, und überhaupt mit Tinte.
Eine Emanzipation, die Barnes selbst mit seiner Skepsis gegenüber zu starker Identifikation mit ausgedachten Sachen gefördert hatte. Das dachte ich mir jedenfalls so, als ich dann, eines schönen Tages, an den ich 1996 niemals geglaubt hätte, tatsächlich vor ihm saß, in seinem Londoner Haus, nicht weit von Hampstead Heath. Wir waren verabredet, um über "Arthur & George" zu reden, seinen neuen Roman über Arthur Conan Doyle, den Erfinder von Sherlock Holmes, der versuchte, true story, in der echten Welt selbst einen Kriminalfall zu lösen. Mir gefiel, dass auch in dieser Geschichte Kunst und Leben ineinander übergingen, wie damals bei mir und "Metroland". Ich erzählte ihm davon, in diesem Frühjahr 2005, im ersten Stock seines Hauses, wo ein Billardtisch stand und Barnes mir eine Tasse Beuteltee anbot, und er fragte zurück, wie die Frau aus Paris hieß. An mehr erinnere ich mich nicht, ein Glück, es war schon peinlich genug, nur daran: Als ich das Haus verließ, winkte mir Pat Kavanagh stumm aus ihrem Arbeitszimmer zu, seine Frau, eine Literaturagentin, die drei Jahre später an einem Hirntumor starb. 37 Tage hatten zwischen der Diagnose und Pats Tod gelegen. Im gleichen Jahr, 2008, aber lange vorher hatte Barnes ein Buch über den Tod geschrieben, "Nichts, was man fürchten müsste" - so viel dazu, wenn die Übergänge zwischen Kunst und Leben durchlässig werden. Der Tod ist, neben Liebe und Erinnerung, das letzte der großen Motive im Werk von Julian Barnes, auch in "Abschied(e)".
"Departure(s)", heißt das Buch im Original, der deutsche Titel legt den Begriff auf eine seiner Bedeutungen fest, denn er kann auch "Aufbruch" bedeuten, geographisch von hier nach dort, diskursiv von einem Gedanken zur nächsten Schlussfolgerung. Es ist, in dieser Ambivalenz, ein typisches Julian-Barnes-Wort, das je nach Perspektive das eine oder das andere betont. Ich mache also, was mir mein Lieblingsschriftsteller beigebracht hat, und halte mich daran fest, dass es nicht das letzte Wort sein muss.
TOBIAS RÜTHER
Julian Barnes, "Abschied(e)". Aus dem Englischen,
wie so gut wie alle seiner Bücher, von Gertraude Krueger. Kiepenheuer & Witsch, 256 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.