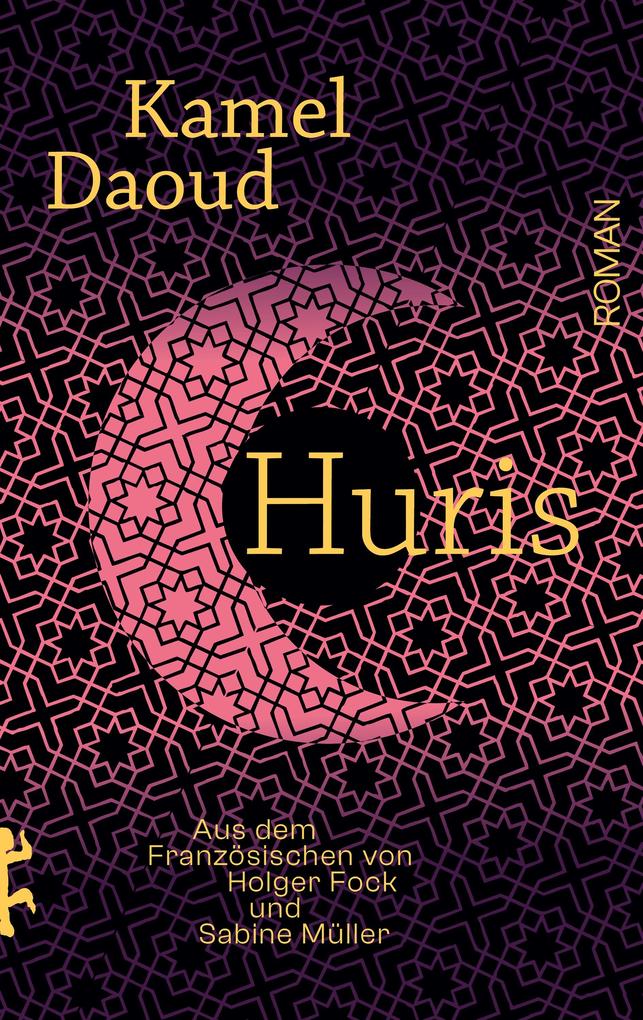Besprechung vom 12.10.2025
Besprechung vom 12.10.2025
Algeriens verdrängter Krieg
Der Schriftsteller Kamel Daoud hat mit "Huris" einen großartigen Roman gegen das erzwungene Vergessen geschrieben. Eine Frau wirft ihm aber vor, dafür ihre Geschichte geplündert zu haben.
Von Karen Krüger
Im September 2005 verabschiedete Algerien die sogenannte "Charta für den Frieden und die nationale Aussöhnung", um einen Schlussstrich unter ein Jahrzehnt der Gewalt zu ziehen. Schätzungen sprechen von 200.000 Menschen, die dem Konflikt zwischen dem algerischen Militär und Islamisten in den Jahren 1992 bis 2002 zum Opfer fielen. Die Charta verfügte Straffreiheit für die Täter und dass nicht mehr über die Ereignisse gesprochen werden darf: kein persönliches Erinnern, kein offizielles Gedenken, keine Dokumentation, kein Wort in den Schulbüchern über das Grauen. Lässt es sich aber auslöschen, indem Schweigen per Gesetz verordnet wird? "Das Vergessen ist die Gnade Gottes, aber auch die Ungerechtigkeit der Menschen", sagt eine Frau, deren Angehörige während des Bürgerkriegs getötet wurden, in Kamel Daouds Roman "Huris".
Der algerische Schriftsteller besitzt seit 2020 auch die französische Staatsbürgerschaft und lebt in Paris im Exil. Für das Buch hat er 2024 den Prix Goncourt, Frankreichs wichtigsten Literaturpreis, erhalten. In Algerien brachte es ihm zwei Klagen wegen Verletzung der nationalen Einheit und der Diffamierung des Staates ein, in Frankreich hat eine einunddreißigjährige Überlebende des Bürgerkriegs ein Verfahren gegen ihn und seinen Verlag Gallimard angestrengt. Saâdas Arbane beschuldigt den Autor, "ihre Geschichte" gegen ihren ausdrücklichen Willen als Vorbild für Aube, eine seiner Figuren in "Huris", benutzt zu haben.
Diese Aube, eine Frau von 26 Jahren, steht als Ich-Erzählerin im Mittelpunkt des Geschehens, das von den Qualen individueller Traumata handelt und von der Konfrontation derer, die Zeugnis über die blutigen Ereignisse in Algerien ablegen möchten, und jenen, die diese Erinnerung zum Schweigen bringen wollen. Der Bürgerkrieg, so erzählt es Daoud in seinem Roman, brach in Aubes Leben ein, als sie fünf war. In der Nacht des 31. Dezember 1999 überfielen islamistische Gruppen ihr Dorf Had Chekala am Fuße des Ouarsenis-Gebirges, um die Bewohner für ihre vermeintliche Kollaboration mit dem Militär zu bestrafen - das Militär ging von einer Kollaboration mit den Terroristen aus und hatte deshalb den Strom abgestellt. Erst schlachteten die Kämpfer alle Hunde, Pferde, Hühner und andere Tiere ab, um in vollkommener Stille vorzurücken. Dann schwärmten sie aus und schlitzten jedem, den sie fanden, die Kehle auf. In einem Bett schlafend eingerollt liegen in eine Decke zwei Mädchen. Zuerst wird die jüngere Schwester gepackt, ihr Hals entblößt. Da regt sich die andere, zieht die Aufmerksamkeit des Attentäters auf sich, und der Schnitt durch die Kehle der Schwester wird nur hastig ausgeführt. Die Ermordung des Mädchens bleibt unvollständig. Als man es am nächsten Tag findet, ist noch ein Hauch von Leben in ihm.
Das Durchschneiden von Kehlen war die bevorzugte Tötungsart der bärtigen Gotteskrieger. Jeder in Algerien, der die sichelförmige, fast siebzehn Zentimeter lange Narbe auf Aubes Hals bemerkt, versteht sofort, was ihr widerfuhr. Aube ist wie der verkörperte "Fußabdruck" eines Konflikts, dessen Spuren das Regime tilgen möchte. Sie ist der lebende Beweis, dass der zehn Jahre dauernde Krieg existierte. Das Attentat hat ihre Stimmbänder zerstört. Sie kann sich kaum artikulieren, nur durch eine Kanüle atmen. Damit ihre Erinnerung an das Davor nicht verblasst, hat sie sich, entgegen dem islamischen Dogma, Symbole auf den Körper tätowieren lassen. Jedes steht für eine Kindheitserinnerung.
In den Augen der konservativen Sittenwächter ist Aube, die raucht, ihr Haar unbedeckt trägt, ein Stein des Anstoßes. Sie betreibt einen Schönheitssalon gegenüber der Moschee, in dem sie während des Freitagsgebets Schamhaare epiliert und die Frauen des Viertels mit Parfum, Schminke und Haarspray in verführerische Diven verwandelt. Infolge einer Affäre mit einem Fischer, der nach Spanien auswanderte, ist sie schwanger. Während sich draußen in den Straßen von Oran die Menschen auf das muslimische Opferfest vorbereiten, wendet sie sich in einem inneren Monolog, der den roten Faden des Romans bildet, an ihr ungeborenes Kind, das sie sich als Mädchen vorstellt. Sie nennt es zärtlich "meine Huri" - als "Huri" bezeichnet der Koran die glückseligen Bewohnerinnen des Paradieses, ideale Verkörperungen von ewigem Verlangen, die den Gläubigen als Belohnung für ein rechtschaffenes Leben oder den Märtyrertod im Jenseits beigegeben werden.
Doch Aubes Unterton ist bisweilen auch eiskalt, wenn sie mit dem Kind spricht. Sie hat vor, es mit Abtreibungspillen zu töten, damit es wieder zurück ins Jenseits kehren kann, fort von dieser gnadenlosen Welt, die vor allem für Frauen kaum Gutes bereithält. "Siehst du, kleine unerwartete Fremde, wenn du in diesem Land zur Welt kommst, gehst du ein großes Risiko ein. Es wird Jahre geben, in denen du dich satt essen kannst, andere, in denen du selbst gegessen wirst, und wieder andere, in denen man dir die Kehle durchschneidet. Du wirst für den abstrusen Traum eines alten Propheten bezahlen, und jemand wird dich vergewaltigen. [...] Drei Pillen, und ich werde ein ganzes Leben vor dem ganzen Leben retten."
Aber Aube ist hin- und hergerissen. Das Wesen, das in ihr heranwächst, ist das einzige, das ihr "zuhören" kann. Ihm vertraut sie ihre Angst, die Geschichte ihres Traumas und ihres Wunsches nach Gerechtigkeit an. Sie bricht auf zu einer Reise in das Dorf, aus dem sie stammt, auf der Suche nach etwas, das sie selbst nicht klar benennen kann. Ihre Begegnungen unterwegs mit Menschen, die wie sie wider Willen in die Ereignisse des "schwarzen Jahrzehnts" verwickelt waren, bilden die Folie, auf der nach und nach ein Bild von der politischen und gesellschaftlichen Situation Algeriens von den Neunzigerjahren bis heute entsteht. Auch was für unterschiedliche Wege das Streben nach Vergessen gehen kann und die unterschiedlichen Standpunkte und Gemütszustände der Täter und Opfer werden deutlich. Da ist Hamra, sie wurde von den Islamisten entführt, mit mehreren ihrer Anführer verheiratet, vergewaltigt. Ihr haftet noch immer der Beiname "Terroristin" an, da die staatliche Amnestie für sie als Frau nicht gilt. Eine weitere Stimme ist der Scheich Zabir, von dem unklar bleibt, ob er ein blutrünstiger Ex-Terrorist ist, der unter neuer Identität lebt, oder, so wie er es behauptet, nur dessen Zwillingsbruder. Der Buchhändler Aïssa, eine der wenigen positiv besetzten männlichen Figuren in diesem Roman, wurde Zeuge eines Massakers. Die Islamisten ließen ihn mit einem zertrümmerten Bein davonkommen, damit er von ihren Taten berichtet.
Mit ihm öffnet Daoud den Blick auf eine andere Ebene des Bürgerkriegs, der nicht nur aus Kämpfen zwischen Armee und Islamisten bestand, sondern auch ein "Krieg gegen Bücher" war und das intellektuelle Leben um Jahrzehnte zurückwarf. Die meisten halten Aïssa jedoch für einen Spinner. Sagt man ihm eine Zahl, nennt er das dazu passende Massaker - mit Datum, auch Namen, woraus sich zwischen ihm und Aube ein makabres Spiel ergibt. Für ihn besteht die Aufarbeitung des Traumas in der Versessenheit auf Fakten und mathematische Totalität. Aube dagegen durchlebt immer wieder jede Regung und jedes Geräusch, ja sogar den Duft, die gefühlte Kühle jener Nacht, in der ihr Dorf ausgelöscht wurde und ihre Schwester Taïmoucha den Mörder ablenkte. Das Schuldgefühl, sie deshalb überlebt zu haben, sitzt tief.
Kamel Daouds Roman lenkt nicht nur den Blick auf ein nur wenig bekanntes Kapitel der algerischen Geschichte, sondern stellt auch die grundsätzliche Frage, inwieweit eine Gesellschaft auf der Grundlage von Verdrängung wiederaufgebaut werden kann. Er zeichnet das Porträt eines Landes, das von seiner unaufgearbeiteten Vergangenheit zerrissen ist und in dem weite Teile der Gesellschaft religiösen Eiferern vertrauen. Wie er selbst zum Islam in Algerien steht, davon zeugen die lakonischen Bemerkungen, mit denen Aube das religiöse Gebaren um sich herum demontiert. Da registriert sie etwa, dass der Bart des Scheichs trotz seines fortgeschrittenen Alters kein weißes Haar aufweist und schlussfolgert: "Diese Farbe ist die Nummer eins der Farbpalette in meinem Friseursalon! Echtes Schwarz ohne Schattierung."
Daoud schildert das Unausgesprochene, das die offizielle Rhetorik ausklammert, und führt den Leser zu aufgeschlitzten Körpern, abgetrennten Köpfen, ermordeten Kindern. Das ist mitunter umso schwerer zu ertragen, als das Geschilderte im scharfen Kontrast zu seiner poetischen Sprache steht. Die Exzesse der Gewalt hat der Autor aus nächster Nähe erfahren. Während des Bürgerkriegs arbeitete Daoud als Journalist für die französischsprachige Zeitung "Le Quotidien d'Oran". Als solcher besuchte er Orte von Massakern, darunter auch Had Chekala.
Dass gegen Daoud in Algerien eine Klage wegen Verunglimpfung des nationalen Gedächtnisses eingereicht wurde, weil er sich nicht an das Schweigen und die offizielle Erzählung hält und aus Sicht der Regierung damit gegen die "Charta für den Frieden und die nationale Aussöhnung" verstößt, zeigt vor allem, wie sehr das algerische Regime die Macht der Literatur fürchtet. Der Verkauf von "Huris" ist dort verboten. In Frankreich kam der Roman zu einem Zeitpunkt in den Buchhandel, als die politischen Beziehungen des Landes zu der ehemaligen Kolonie ohnehin schon frostig waren. Die Ehren, die dem Roman zuteilwurden, haben sie keinesfalls verbessert. Kamel Daoud ist in den Medien eine äußerst gefragte Stimme, wenn es um Algerien, Islamismus und Einwanderung geht.
Zehn Tage, nachdem er am 4. November 2024 den Prix Goncourt erhalten hatte, erschien die 31 Jahre alte Saâda Arbane, die als Kind Opfer von islamistischen Attentätern wurde und nach dem Versuch, ihr die Kehle durchzuschneiden, ihre Stimme verlor, mit einer Sprechhilfe im algerischen Fernsehen, begleitet von einer Anwältin, die als regierungsnah gilt. Sie erhob den Vorwurf, der Roman erzähle ihre Geschichte, allerdings ohne ihr Einverständnis. Tatsächlich war Saâda Arbane eine Patientin der Ehefrau Kamel Daouds, die als Therapeutin tätig ist. Im Roman, so ihr Vorwurf, fänden sich Details wieder, die sie in einem streng therapeutischen Rahmen erzählt habe. Saâda Arbane zeigte den Autor und dessen Frau wegen Verletzung der Privatsphäre an. Zwei Tage später wurde der frankophone algerische Schriftsteller Boualem Sansal, der neben der algerischen auch die französische Staatsbürgerschaft besitzt, am Flughafen von Algier verhaftet und später zu fünf Jahren Haft verurteilt, weil er erklärt hatte, dass der westliche Teil des Landes eigentlich zu Marokko gehöre. Böser Zufall oder der Beginn einer Hexenjagd gegen im Ausland einflussreiche literarische Stimmen?
Saâda Arbane hat sich in Frankreich Anwälte genommen und auch in Paris Klage wegen Verletzung der Privatsphäre eingereicht, Daoud und dessen französischer Verleger Antoine Gallimard weisen alle Vorwürfe von sich. Es handele sich um eine orchestrierte Verleumdungskampagne. In einem Interview deutet Daoud an, dass Saâda Arbane "vom Regime manipuliert" worden sein könnte. Seine Anwältin betonte, der politische Kontext, in dem die Vorwürfe erhoben wurden, dürfe nicht ignoriert werden. Saâda Arbane wird von ihnen als eine willige Marionette des algerischen Regimes dargestellt. Auch in Deutschland, wo das Buch in diesen Tagen in deutscher Übersetzung erschienen ist und der Autor auftritt, überwiegt diese Lesart der Ereignisse.
Die französische Zeitung "Libération" hat Einsicht in die eingereichte Klageschrift bekommen und im Mai in einem Artikel darüber berichtet. In dem Dokument werde dargelegt, dass die Klägerin mit Kamel Daoud und dessen Frau auch in einem privaten, weit über die therapeutische Beziehung hinausgehenden Verhältnis miteinander verbunden gewesen sei. Die Zeitung berichtet von "beunruhigenden Ähnlichkeiten" zwischen dem Leben von Saâda Arbane und jenem von "Aube". Erstere wurde 1993 geboren, lebe in Oran, sei mit einem Algerier spanischer Herkunft verheiratet und betreibe einen Friseursalon. Ihre leiblichen Eltern waren Hirten und wurden in der Nacht vom 26. Juli 2000 zusammen mit ihren Geschwistern ermordet. Sie wurde mit aufgeschlitzter Kehle von der berühmten Kinderärztin Zahia Mentouri gefunden, adoptiert und in Paris behandelt. In Daouds Roman sind die Eltern von Aube Schafzüchter und ihre Adoptivmutter ist eine bekannte Anwältin. Auch die Schwangerschaft und den Gedanken, abzutreiben, teile Saâda Arbane mit der Protagonistin aus dem Roman, so "Libération". In Algerien wird schon versuchte Abtreibung mit Gefängnis bestraft.
Wie es weitergeht, wird ein Pariser Gericht entscheiden. Wie immer das Verfahren auch ausgehen mag, ist "Huris" ein hervorragender Roman. Sein Verdienst besteht auch darin, einen Krieg in die Gegenwart zu holen, dessen Opfer und deren Angehörige unbedingt Aufarbeitung und Respekt verdienen.
Kamel Daoud: "Huris". Aus dem Französischen von Holger Fock u. Sabine Müller. Matthes & Seitz, 398 Seiten
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.