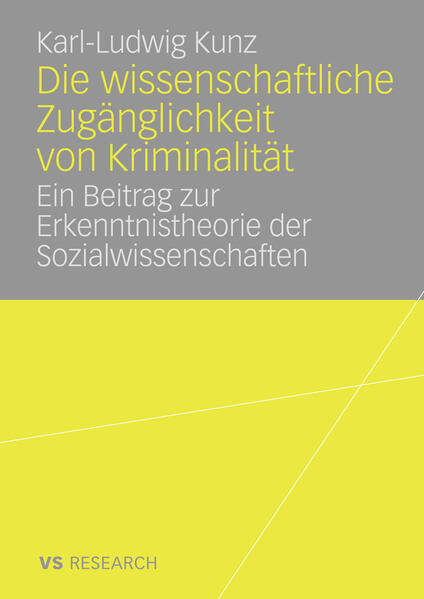
Zustellung: Mi, 21.05. - Sa, 24.05.
Versand in 1-2 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Traditionell versteht sich die Kriminologie als erfahrungswissenschaftliche Disziplin, die Kriminalität mittels quantifizierender Methoden der Sozialforschung möglichst rational zu begreifen sucht.
In seiner für die sozialwissenschaftliche Theoriedebatte ertragreichen Standortbestimmung kritisiert Karl-Ludwig Kunz den trügerischen Schein objektiver Tatsachenbeobachtung. Die Auseinandersetzung damit, ob wirklich gezählt wird, was man zu zählen vorgibt, und was es bedeutet, nur "Indikatoren" für das eigentlich Interessierende erheben zu können, schafft die Basis dafür, die Kriminologie an einem kulturwissenschaftlichen Horizont auszurichten.
In seiner für die sozialwissenschaftliche Theoriedebatte ertragreichen Standortbestimmung kritisiert Karl-Ludwig Kunz den trügerischen Schein objektiver Tatsachenbeobachtung. Die Auseinandersetzung damit, ob wirklich gezählt wird, was man zu zählen vorgibt, und was es bedeutet, nur "Indikatoren" für das eigentlich Interessierende erheben zu können, schafft die Basis dafür, die Kriminologie an einem kulturwissenschaftlichen Horizont auszurichten.
Inhaltsverzeichnis
Zur Schwierigkeit des Zählens von Kriminalität. - Die gesellschaftliche Einbindung sozialwissenschaftlicher Erkenntnis und das Problem der subjektiven Perspektivengebundenheit. - Zeitströmungen und Manieren des Sehens . - Der empiristische Zugang: Sammeln von Tatsachen. - Der kritisch-rationale Zugang: Systematische Überprüfung. - Kriminalstatistik und Dunkelfeldforschung: Die vermeintlich kognitive Basis des Wissens um die wirkliche Kriminalität. - Die Verwechslung von Bildersammlungen mit dem Abgebildeten. - Die gebotene Gegenstandsadäquanz des sozialwissenschaftlichen Beobachtens. - Das interpretative Paradigma und seine methodischen Ausformulierungen. - Kriminalität als kontextuell gerahmter Bedeutungsknoten. - Nebeneinander unterschiedlicher, aber gleichrangiger Rahmungen von Kriminalität. - Kriminologie als Kulturwissenschaft jenseits unmittelbarer kriminalpolitischer Funktionalität. - Was bleibt von der Vorstellung einer rationalen Kriminalpolitik? .
Produktdetails
Erscheinungsdatum
27. November 2007
Sprache
deutsch
Auflage
2008
Seitenanzahl
132
Autor/Autorin
Karl-Ludwig Kunz
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
IX, 122 S.
Gewicht
309 g
Größe (L/B/H)
222/145/12 mm
Sonstiges
HC runder Rücken kaschiert
ISBN
9783835070189
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Es ist ein großer Verdienst von Kunz, derzeit ein solches Buch auf den Markt gebracht zu haben. Man wünscht sich eine weite Verbreitung und am besten eine doppelte Neuauflage: eine als Einführungs- und Lehrbuch verfasste, und eine etwas weniger redundant argumentierende und dafür noch stärker wissenschaftstheoretisch orientierte Fassung [. . .]." Soziologische Revue, 3-2010
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Die wissenschaftliche Zugänglichkeit von Kriminalität" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.









