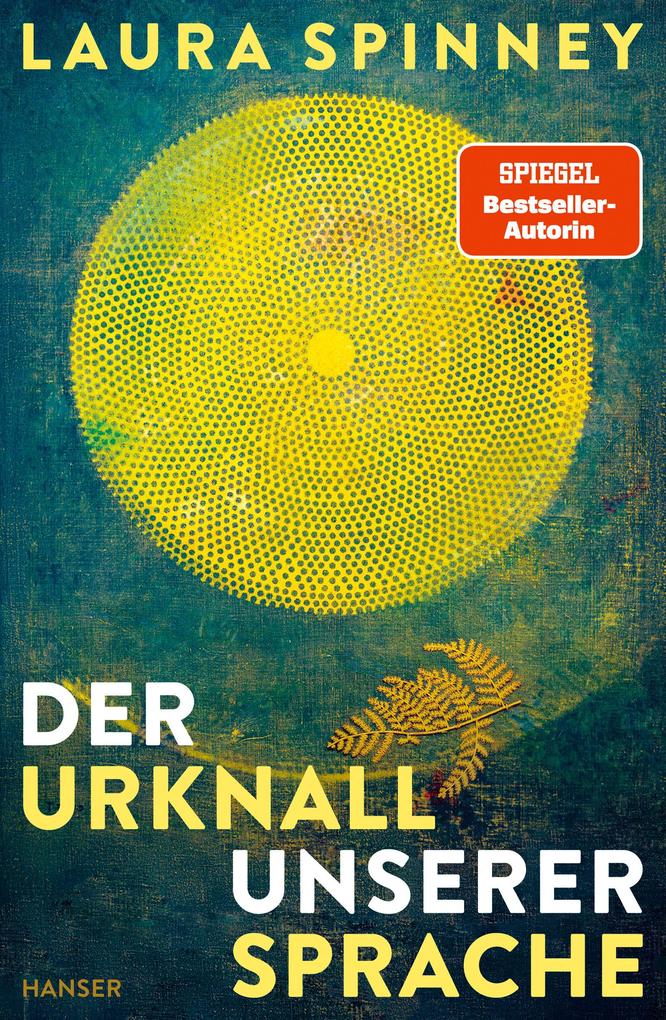Besprechung vom 12.09.2025
Besprechung vom 12.09.2025
Die Indogermanen bleiben theorieabhängig
Orientierungshilfe auf unübersichtlichem Forschungsterrain: Laura Spinney führt durch die Geschichte der größten aller Sprachfamilien
Fast die Hälfte der Menschheit spricht eine von 220 indogermanischen Sprachen als Mutter- oder Zweitsprache. Was Sprecherzahl und geographische Ausbreitung angeht, ist diese Sprachfamilie, zu der auch das Deutsche gehört, die weltweit größte, die es je gab. Über den Wortschatz und die Grammatik der indogermanischen Ursprache, aus der neben den germanischen, romanischen, slawischen und keltischen auch indische und iranische Sprachen hervorgegangen sind, weiß man inzwischen recht viel. Generationen von Linguisten haben die Wörter und Formen in akribischer Forschungsarbeit rekonstruiert.
Über die sprachwissenschaftlichen Befunde hinaus haben in den letzten Jahrzehnten archäologische Grabungen und genetische Analysen von Knochenfunden eine Fülle von Detailinformationen zu den möglichen Sprechern geliefert. Doch obwohl der Forschung in ihrer 250-jährigen Geschichte noch nie so viele und vielfältige Daten zur Verfügung standen wie heute: Wo die indogermanische Ursprungsregion lag, wann die Sprache sich auszubreiten und in unterschiedliche Zweige aufzugliedern begann und was für Menschen die Indogermanen eigentlich waren, wird nach wie vor kontrovers diskutiert.
Allein was die Urheimat angeht, existieren zurzeit mindestens drei konkurrierende Theorien: Die Steppen-Hypothese besagt, dass das Indogermanische als Lingua franca eines weit in die ukrainischen und russischen Steppen ausgreifenden Handelsnetzwerks entstand, dessen mögliches Zentrum eine florierende Kupferindustrie an der bulgarischen Schwarzmeerküste war. Gruppen von Viehnomaden, die von hier aus vor etwa sechstausend Jahren in mehreren Schüben zunächst in die westlicheren Regionen Europas und später in Richtung Asien vordrangen, verbreiteten diese Sprache unter den dort lebenden Völkern. Ein ganz anderes Bild zeichnet die Anatolien-Hypothese: Ihr zufolge waren die Indogermanen Bauern, beheimatet in der heutigen Türkei, die ihre Sprache zusammen mit der Landwirtschaft nach Europa brachten. In diesem Szenario begann die Wanderungsbewegung drei Jahrtausende früher, und die sprachliche Ausbreitung ging langsamer vor sich. Eine dritte Forschergruppe schließlich verortet die Mutter der indogermanischen Sprachen in der Kaukasusregion.
Die Versuche, die Fülle der unterschiedlichen Daten nach Art eines Puzzles zusammenzusetzen, stoßen immer wieder auf hohe Hürden, denn Gene, Sprachen und archäologische Artefakte folgen unterschiedlichen Mustern. Eine Sprache kann sich wandeln oder durch eine andere Sprache verdrängt werden, ohne dass sich die Sprachgemeinschaft genetisch verändert. Produkte, Techniken oder kulturelle Bräuche werden manchmal gemeinsam mit der Sprache ihrer "Erfinder" weitergegeben, manchmal aber auch ohne sie, sie können sich durch Migration ausbreiten, aber auch durch Handel oder Nachahmung. Weder die Überreste in der Erde noch das biologische Erbgut geben darüber von sich aus Auskunft. Entsprechend groß sind die Spielräume der Interpretationen und Schlussfolgerungen, die oft genug auch noch vom gerade herrschenden Zeitgeist gefärbt sind. Das Ganze ist ein Puzzle, dessen Vollendung sich immer weiter hinausschiebt, weil ständig neue Steine ins Spiel kommen.
Wer sich also in die Geschichte des Indogermanischen vertiefen will, hat es nicht nur mit komplexen Sprachverzweigungen, mit zwischen Irland und China mäandernden Migrationen und mit einer Vielzahl von Kulturen und ihren Verschmelzungen und Aufspaltungen zu tun. Er begibt sich auch auf den schwankenden Boden einer unübersichtlichen Forschungslandschaft, für die er einen Reiseführer braucht. Laura Spinneys Buch bietet eine solche Orientierungshilfe, die den aktuellen Forschungsstand spiegelt - jedenfalls soweit er auf Arbeiten beruht, die auf Englisch vorliegen.
Wie außerhalb des deutschen Sprachraums üblich, heißen die Indogermanen in diesem Buch "Indoeuropäer". Anders als der knallige "Urknall"-Titel der deutschen Ausgabe befürchten lässt, liefert die Autorin eine gut lesbare Darstellung, die gleichwohl die Komplexität des Themas nicht unterschlägt. Der Leser wird mitgenommen auf eine Reise, die nicht nur große zeitliche und geographische Räume durchmisst und einen Überblick über die vielfältigen Verästelungen dieser Sprachfamilie liefert. Er lernt auch etwas über die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Hypothesen und Forschungsmethoden, was angesichts der Theorieabhängigkeit der "Indogermanen" und ihrer Geschichte für eine seriöse Darstellung unabdingbar ist. Dafür muss man bereit sein, mit der Autorin immer wieder die Perspektiven zwischen Sachdarstellung, Erörterung und Spekulation zu wechseln, große Bögen - zeitlich, räumlich, kulturell - zu schlagen und anspruchsvolle wissenschaftliche Schlussfolgerungen nachzuvollziehen.
Dazwischen finden sich zur Auflockerung reportageartige Passagen, in denen Spinney ihre Begegnungen mit Wissenschaftlern während ihrer Recherchereisen schildert. Ob man diese Einsprengsel als persönliche Note willkommen heißt oder als überflüssige Menschelei empfindet, ist Geschmackssache. Als solche mag man auch ansehen, dass die Autorin für die Jahreszählung nicht Christi Geburt, sondern die "säkulare" Angabe "vor unserer Zeitrechnung" verwendet. Die Paradoxie, dass "vor unserer Zeitrechnung" mit Jahren rechnet, die ja außerhalb ebendieser Rechnung liegen sollen, hat schon die Geschichtswissenschaftler der DDR nicht gestört.
Keine Geschmackssache, sondern irritierend - zumal in einem solchen Buch - ist, dass verschiedentlich von "Deutsch" die Rede ist, wenn es eindeutig um das Germanische geht. Was die Angeln und Sachsen im fünften Jahrhundert ins keltisch-römische Britannien importierten, waren ihre germanischen Stammessprachen, nicht Deutsch, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht existierte. Zur philologischen Verfälschung wird diese Fehlbenennung, wenn die Autorin eine Passage aus Walter Scotts Roman "Ivanhoe" anführt, um zu illustrieren, wie sich die politisch-kulturelle Herrschaft der Französisch sprechenden Normannen und der untergeordnete Status der alteingesessenen Angelsachsen im Wortschatz des zwölften Jahrhunderts spiegeln: Ein Schweinehirt und ein Hofnarr diskutieren dem Referat der Autorin zufolge darüber, "dass ein Ochse (ox), ein Kalb (calf) und ein Schwein (pig) Deutsche sind, solange sie sich auf dem Bauernhof befinden, sich aber in Franzosen verwandeln, sobald sie mit Apfel im Mund auf der festlichen Tafel des Lords präsentiert werden: boeuf (Rindfleisch), veau (Kalbfleisch) und porc (Schweinefleisch)".
Tatsächlich ist bei Scott nicht von "Deutsch", sondern korrekterweise von "Saxon" (Sächsisch) die Rede. Auch das Wort "pig", das zu Ivanhoes Zeit auf Ferkel beschränkt war, kommt bei Scott nicht vor. Was die beiden wackeren Männer aus dem Volk als "good Saxon" loben, ist stattdessen "swine". Ob die Begriffsverwirrung auf das Konto der Autorin oder aber ihrer Übersetzerin geht, muss hier offenbleiben. Die englische Sprache jedenfalls trifft keine Schuld. Sie unterscheidet zwischen "German" und "Germanic". WOLFGANG KRISCHKE
Laura Spinney: "Der Urknall unserer Sprache".
Aus dem Englischen von Stephanie Singh.
Hanser Verlag, München 2025. 336 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.