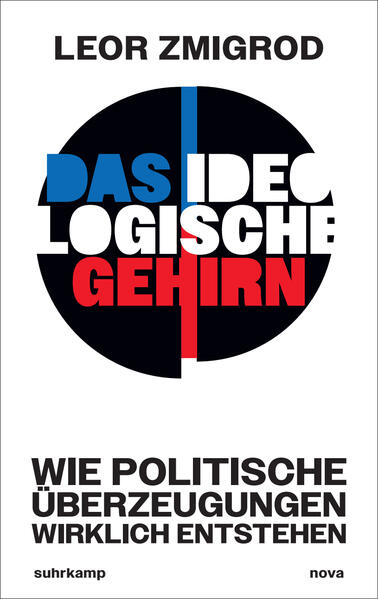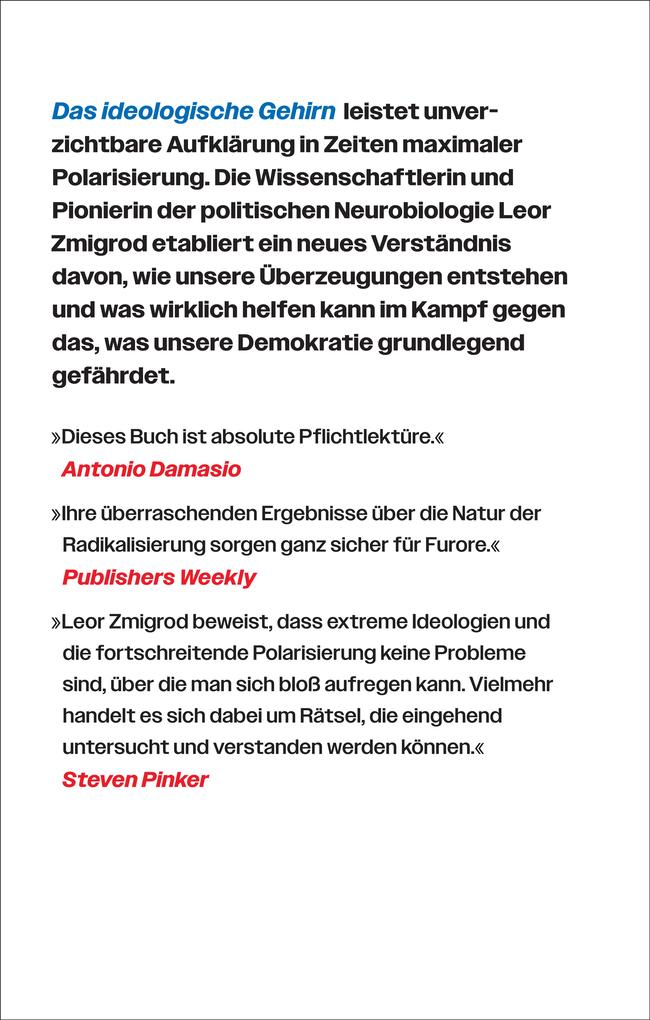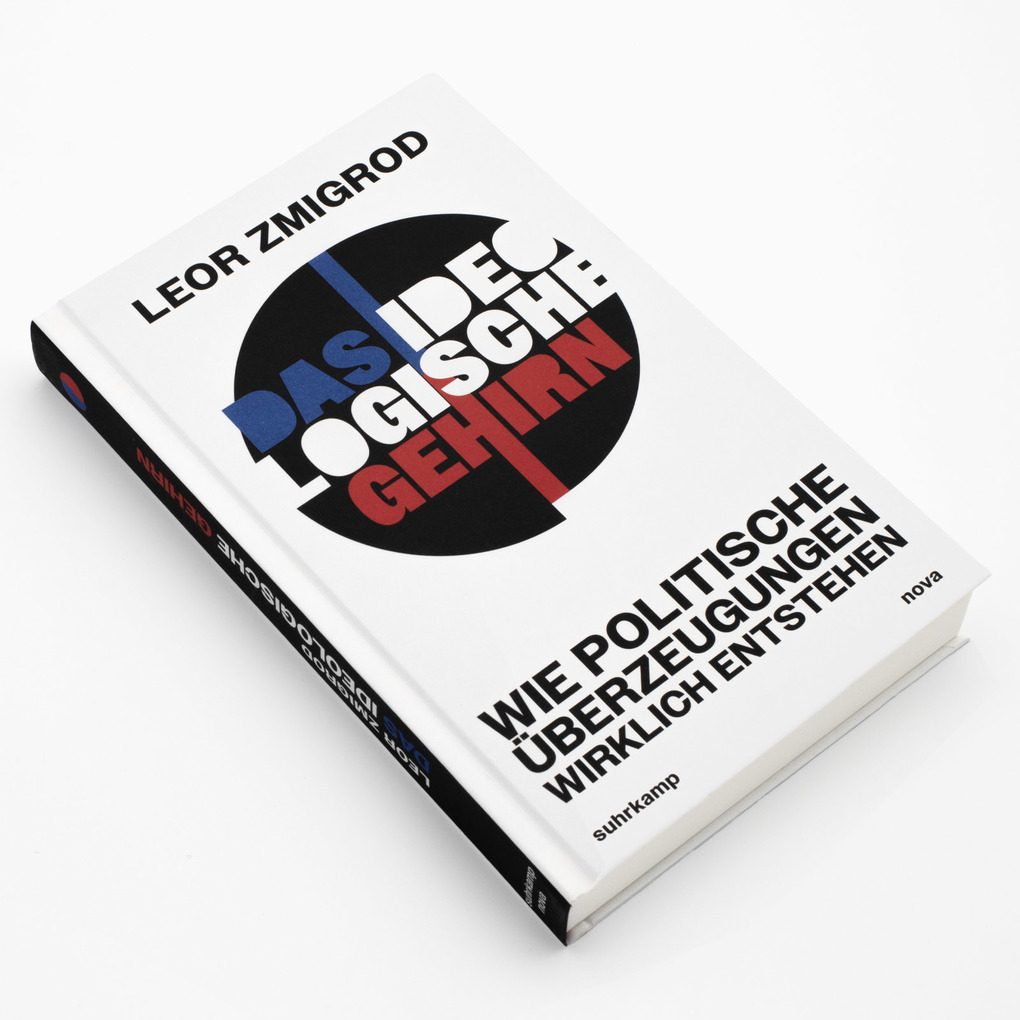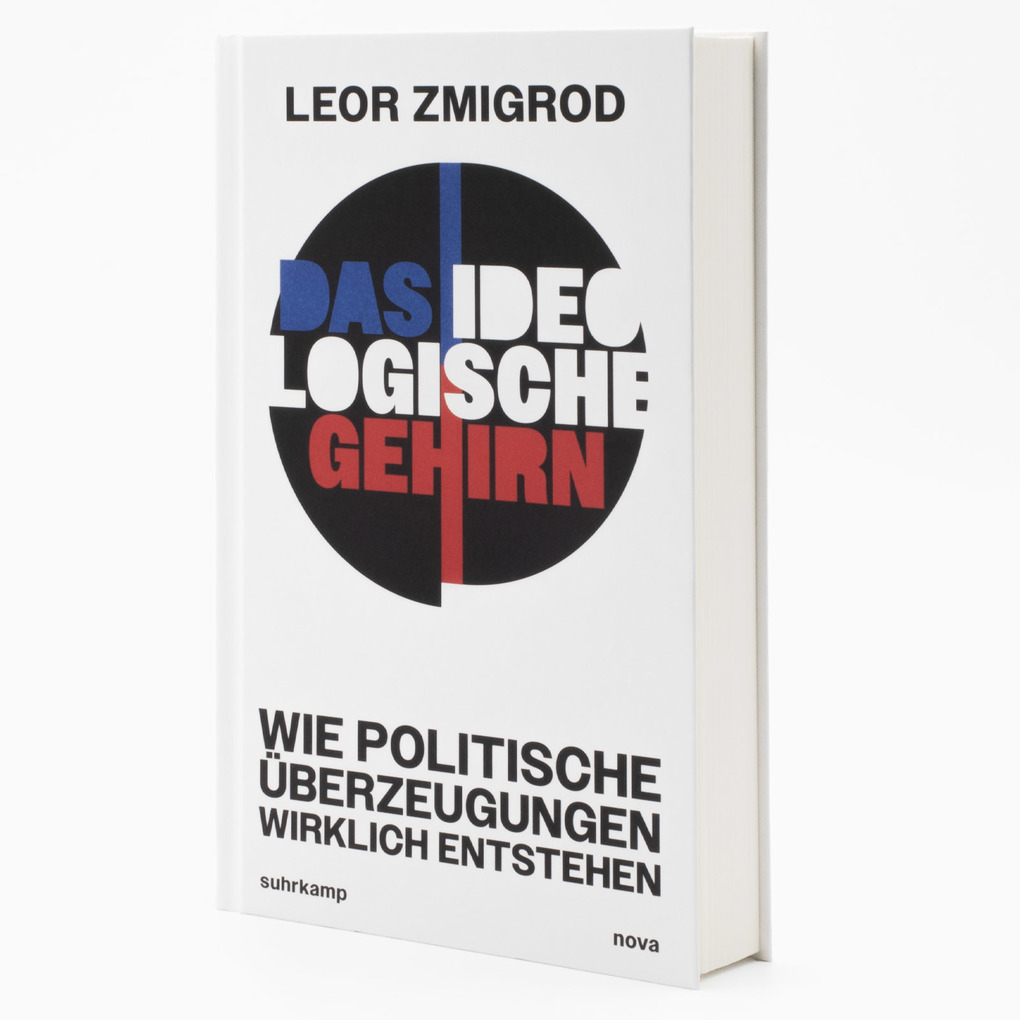Besprechung vom 25.07.2025
Besprechung vom 25.07.2025
An Neuronen hängt doch alles
Leor Zmigrod führt vor, was sich von der Neurobiologie so alles nicht erwarten lässt
Machen Sie sich bereit für einen kurzen Test: Vor Ihnen liegt ein Haufen Büroklammern. Welche Verwendungsmöglichkeiten fallen Ihnen spontan dazu ein? Wenn Sie damit nichts anderes anfangen können, als ein paar Blätter Papier zusammenzuklammern, dann sind Sie nicht nur sehr unkreativ, sondern wahrscheinlich auch ideologisch recht festgefahren. Vielleicht sind Sie gar ein Rechtsextremist oder ein religiöser Fanatiker. Wenn Sie die Büroklammern hingegen verwenden, um eigenwilligen Haarschmuck oder eine Leiter für Ihren Zwerghamster zu basteln - Glückwunsch! Die Chancen stehen gut, dass Sie eine vergleichsweise liberale, weltoffene Person sind.
Zu dieser Schlussfolgerung kommt zumindest Leor Zmigrod in ihrem Buch "Das ideologische Gehirn. Wie politische Überzeugungen wirklich entstehen". Mit ihren 29 Jahren gilt die Cambridge-Wissenschaftlerin als Begründerin der "politischen Neurobiologie" - ein Forschungszweig, der mit kognitionspsychologischen und neurologischen Verfahren zu ergründen versucht, weshalb manche Menschen besonders anfällig für Ideologie und Fundamentalismus sind, während andere dagegen gefeit zu sein scheinen. Mit diesem "neuen und radikal wissenschaftlichen Ansatz" möchte Zmigrod den Blick über soziologische, philosophische, politologische, historische, kulturelle Perspektiven weiten. Ihrer Meinung nach ist bisher vernachlässigt worden, wie sehr politische Ansichten eine neuronal-somatische Angelegenheit seien. Höchste Zeit zu zeigen, "wie ideologische Überzeugungen aus der Biologie" hervorgehen.
Gleich zu Beginn des Buches zeigt sie allerdings vor allem eines: einen bemerkenswert kruden Reduktionismus. So muss man kein Verfechter der Idee der unsterblichen Seele sein, um die Aussage, Bewusstsein und Gehirn seien "ein und dasselbe", absurd zu finden. "Denn es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass der Geist ohne das Gehirn existiert", schreibt Zmigrod und verkennt, dass die notwendige materielle Grundlage für die Existenz des Bewusstseins noch lange nicht identisch mit diesem ist. Nur lässt sich Bewusstsein als subjektives Erleben nun mal nicht so umstandslos durch bildgebende Verfahren dingfest machen wie bestimmte neuronale Aktivitäten.
Zmigrods Haupterkenntnis, dass "kognitive Rigidität zu ideologischer Rigidität wird", scheint auf den ersten Blick trivial. Waren denn wirklich all die Umfragen, Tests und aufwendigen Hirnscans notwendig, um zu der Einsicht zu gelangen, dass Menschen, die zu gedanklicher Starrheit neigen, auch eine Tendenz haben, sich weltanschaulich zu verbeißen? Doch je ausdauernder Zmigrod ihren zentralen Befund durch Empirie zu veranschaulichen versucht, desto zweifelhafter wirkt er. Zum einen liegt das an der relativ dünnen, chaotisch präsentierten Studienlage. Die genaue Zahl der Testteilnehmer wird selten genannt, häufig scheinen es kleine Stichproben zu sein, die Zmigrod als Grundlage für generalisierende Aussagen zur Hirnphysiologie des ideologieanfälligen Charakters dienen. Bisweilen werden Studien mit vermeintlich sensationellen Ergebnissen angeführt, die sich dann allerdings als nicht replizierbar erwiesen haben. Zum anderen scheint sich die Autorin nicht ausreichend darüber im Klaren, dass die Interpretation von Forschungsdaten hochgradig anfällig für Vorurteile und willkürliche Deutungsmuster ist. Das wird besonders deutlich, wenn sie sich daranmacht, die Gehirne gläubiger Menschen zu untersuchen, und dabei Religion pauschal mit Ideologie gleichsetzt.
Symptomatisch für das argumentative und begriffliche Durcheinander dieses Buchs sind auch Zmigrods wechselhafte Positionierungen zum biologischen Determinismus. In einer Passage arbeitet sie sich an dem Motto einer englischen Mädchenschule ab, das lautet: "Lasst uns das Gehirn wie einen Muskel behandeln und nicht wie einen Schwamm". In dem Slogan klingt die Hoffnung an, jedes Kind könne durch angemessene Förderung und Fleiß über sich hinauswachsen. Zmigrod jedoch hält diesen pädagogisch-humanistischen Appell für grundfalsch und wittert dahinter gar ein "Herrschaftsinstrument", eine gefährliche Ideologie der Gleichheit, die "natürliche Unterschiede und Anlagen" leugne.
Einige Seiten später schlägt sie plötzlich ganz andere Töne an und distanziert sich nachdrücklich von einem allzu platten Determinismus. Ihre Geschichte des ideologischen Gehirns sei eine Geschichte der Potentialitäten, die sich ausbilden können, aber nicht müssen. Natürlich gebe es kein Extremismus-Gen, das einen Menschen automatisch zum Nazi, Stalinisten oder Ökoterroristen werden lasse, natürlich spielten individuelle Erfahrungen, Ressourcen und das soziale Umfeld eine maßgebliche Rolle. Da ist sie plötzlich doch wieder auf Linie der englischen Mädchenschule.
Wortreich trägt Zmigrod ihren Vorschlag zur Extremismusprävention vor: Um mögliche autoritäre Veranlagung einzudämmen, müsse das flexible, kreative, nicht regelkonforme Denken bereits bei Kindern gefördert werden. Wie genau das geschehen soll, bleibt unklar. Auch fällt Zmigrod hier einmal mehr ihre inhaltsleere Minimaldefinition von Ideologie als "starrem Denken" auf die Füße. Denn ist es wirklich so gleichgültig, was wir denken, solange wir nur "flexibel" denken? Ist es nicht manchmal sogar notwendig, rigide an Prinzipien der Moral oder des Rechts festzuhalten? Und kann sich die von Zmigrod zum Allheilmittel verklärte Fähigkeit des flexiblen, anpassungsfähigen Denkens nicht auch in die Tugend des rücksichtslosen Karrieristen und Opportunisten verkehren? Die "politische Neurobiologie" hat noch sehr viel Arbeit vor sich, vor allem an sich selbst. MARIANNA LIEDER
Leor Zmigrod: "Das ideologische Gehirn". Wie politische Überzeugungen wirklich entstehen.
Aus dem Englischen von Matthias Strobel. Suhrkamp Verlag, Berlin 2025. 302 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.