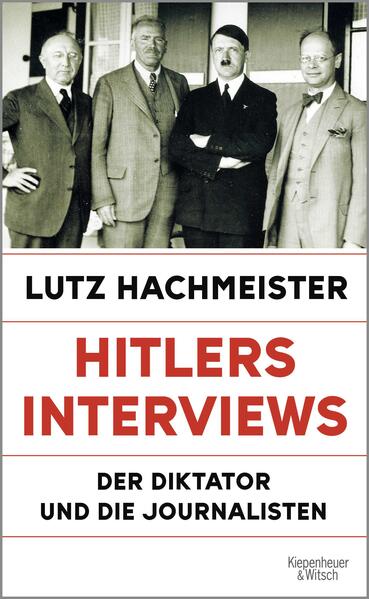
Zustellung: Sa, 10.05. - Di, 13.05.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Adolf Hitler hat im Verlauf seiner politischen Karriere der ausländischen Presse mehr als hundert Interviews gegeben. Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt fanden den deutschen Diktator als Gesprächspartner faszinierend. Lutz Hachmeister erzählt nun erstmals die aufschlussreiche Gesamtgeschichte dieser Treffen.
Schon vor dem Putschversuch von 1923 erschien in den USA ein erstes längeres Hitler-Interview, geführt von dem prominenten Deutsch-Amerikaner George Sylvester Viereck. Nach seiner Landsberger Haft zunächst einmal in der internationalen Versenkung verschwunden, wurde Hitler dann mit dem NS-Wahltriumph 1930 ein enorm begehrtes Objekt der Berichterstattung. Vermittelt durch seinen Medienberater »Putzi« Hanfstaengl, gaben sich bald Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt die Klinke in die Hand. Für viele von ihnen bedeuteten die Interviews einen Karrieresprung - die ultimative Trophäe. Nur wenige erkannten sein sinistres Potenzial, viele waren vor allem von der Obersalzberg-Inszenierung beeindruckt.
Lutz Hachmeister wertet die Interviews im Hinblick auf Hitlers jeweilige Medienstrategie im zeithistorischen Kontext aus und untersucht die Komplizenschaft zwischen Propaganda-Strategen und Reportern. Das aus Originalquellen und Archivmaterial gearbeitete Buch liefert einen neuen und modernen Blick auf ein von vornherein als Mediendiktatur geplantes Führersystem - und seine sich wandelnden Einschätzungen im Ausland. Und es geht der Frage nach, welche Dynamik auch heute zwischen Medien einerseits und Diktatoren oder Autokraten andererseits zu beobachten ist.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
07. November 2024
Sprache
deutsch
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
384
Autor/Autorin
Lutz Hachmeister
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Mit zahlreichen s/w-Abbildungen
Gewicht
548 g
Größe (L/B/H)
220/148/34 mm
ISBN
9783462002409
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»stellenweise verblüffend aktuell« Tilmann P. Gangloff, Mannheimer Morgen
»Seine Schilderungen und Schlussfolgerungen sind in mehrfacher Hinsicht lehrreich, vor allem für den journalistischen Umgang mit Diktatoren, Populisten oder autokratischen Politikern heute. « Thoralf Cleven, RND online
»Man kann daraus lernen, welche Grenzen kritische Pressearbeit angesichts absoluter Macht und totaler Skrupellosigkeit hat. « Matthias Heine, Die Welt
»Die Lektüre von Hachmeisters letztem Buch sollte in die Curricula aller Journalistenschulen aufgenommen werden. « René Schlott, Süddeutsche Zeitung
»glänzend recherchiert und geschrieben« Michael Meyer, Deutschlandfunk Andruck
»Mit großer Sach- und Quellenkenntnis gelingt es Lutz Hachmeister, durch die Perspektive der Auslandskorrespondenten einen neuen Blick auf Hitler und seine Medienstrategie zu werfen. « Sieglinde Geisel, Deutschlandfunk Kultur Lesart
»Mit Hitlers Interviews ist Hachmeister ein hochinteressanter Text gelungen, der weit über das Versprechen des Titels hinausgeht. « Carola Leitner, Onlinemagazin Fachjournalist
»Man liest das alles, ist unterhalten, informiert und ermahnt. Und dann schlägt man dieses Buch zu und weiß, wie sehr schon jetzt so ein Lutz Hachmeister fehlt. « Laura Hertreiter, Die Zeit
»Interessant in diesem Buch ist die Bestandsaufnahme einer internationalen Journalistenszenerie und die Kurzbiograpien dazu, in denen Hintergründe, fragwürdige Allianzen, Eitelkeiten der Branche, Verführbarkeit, Karrieresucht angedeutet werden. « Stefan Berkholz, SWR Kultur
»Seine Schilderungen und Schlussfolgerungen sind in mehrfacher Hinsicht lehrreich, vor allem für den journalistischen Umgang mit Diktatoren, Populisten oder autokratischen Politikern heute. « Thoralf Cleven, RND online
»Man kann daraus lernen, welche Grenzen kritische Pressearbeit angesichts absoluter Macht und totaler Skrupellosigkeit hat. « Matthias Heine, Die Welt
»Die Lektüre von Hachmeisters letztem Buch sollte in die Curricula aller Journalistenschulen aufgenommen werden. « René Schlott, Süddeutsche Zeitung
»glänzend recherchiert und geschrieben« Michael Meyer, Deutschlandfunk Andruck
»Mit großer Sach- und Quellenkenntnis gelingt es Lutz Hachmeister, durch die Perspektive der Auslandskorrespondenten einen neuen Blick auf Hitler und seine Medienstrategie zu werfen. « Sieglinde Geisel, Deutschlandfunk Kultur Lesart
»Mit Hitlers Interviews ist Hachmeister ein hochinteressanter Text gelungen, der weit über das Versprechen des Titels hinausgeht. « Carola Leitner, Onlinemagazin Fachjournalist
»Man liest das alles, ist unterhalten, informiert und ermahnt. Und dann schlägt man dieses Buch zu und weiß, wie sehr schon jetzt so ein Lutz Hachmeister fehlt. « Laura Hertreiter, Die Zeit
»Interessant in diesem Buch ist die Bestandsaufnahme einer internationalen Journalistenszenerie und die Kurzbiograpien dazu, in denen Hintergründe, fragwürdige Allianzen, Eitelkeiten der Branche, Verführbarkeit, Karrieresucht angedeutet werden. « Stefan Berkholz, SWR Kultur
 Besprechung vom 05.03.2025
Besprechung vom 05.03.2025
Zum Diktat beim Diktator
Fragen an den Führer: Lutz Hachmeister hat sich angesehen, wie die Gespräche Adolf Hitlers mit ausländischen Journalisten zustande kamen.
Ende August vergangenen Jahres starb Lutz Hachmeister unerwartet mit 64 Jahren in Köln. Im Frühjahr zuvor hatte er das Manuskript von "Hitlers Interviews" abgeschlossen. Das Buch ist also kein nachgelassenes, sondern ein vom Autor zur Veröffentlichung fertiggestellter Band: der Abschluss eines Lebenswerks, das Überblicksarbeiten ("Nervöse Zone") ebenso wie Fallstudien ("Heideggers Testament") zur Geschichte der deutschen Publizistik im zwanzigsten Jahrhundert umfasst. Die Beschränkung auf deutsche Themen hatte Hachmeister bereits in seinem Dokumentarfilm "Hotel Provençal" über ein Prominentendomizil an der Côte d'Azur und dem zugehörigen Filmbuch von 2021 aufgegeben. Mit seiner neuen und letzten Studie kehrt er einerseits nach Deutschland zurück, weitet aber andererseits den Rahmen ins Internationale aus - auf die Auslandspresse in der Weimarer Republik und im Dritten Reich.
Der entscheidende Satz zum Verständnis von "Hitlers Interviews" steht ganz am Ende. Hachmeister beschließt seine Danksagung mit einer Verbeugung vor seinen beiden Lektoren für ihre Geduld, "zumal sich dieses Projekt als wesentlich komplexer herausstellte, als ursprünglich absehbar war". Wer sich beim Lesen fragt, warum das Buch entgegen seinem Titel eben nicht hauptsächlich von den Interview-Aussagen des deutschen Diktators, sondern von Hitlers Gesprächspartnern und von dem Presseapparat handelte, der ihre Interviews einfädelte und überwachte, ist hier auf der richtigen Spur.
Zwischen 1922 und 1944 hat Hitler gut hundert Gespräche von unterschiedlicher Länge und Bedeutung mit ausländischen Journalisten geführt. Jeder und jede der etwa fünfzig Interviewer aus den Vereinigten Staaten, England, Frankreich, Polen, Südeuropa, Skandinavien, Japan und Südamerika brachte ein besonderes publizistisches Interesse und eine eigene politische Einstellung mit, jeder hatte ein Berufs- und Lebensschicksal vor und nach seinem Einsatz beim "Führer". Hachmeister versucht alle diese Aspekte auf gut dreihundert Textseiten zu versammeln und zusätzlich die Machtspiele und Intrigen innerhalb der Entourage aus Vertretern der Presseabteilungen des Auswärtigen Amts und des Reichspropagandaministeriums nachzuzeichnen, die Hitlers Begegnungen mit der Auslandspresse organisierte. Mit dieser Mammutaufgabe wäre selbst ein Buch von doppelter Länge kaum zurechtgekommen. Dass Hachmeisters biographische Angaben oft im Telegrammstil verfasst und seine zeithistorischen Hinweise auf ein Minimum reduziert sind, kann daher niemanden verwundern.
Schwerer wiegt eine erzählerische Entscheidung des Autors. Hachmeister hat die Interviews, von denen er berichtet, nicht durchgängig chronologisch, sondern nach Nationalitäten gegliedert, sodass seine Darstellung immer wieder neu ansetzen muss und die zeitliche Dimension in Hitlers Aussagen etwa über Krieg und Frieden oder die geplanten Maßnahmen gegen Juden verwischt wird. Dazu kommt, dass die beiden Kapitel über amerikanische und britische Pressevertreter, die allein ein Drittel des Buches ausmachen, nicht mit den frühesten Veröffentlichungen, sondern mit reportagehaften "Aufhängern" einsetzen - hier mit der Internierung der Amerikaner in Bad Nauheim nach Hitlers Kriegserklärung an ihr Land im Dezember 1941, dort mit Sefton Delmers rasenden Reportagen von Hitlers Wahlkampfflügen im April 1932 und Februar 1933.
Beides ist dramaturgisch wirkungsvoll, aber analytisch irreführend, zumal die beiden wichtigsten anglophonen Gespräche mit Hitler weder von den Internierten in "Badheim", wie es damals hieß, noch von Delmer geführt wurden, sondern von zwei frühen Sympathisanten des Nationalsozialismus: George S. Viereck und Karl von Wiegand. Viereck befragte den damaligen Frontmann der Kleinpartei NSDAP im Oktober 1923 für die Zeitschrift "American Monthly", und von Wiegand, der für die Hearst-Zeitungen arbeitete und bereits seit 1922 Kontakt zu Hitler hatte, bekam seine letzte Audienz bei dem Diktator im Juni 1940 in einem Schloss im besetzten Belgien. Beide Male gab Hitler seine Großmachtpläne unumwunden zu Protokoll, wenn auch mit ganz unterschiedlichem Zungenschlag. Während er in dem frühen Interview freimütig über die "Ausmerzung" des Bolschewismus, die Expansion nach Osten und die Entrechtung der Juden fabulierte, bemühte er sich knapp zwei Jahrzehnte später, den Amerikanern die Angst vor seinen Expansionsgelüsten nach Westen zu nehmen: Wie sich deren Kontinent "sein Leben gestaltet", interessiere ihn nicht, auch das britische Empire wolle er nicht vernichten, es solle nur "die deutschen Kolonien zurückgeben". - "Und ich werde sie bekommen!"
Neben diesen beiden Höhepunkten wirken die übrigen Gesprächsepisoden des Buches blass. Am ehesten sticht neben der berühmten Schilderung Dorothy Thompsons, die den künftigen Reichskanzler in ihrer Reportage für "Cosmopolitan" als "belanglos und redselig", "formlos, fast gesichtslos" und "knorpelig" beschrieb, noch ein Interview des Franzosen Fernand de Brinon von 1933 hervor, in dem der gerade an die Macht gelangte Hitler in napoleonischem Tonfall erklärt, er habe "keinen Thron geerbt", sondern "eine Doktrin, an die ich mich halten muss". Der Rechtsanwalt, Journalist und schließlich Politiker de Brinon ist auch eine der interessantesten Figuren des Buches, weil er Hitlers Regime von Anfang an unterstützte. 1944 wurde er Präsident der Vichy-Regierung im Sigmaringer Exil und drei Jahre später wegen Kollaboration hingerichtet.
Die Ansprechpartner der Auslandspresse im Partei- und Staatsapparat wechselten während der zweiundzwanzig Jahre, in denen Hitler Interviews gab, ziemlich häufig. Besonders nach der "Machtergreifung" wurde der Bürostuhl in Hitlers Nähe zum Schleudersitz. Das bekam zuerst Ernst "Putzi" Hanfstaengl zu spüren, der dem Diktator seit dessen Münchner Kampfzeit als PR-Berater diente. 1937 wurde er von Göring und Goebbels ins Exil getrieben, an seine Stelle traten Reichspressechef Otto Dietrich und der Leiter der Presseabteilung der NSDAP, Karl Bömer. Bömer fiel freilich 1941 in Ungnade, nachdem er bei einem Empfang in der bulgarischen Botschaft im Rausch die Pläne zum Überfall auf die Sowjetunion verraten hatte. Auf ihn folgte Paul Karl Schmidt, der Pressechef des Auswärtigen Amts, der nach dem Krieg als Populärhistoriker zum Bestsellerautor aufsteigen sollte. Allerdings hatte Schmidt wenig zu tun, denn inzwischen schottete sich Hitler weitgehend von der Öffentlichkeit ab. Die letzte Unterredung gewährte er im März 1944 dem schwedischen Reporter Christian Jäderlund per Telefon. Es ging um alliierte Garantien für die Unabhängigkeit Finnlands bei einem Friedensschluss. Hitler erklärte, England und Amerika befänden sich selbst in "schweren inneren Krisen". Die Weltpresse nahm davon keinerlei Notiz.
Hachmeisters Buch schließt mit einem Schnelldurchlauf durch bekannte Gespräche mit Diktatoren seit 1945. Hier zeigt die Darstellung eine analytische Schärfe, die sich wohltuend von manchen vorhergehenden Passagen abhebt, und man ahnt, was aus "Hitlers Interviews" hätte werden können, wenn sich der Autor auf eine Typologie der Interviewer beschränkt hätte, statt nach lexikalischer Vollständigkeit zu streben - von den kritischen Beobachterinnen wie Dorothy Thompson und Oriana Fallaci bis zu den Schranzen und Kollaborateuren wie Karl von Wiegand und dem Putin-Versteher Tucker Carlson. Aber dieses Buch hat Lutz Hachmeister nicht geschrieben. So muss man sich an das halten, was seine Recherche ergeben hat, und das ist immer noch spannend und vielsagend genug. ANDREAS KILB
Lutz Hachmeister: "Hitlers Interviews". Der Diktator und die Journalisten.
Kiepenheuer & Witsch Verlag, Köln 2024. 384 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.








