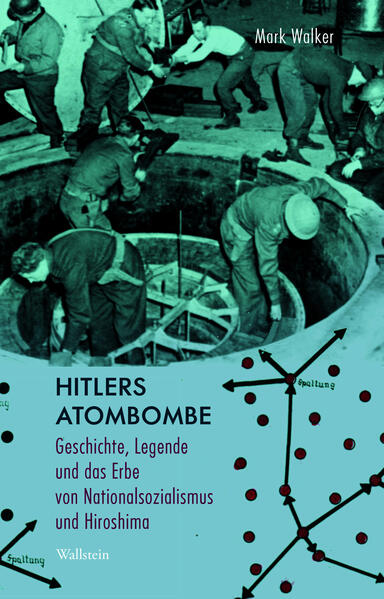Besprechung vom 10.09.2025
Besprechung vom 10.09.2025
Die Schatten einer Bombe
Mark Walker legt eine
umfassende Darstellung des deutschen Uranprojekts während des Zweiten Weltkriegs vor. Es ist das definitive Standardwerk zum Thema.
In der Fernsehserie "The Man in the High Castle" aus dem Jahr 2015 ist die Geschichte etwas anders verlaufen: Das nationalsozialistische Deutschland hat die Alliierten besiegt und sich halb Nordamerika einverleibt. Hitlers Statthalter residiert allerdings in Manhattan, denn auf Washington, D.C., hatte die Luftwaffe ein "Heisenberg-Device" abgeworfen: eine Atombombe.
In der Realität hat es eine deutsche Kernwaffe nie gegeben. Und das, obwohl die Kernspaltung Ende 1938 in Berlin entdeckt wurde, ihr militärisches Potential bereits vor Kriegsbeginn erkannt worden war und einige der damals besten deutschen Physiker, namentlich Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker, nicht emigriert waren. Sie arbeiteten während des Krieges aber lediglich an einem Kernreaktor, der sogenannten Uranmaschine, die sie aber bis zum Ende der nationalsozialistischen Herrschaft nicht kritisch bekamen.
Aber warum wurde im Hitlerreich keine Atombombe gebaut? Konnten die deutschen Physiker dem Führer keine Bombe schenken, oder wollten sie es nicht? Waren sie zu dumm dazu oder zu integer? Wenn diese Alternative heute absurd klingt, ist das nicht zuletzt Mark Walker zu verdanken. Der amerikanische Historiker hatte 1987 seine Dissertation vorgelegt, die 1990 unter dem Titel "Die Uranmaschine" auf Deutsch erschien. Darin präsentierte Walker eine sorgfältige Auswertung der damals verfügbaren Quellen über das deutsche Uranprojekt während des Zweiten Weltkrieges. Bis dahin war das Thema weniger von Historikern auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen bearbeitet worden, vielmehr bestimmten die publizistischen Aktivitäten dreier Männer das Bild: des aus den Niederlanden stammenden amerikanischen Physikers Samuel Goudsmit, des Journalisten Robert Jungk sowie Werner Heisenbergs, der in Nachkriegsdeutschland zu einem der dort einflussreichsten Wissenschaftler aufgestiegen war.
Auf Goudsmit geht dabei die Vorstellung zurück, die deutschen Physiker seien nicht kompetent genug gewesen, um eine Bombe zu bauen, während Jungk in seinem erstmals 1956 erschienenen Bestseller "Heller als tausend Sonnen" Heisenberg und seine Kollegen als moralische Sieger darstellte, da sie die Bombe durchaus hätten bauen können, sie Hitler aber vorenthielten, während ihre Kollegen auf der anderen Seite Kernwaffen entwickelten, die dann auch eingesetzt wurden.
Mark Walker widersprach in seiner Dissertation sowohl Goudsmit als auch Jungk. Damit war dem Thema das Schwarz-Weiß-Schema abhandengekommen, und es wurde entsprechend unübersichtlich, umso mehr als nach 1990 eine Reihe neuer Quellen zugänglich wurde. Allen voran das Archivmaterial aus dem Ostblock, aber auch die erst 1992 veröffentlichten Farm-Hall-Protokolle - Berichte über heimlich abgehörte Gespräche einer Gruppe deutscher Atomforscher, darunter Heisenberg und von Weizsäcker, während ihrer Internierung in England. Weiter wurden 2002 Briefe publiziert, die der dänische Physiker Niels Bohr an Heisenberg geschrieben, aber nie abgeschickt hatte und in denen es um das geheimnisumwitterte Treffen der beiden im September 1941 in Kopenhagen ging. Schließlich wäre da noch der Briefwechsel Heisenbergs mit seiner Frau aus den Jahren 1937 bis 1946, der Einblicke in Heisenbergs Wahrnehmung der damaligen Umstände gewährt. Er wurde 2011 veröffentlicht.
Der Integration dieser Quellen in ein immer besseres Verständnis der Geschichte des deutschen Uranprogramms hat Mark Walker einen guten Teil seines Gelehrtenlebens gewidmet. Nun hat er eine umfassende Darstellung dieser Geschichte vorgelegt. Solange nicht noch weitere, bislang unbekannte oder unzugängliche Primärquellen auftauchen, kann sie zweifellos als das historische Standardwerk zu diesem Thema gelten.
Denn "Hitlers Atombombe" ist weit mehr als eine Neuausgabe der "Uranmaschine". Um die deutsche Kernforschung während des Krieges selbst geht es auch nur im ersten der beiden Hauptteile des Buches. Diesen vorangestellt ist eine Historiographie, in der Walker einen Überblick über die Literatur zum Thema seit Samuel Goudsmits ersten Veröffentlichungen im Jahr 1946 gibt. Nicht wenigen Titeln attestiert er dabei jedoch einen viel zu unkritischen Umgang mit Quellen aus der Nachkriegszeit. "Es ist schlicht abwegig", schreibt Walker, "Aussagen für bare Münze zu nehmen, die nach dem Krieg entweder von Wissenschaftlern gemacht wurden, die ihr Verhalten rechtfertigen wollten, oder von solchen, die sich gegenseitig zu entlasten versuchten."
Die deutschen Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet der Kernspaltung in den Jahren 1938 bis 1945 anhand und in den Grenzen der zeitgenössischen Quellen umfassend zu rekonstruieren sowie die Motivlagen wichtiger Akteure zu erhellen, allen voran Werner Heisenbergs - das ist das Ziel des ersten Hauptteils. Nach einem einleitenden Kapitel über die Farm-Hall-Protokolle gliedert Walker die Geschichte der Kernforschung im Dritten Reich in fünf einander ablösende Phasen, die selbst nicht streng chronologisch präsentiert werden, um so verschiedene Entwicklungsstränge oder Akteure verfolgen und in ihre jeweiligen Kontexte stellen zu können.
Die sich damit ergebende Erzählung hat keinen sehr übersichtlichen Plot. Erleichtert wird ihre Lektüre aber durch Zusammenfassungen am Ende jedes Unterkapitels. Wichtig sind zudem die sich an vier dieser Zusammenfassungen jeweils anschließenden "Epiloge", in denen Walker die Fortschritte der deutschen Arbeiten an der Kernspaltung in jeder Phase mit dem vergleicht, was auf diesem Feld in den Vereinigten Staaten und Großbritannien geschah.
Demnach hatten Heisenberg und Co. in den ersten beiden Kriegsjahren die Nase vorn. "Im Sommer 1942 besaßen die Deutschen keine so tiefen und detaillierten Kenntnisse über Isotopentrennung, Uranmaschinen und die Funktionsweise einer Atombombe wie ihre amerikanischen Kollegen", schreibt Walker. "Aber der Rückstand war auch nicht besonders groß." Allerdings war westlich des Atlantiks schon früh und viel konkreter über den Bau einer Nuklearwaffe nachgedacht worden, insbesondere nach der Veröffentlichung einer Denkschrift der beiden nach England emigrierten Physiker Otto Frisch und Rudolf Peierls im März 1940, die eine äußerst optimistische Abschätzung der für eine Bombe erforderlichen Menge spaltbaren Materials enthielt. Der Gedanke, das könne auch Heisenberg nicht entgangen sein, sowie die Information, die Deutschen hätten versucht, sich schweres Wasser zu beschaffen, eine nukleartechnisch wichtige Ressource, setzte die Alliierten unter Zeitdruck.
Doch auf deutscher Seite verfolgte man stets nur den Bau eines Reaktors. Mögliche Hinweise auf kerntechnische Waffenentwicklungen oder entsprechende Tests unter der Ägide der SS, auf die der Historiker Rainer Karlsch vor Jahren in sowjetischen Archivalien stieß, hält Walker für unzureichend, um etwas an diesem Bild zu ändern. Die Gründe für die deutsche Beschränkung auf die Uranmaschine sind indes komplex.
In den ersten beiden Kriegsjahren waren die deutschen Investitionen und Fortschritte nicht so groß, als dass sich Heisenberg und Kollegen trauen konnten, den Militärs Versprechungen zu machen. Andererseits: "Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Krieg die Forschung noch nicht nennenswert behindert", schreibt Walker. "Mächtige neue Waffen schienen auch nicht notwendig zu sein." Als sich dann im November 1942 der Kessel von Stalingrad schloss und man eine Wunderwaffe hätte gebrauchen können, hatte der Krieg der Infrastruktur des Hitlerreiches schon so zugesetzt, dass es den deutschen Physikern nur noch darum ging, ihre Arbeit überhaupt irgendwie fortsetzen zu können - sei es, um nach Kriegsende mit dem Pfund ihres reaktortechnischen Vorsprungs wuchern zu können, von dem sie in Unkenntnis der alliierten Aktivitäten ausgingen, oder sei es auch nur, um nicht noch zur Front eingezogen zu werden.
Nur, verweigert hat man sich eben auch nicht. "Ungeachtet dessen, was Otto Hahn, Werner Heisenberg, Carl Friedrich von Weizsäcker und andere nach dem Krieg behaupteten, gab es keine Entscheidung, keine Atombomben zu bauen oder die wissenschaftliche Arbeit auf Grundlagenforschung zu beschränken", schreibt Walker. "Im Rahmen der immer verzweifelteren Kriegsanstrengungen Deutschlands wäre Ersteres überflüssig und Letzteres absurd gewesen."
Der zweite Hauptteil des Buches trägt den Titel "Mit der Bombe leben". So hatte Carl Friedrich von Weizsäcker 1963 eine Serie von Essays für die "Zeit" überschrieben, in welchen der zum Philosophen und Friedensforscher mutierte Physiker seine allerdings differenzierte Sicht auf das nukleare Wettrüsten im Kalten Krieg darlegte. Bei Walker geht es aber immer noch um "Hitlers Atombombe", mit der von Weizsäcker und andere nun leben mussten. Auch wenn es die Bombe selbst nie gab, hatten sie doch unter dem Hitler-Regime an einer Technologie gearbeitet, welche die schrecklichste jemals eingesetzte Waffe hervorgebracht hatte.
Damit warf auch das deutsche Uranprogramm selbst - und nicht nur das, was seine bloße Möglichkeit bei den Westalliierten und in weiterer Folge im Reich Stalins angestoßen hatte - lange Schatten in die Nachkriegszeit. Ihnen spürt Walker nun ähnlich akribisch nach wie dem Geschehen vor 1945, wobei gewisse Dopplungen mit der den Hauptteilen vorangestellten Historiographie unvermeidlich sind.
Die Bildung und Pflege von Legenden, die "Vergangenheitspolitik" der Akteure, wie Walker dies mit einem vom Historiker Norbert Frei geprägten Begriff nennt, bildet einen ebenso faszinierenden Epilog zur Geschichte von der Uranmaschine wie auch anderes, das den Akteuren ermöglichte, mit ihrer Bombe zu leben: "Weizsäckers zweifellos aufrichtiges Engagement gegen die Gefahren der nuklearen Proliferation und eines Atomkrieges erlaubten ihm, die noch verbliebene Ächtung seiner Person nach dem Krieg zu überwinden."
Wobei man bei Walker auch erfährt, dass nicht nur die deutschen Physiker sich die Vergangenheit zur Bewältigung der Gegenwart zurechtbogen: Als Samuel Goudsmit den im Reich verbliebenen Physikern nukleare Inkompetenz diagnostizierte, ging es ihm vor allem um einen Beleg seiner These, der Dirigismus des Hitlerregimes habe die deutsche Wissenschaft ruiniert. Damit wollte Goudsmit ein allgemeines Argument für die Freiheit der Wissenschaft von staatlicher Oberhoheit stützen. Die nämlich sah er damals in seiner amerikanischen Wahlheimat gerade akut gefährdet.
Helden zu bewundern oder Schurken zu verachten gibt es in Sachen Uranprogramm also auch nach 1945 nicht. Und insbesondere Walkers differenzierter Sicht auf die Person Werner Heisenbergs merkt man die jahrzehntelange Beschäftigung mit dieser Figur an. Nach der Lektüre seines Buchs glaubt man etwas besser zu verstehen, warum Heisenberg 1939, als es ihm ein letztes Mal möglich gewesen wäre, nicht in die USA emigrierte, obgleich er keineswegs mit den Nazis sympathisierte. Aber man versteht auch, was sowohl die anfänglichen deutschen Erfolge an der Front als auch Heisenbergs Spitzenstellung unter den deutschen Physikern nach Jahren der Anfeindungen durch die Anhänger einer "Deutschen Physik" mit dem Nobelpreisträger gemacht haben mussten, als er im September 1941 nach Kopenhagen fuhr. Niels Bohr mag Heisenbergs Selbstbewusstsein ein Stück weit fehlinterpretiert haben, aber dass dieser bei seinem Besuch bei Bohr als Abrüstungsaktivist aufgetreten sei, wie er nach dem Krieg suggerierte und Robert Jungk es sich ausgemalt hat, das erscheint sowohl nach Quellenlage als auch psychologisch unglaubhaft.
Wesentlich wahrscheinlicher ist für Mark Walker hier etwas anderes: "Wenn es Heisenberg klar erschien, dass Atomwaffen in Deutschland nicht machbar sein würden, dann versuchte er bei seinem Besuch in Kopenhagen (...), als deutsche Truppen tief in die Sowjetunion vordrangen und ein möglicher Krieg zwischen Deutschland und Amerika wahrscheinlich erschien, eben nicht, alle Atomwaffen zu verhindern, sondern nur die amerikanischen."
Damit ist Heisenberg so gründlich gescheitert, wie er in seiner Vergangenheitspolitik nach 1945 erfolgreich gewesen ist. Auch in der 1962 erschienenen literarischen Vorlage zu "The Man in the High Castle" gibt es eine deutsche Atombombe, aber nicht als "Heisenberg-Device". Sein Name kommt in dem Roman nicht vor. ULF VON RAUCHHAUPT
Mark Walker: "Hitlers Atombombe". Geschichte, Legende und das Erbe von Nationalsozialismus und Hiroshima.
Aus dem Englischen von Thorsten Schmidt.
Wallstein Verlag, Göttingen 2025. 476 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.