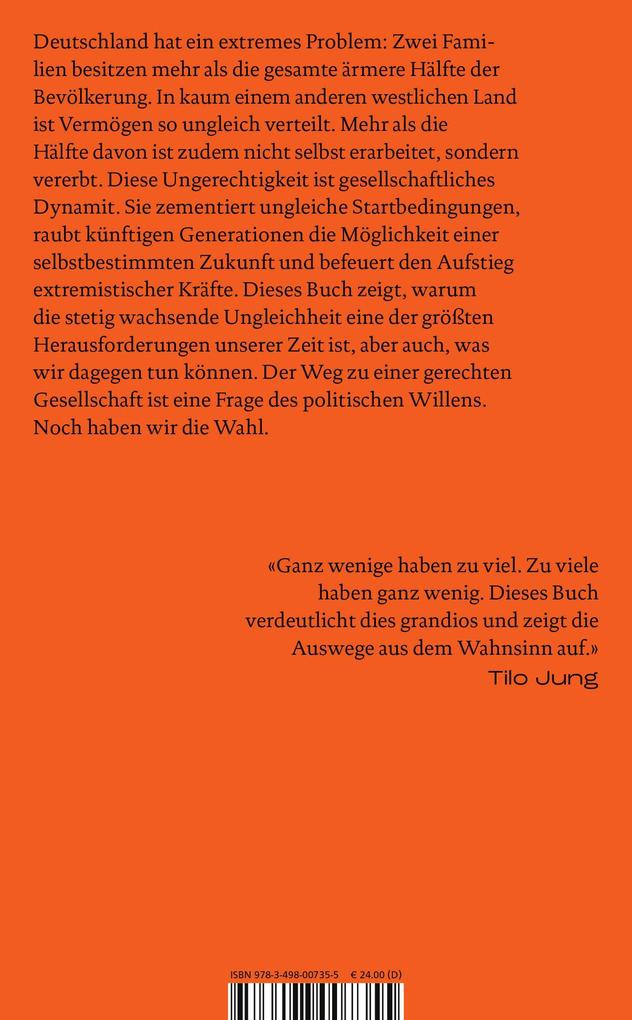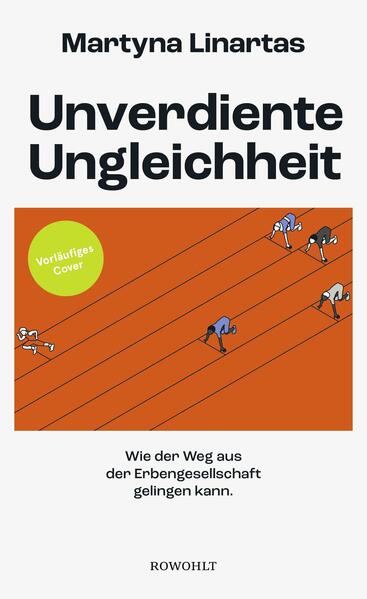
Zustellung: Di, 12.08. - Do, 14.08.
Sofort lieferbar
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Noch nie gab es so viel Reichtum - und das ist ein Problem für uns alle!
In kaum einem anderen westlichen Land ist Vermögen so ungleich verteilt wie in bei uns - und die Schere geht immer weiter auf. Dieses Buch zeigt das schockierende Ausmaß der Ungleichheit in Deutschland. Dass die Vermögen der Reichen von Generation zu Generation immer weiter wachsen, während jeder Sechste in Armut lebt, ist gesellschaftliches Dynamit. Martyna Linartas zeigt, dass es von unserem politischen Willen abhängt, daran etwas zu ändern, und wie eine gerechte Lösung aussehen könnte.
In dieser hellsichtigen und fundierten Analyse wird das politische Tabuthema unserer Zeit seziert: Dass wir die Reichen nicht besteuern, gefährdet unseren Wohlstand, unsere Umwelt und unsere Demokratie. Aber es geht auch anders - wenn wir nur wollen! Anhand von exklusiven Interviews mit der mächtigen Wirtschaftselite über Ungleichheit und das Zusammenspiel von Wirtschaft und Politik sowie einer einmaligen historischen Analyse zeigt sich, wie eine Besteuerung von Überreichen funktionieren kann. Dieses Buch gibt uns alle Argumente an die Hand, um jetzt zu handeln.
«Ganz wenige haben zu viel. Zu viele haben ganz wenig. Dieses Buch verdeutlicht dies grandios und zeigt die Auswege aus dem Wahnsinn auf.» - Tilo Jung
Produktdetails
Erscheinungsdatum
15. April 2025
Sprache
deutsch
Untertitel
Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann.
3. Auflage.
Zahlreiche s/w-Abbildungen.
Auflage
3. Auflage
Seitenanzahl
320
Autor/Autorin
Martyna Linartas
Illustrationen
Zahlr. s/w-Abb.
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Abbildungen
Zahlr. s/w-Abb.
Gewicht
412 g
Größe (L/B/H)
206/133/32 mm
ISBN
9783498007355
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
 Besprechung vom 25.07.2025
Besprechung vom 25.07.2025
Alle sollen etwas erben können
Soziale Ungleichheit im Visier: Martyna Linartas möchte den Staat bei der Vererbung von Vermögen viel kräftiger zulangen sehen
Stellen Sie sich vor, demnächst würden Sie Ihren 18. Geburtstag feiern, oder eines Ihrer Kinder. Herzlichen Glückwunsch! Der Staat hat Ihnen oder Ihrem Kind nämlich gerade 20.000 Euro überwiesen. Vielleicht sogar mehr - 60.000 könnten es auch sein. Das wäre doch mal ein schönes Geschenk zur Volljährigkeit, selbstverständlich steuerfrei. Sie könnten sich damit ein Auto kaufen, das Geld anlegen, ein Studium finanzieren oder es einfach auf den Kopf hauen. Der Staat würde Ihnen da keine Vorschriften machen, sondern auf ihre Vernunft setzen. Nennen wir dieses Geburtstagsgeschenk Startkapital, Gründungsdarlehen oder einfach Grunderbe. Vielleicht haben Sie vermögende Eltern, dann erben Sie später noch mal richtig, vielleicht sind Ihre Eltern aber auch arm, dann erben Sie wohl nur dieses eine Mal. Woher käme das Geld? Der Staat hätte es eingezogen als Erbschaftsteuer von denen, die tatsächlich etwas von ihren Eltern geerbt haben. Ein klassischer Fall also von staatlicher Umverteilung: Das Vermögen von wenigen wird verteilt zugunsten vieler. Damit hätten nicht alle gleich viel, aber zumindest hätten alle etwas und keiner gar nichts. Ist das nicht eine sympathische Idee, die unsere Gesellschaft gerechter, solidarischer und damit demokratisch stärker machen würde?
Martyna Linartas ist davon überzeugt. Die Idee selbst stammt nicht von ihr, aber in ihrem Buch verteidigt Linartas sie mit großer Verve. Die Argumentation von "Unverdiente Ungleichheit", was eigentlich nur "Unverdienter Reichtum" bedeutet, ist eher schlicht: Die Ungleichheit der Vermögen sei das "Grundproblem" unserer Gesellschaft. Ein Skandal sei es, dass wenige Familien zusammen mehr besäßen als die gesamte ärmere Hälfte der deutschen Bevölkerung. Diese Familien - also die Klattens, Albrechts oder Boehringers - sind Linartas' Feindbild. Das "Spermalotto", das ihre Angehörigen so drastisch begünstigt habe, sei extrem ungerecht, es werde viel zu viel Vermögen vererbt, ohne dass der Staat dabei kräftig zulangt.
Linartas zeichnet mit breitem Pinsel ein düsteres Bild von dem zu einer "Erbengesellschaft" verkommenen Deutschland. Die "perfide Vermögensungleichheit" sei "der Dünger auf dem braunen Nährboden extremistischer Parteien". Die Erbschaftsteuer sei ein Witz, sie müsste drastisch erhöht werden, um so die soziale Ungleichheit auszugleichen. Das Instrument dafür wäre das besagte Grunderbe, also das Erbe für alle, das Volkserbe gewissermaßen, mit dessen Hilfe die soziale Ungleichheit wieder das niedrige - also wohl verdiente - Ausmaß jener glücklichen Jahre annehmen würde, als die meisten noch Volkswagen fuhren, die Volksparteien wählten und das deutsche Volk auch ethnisch viel gleicher war als heute.
Wissenschaftlich ist der Fokus des Buchs nicht zu beanstanden. Linartas fundiert ihre engagierte Polemik mit einer Fülle von Statistiken, die keinen Zweifel daran aufkommen lassen, dass der Staat und die Parteien (außer der Linken) an der Besteuerung der Vererbung großer Vermögen in Deutschland ein bemerkenswert geringes Interesse zeigen. Und man muss ihr auch völlig recht geben, dass eine ernsthafte Auseinandersetzung über die immensen Summen, die in Deutschland vererbt werden, tatsächlich nicht stattfindet. Aktuell sind das rund 400 Milliarden Euro im Jahr, dagegen sind die Einnahmen durch die Erbschaftsteuer mit etwa neun Milliarden Euro tatsächlich lächerlich - am Gesamtvolumen der jährlichen Steuereinnahmen machen sie nur ein Prozent aus. Das ist aber alles bekannt, Linartas verrät hier keine skandalösen Geheimnisse, sondern beschreibt einen Skandal, der allerdings keine Empörung auslöst. In der politischen Debatte kommen die soziale Ungleichheit und mögliche Maßnahmen dagegen nur am Rande vor.
Linartas kann auch vorrechnen, dass die Finanzierung eines solchen Grunderbes durchaus machbar wäre. Für die tatsächlichen Erben bliebe noch genug übrig. Läge das Grunderbe bei etwa 20.000 Euro, wären das jährliche Kosten in Höhe von etwa 15 Milliarden. Man könnte aber fragen, warum Linartas für dieses Argument dreihundert Seiten braucht, inklusive einer länglichen Geschichte der Erbschaftsteuer in Deutschland, die bis zum Wirken von Matthias Erzberger zurückgeht. Für ihre Argumentation ist dieser Exkurs gar nicht nötig. Was dagegen nötig gewesen wäre, fehlt: etwa eine andere Auswahl ihrer Gesprächspartner. Man hätte erwartet, dass sie mit reichen Erben spricht, etwa mit Felix Klatten oder Johannes von Baumbach. Oder unbedingt mit der BASF-Erbin Marlene Engelhorn. Stattdessen sind die von Linartas Interviewten allesamt mächtige Manager der deutschen Wirtschaft, also sicher selbst sehr reich, aber keine Erben großer Familienvermögen. Sie alle setzen Bildung ganz oben auf ihre eigene Prioritätenliste für Maßnahmen zur Reduzierung sozialer Ungleichheit. Kein Wunder, wenn man etwa mit Joe Kaeser spricht, damals CEO von Siemens. Beruf seines Vaters: Fabrikarbeiter. Linartas erklärt die Aufwärtsmobilität in Deutschland trotzdem kurzerhand für ein Märchen - dabei sind diese Manager perfekte Beispiele, wie weit man es auch ohne Erbe durch akademische Bildung bringen kann.
Man fragt sich, warum Linartas Vertreter der Wirtschaftselite befragt, aber dann wenig Interesse an deren Lebensläufen zeigt. Allerdings hält sie Bildung grundsätzlich für kein probates Mittel gegen soziale Ungleichheit, ihre Bemerkungen dazu wirken lustlos, das "Gerede von besserer Bildung in der Breite" sei nur "eine leere Floskel". Sie zeigt ein bemerkenswertes Desinteresse nicht nur an Schulen und Ausbildungswegen, sondern auch daran, warum diese scheitern und in Armut führen können. Auch der Zusammenhang von neuer Armut und der Zuwanderung kommt bei ihr nicht vor. Zu den Sozialausgaben bemerkt sie, es gäbe in Deutschland "keinen starken Wohlfahrtsstaat". Im Ernst? Bei rund zwei Billionen Euro, die jährlich in diesen Sozialstaat fließen?
Wenn diese Summe nichts an der wachsenden sozialen Ungleichheit ändern kann, warum sollte es dann mit den 18 Milliarden für alle Deutschen zum 18. Geburtstag gelingen? Dem naheliegenden Einwand, ein Achtzehnjähriger verfüge wohl kaum über das Wissen, was man mit dem Geld sinnvoll anfangen sollte, begegnet Linartas mit dem Hinweis, dann müssten diese jungen Menschen in der Schule eben eine vernünftige Finanzbildung erwerben. Mal angenommen, das gelänge - auch dann bleibt diese Idee, als Staat Geldgeschenke zur völlig freien Verfügung zu verteilen, ein ultraliberaler Ansatz. Und das, nachdem Linartas zweihundert Seiten lang gegen den Neoliberalismus und seine Folgen gewettert hat.
Es ist absolut nichts einzuwenden gegen den moralischen Impetus von Linartas' Streitschrift. Ihre Empörung über die Vermögensverhältnisse in Deutschland ist glaubhaft und verdient eine öffentliche Würdigung und auch Wirkung. Ihre Herleitung der Ursachen dieser Ungleichheit ist lückenhaft, aber diese Lücken bringen ihre Argumentation nicht zum Einsturz. Das wirkliche Enttäuschende an ihrem Buch ist, dass es ein im Vergleich zur Stärke ihrer Empörung ziemlich schwaches Ergebnis hat. GERALD WAGNER
Martyna Linartas: "Unverdiente Ungleichheit". Wie der Weg aus der Erbengesellschaft gelingen kann.
Rowohlt Verlag, Hamburg 2025.
320 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Unverdiente Ungleichheit" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.