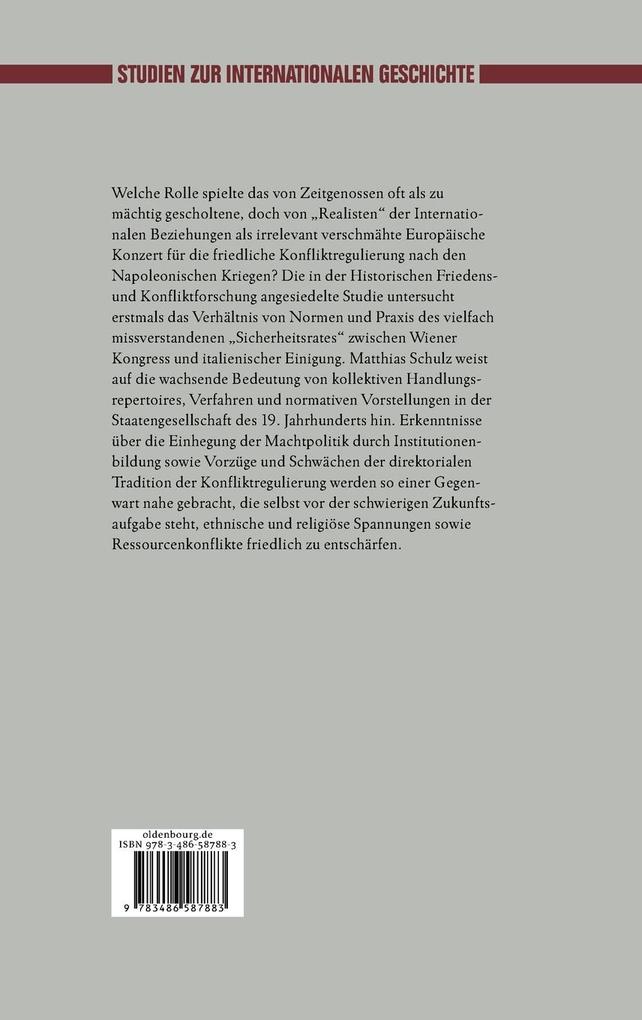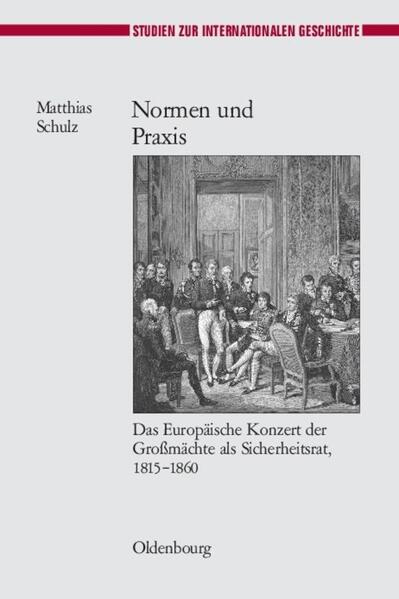
Zustellung: Di, 12.08. - Fr, 15.08.
Versand in 7 Tagen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Welche Rolle spielte das von Zeitgenossen oft als zu mächtig gescholtene, doch von "Realisten" der Internationalen Beziehungen als irrelevant verschmähte Europäische Konzert für die friedliche Konfliktregulierung nach den Napoleonischen Kriegen? Die in der Historischen Friedens- und Konfliktforschung angesiedelte Studie untersucht erstmals das Verhältnis von Normen und Praxis des vielfach missverstandenen Sicherheitsrates zwischen Wiener Kongress und italienischer Einigung. Matthias Schulz weist auf die wachsende Bedeutung von kollektiven Handlungsrepertoires, Verfahren und normativen Vorstellungen in der Staatengesellschaft des 19. Jahrhunderts hin. Erkenntnisse über die Einhegung der Machtpolitik durch Institutionenbildung sowie Vorzüge und Schwächen der direktorialen Tradition der Konfliktregulierung werden so einer Gegenwart nahe gebracht, die selbst vor der schwierigen Zukunftsaufgabe steht, ethnische und religiöse Spannungen sowie Ressourcenkonflikte friedlich zu entschärfen.
Inhaltsverzeichnis
1; Inhalt; 6
2; Vorwort; 12
3; Einleitung; 14
3. 1; 1. Eingrenzung des Themas; 15
3. 2; 2. Methodisch-theoretischer Ansatz; 17
3. 3; 3. Forschungsstand; 33
3. 4; 4. Quellenbasis; 42
3. 5; 5. Gliederung; 44
4; Teil A Formierung des Konzerts, Einübung einer Praxis der Konfliktregulierung; 46
4. 1; Kapitel I Entstehung einer internationalen Institution; 48
4. 1. 1; 1. Vom Bellizismus des 18. Jahrhunderts zum Konzertgedanken; 49
4. 1. 2; 2. Kooperative Hegemonie oder reformiertes Gleichgewicht? Rahmenbedingungen der Neuordnung von 1814/1815; 59
4. 1. 3; 3. Die Entstehung des Europäischen Konzerts: Friedensstrategien und Konzertideen von der antinapoleonischen Allianz bis zum Aachener Kongress; 67
4. 2; Kapitel II Unter antirevolutionärem Dogma: Das Kongress-System des Fürsten Metternich; 86
4. 2. 1; 1. Ein Normenkonflikt: Intervention versus Nichtintervention; 87
4. 2. 2; 2. Das Kongresssystem in der Praxis, 1820 23; 89
4. 2. 3; 18; 89
4. 2. 4; 3. Staatsidee und Völkerrecht; 100
4. 3; Kapitel III Umdeutung und Konsolidierung: Pragmatisch kontrollierter Wandel; 102
4. 3. 1; 1. Das Konzert und die Unabhängigkeit Griechenlands; 102
4. 3. 2; 2. Selbstbestimmung versus monarchische Souveränität: Das Revolutionsjahr 1830/1831 und die belgische Frage; 115
4. 3. 3; 3. Gleichgewicht und Stabilisierung des Osmanischen Reiches: Die ägyptische Krise; 127
4. 4; Kapitel IV Konservatismus versus Konstitutionalismus: Ideologische Spaltung und konservativer Machtmissbrauch; 141
4. 4. 1; 1. Völkerrechtsbruch und vergeblicher Protest: Die Annexion Krakaus durch die Habsburgermonarchie; 143
4. 4. 2; 2. Eine interne Angelegenheit: Der Sonderbundskrieg als Vorbote der großen Erschütterung; 147
4. 4. 3; 3. Zwischenergebnis; 155
5; Teil B Herausforderung und Verstetigung: Das Europäische Konzert und die großen Krisen; 158
5. 1; Kapitel I Krieg der Ideologien oder pragmatische Krisenbeherrschung? Die Herausforderungen des Nationalismus, 1848 1852; 160
5. 1. 1; 1. Konzertierungsversuche zur Krisenbeherrschung: Die Zügelung Frankreichs nach der Februarrevolution; 164
5. 1. 2; 2. Mediationsversuche und regionales Konzert in der italienischen Frage; 175
5. 1. 3; 3. Von der Mediation zum Konzert redivivus: Die schleswig-holsteinische Frage und der deutsch-dänische Krieg; 214
5. 1. 4; 4. Die deutsche Krise, der preußisch-habsburgische Konflikt und das Europäische Konzert; 265
5. 1. 5; 5. Die Wiederherstellung des französischen Kaisertums; 304
5. 1. 6; 6. Krisenbeherrschung und Konfliktlösung, 1848 1852; 306
5. 2; Kapitel II Eindämmung des Bären, Europäisierung der Orientalischen Frage: Die russische Herausforderung; 309
5. 2. 1; 1. Vom Mönchsgezänk zum Krimkrieg; 312
5. 2. 2; 2. Der russische Völkerrechtsbruch und die europäische Mediation; 321
5. 2. 3; 3. Der Eindämmungskrieg der Westmächte und das Bemühen um Einheit des Konzerts; 336
5. 2. 4; 4. Der Pariser Kongress182; 354
5. 2. 5; 5. Das Europäische Konzert während des Krimkrieges: zerstört, kontrollierend oder verdunkelt ? ; 361
5. 3; Kapitel III Nationale Selbstbestimmung gegen monarchische Rechte: Die Pariser Konferenzen, 1856 1859; 367
5. 3. 1; 1. Grenzregelungen im Orient; 370
5. 3. 2; 2. Friedensinszenierungen und diskursive Konfliktlösung: Der preußisch-schweizerische Disput um Neuenburg; 373
5. 3. 3; 3. Richtung nationale Selbstbestimmung? Die rumänische Frage auf den Pariser Konferenzen 1858/1859; 440
5. 4; Kapitel IV Krise in Mitteleuropa, Kontinuität im Orient; 456
5. 4. 1; 1. Krieg, Mediation oder Konferenz? Bemühungen um Konfliktregulierung vor dem Italienischen Krieg; 456
5. 4. 2; 2. Die Italienische Einigung und das Europäische Konzert; 509
5. 4. 3; 3. Humanitäre Intervention in Syrien; 537
5. 4. 4; 4. Ausblick; 545
6; Teil C Institutionalisierung und normativer Diskurs; 548
6. 1; Kapitel I Institutionelle Merkmale und Handlungsrepertoire des Europäischen Konzerts; 550
6. 1. 1; 1. Institutionelle Merkmale; 554
6. 1. 2; 2. Funktionen und Kompetenzen; 571
6. 1. 3; 3. Das Handlungsrepertoire des Europäischen Konzerts; 581
6. 2; Kapitel II Interventionsnormen und Normverletzungen; 590
6. 2. 1;
2; Vorwort; 12
3; Einleitung; 14
3. 1; 1. Eingrenzung des Themas; 15
3. 2; 2. Methodisch-theoretischer Ansatz; 17
3. 3; 3. Forschungsstand; 33
3. 4; 4. Quellenbasis; 42
3. 5; 5. Gliederung; 44
4; Teil A Formierung des Konzerts, Einübung einer Praxis der Konfliktregulierung; 46
4. 1; Kapitel I Entstehung einer internationalen Institution; 48
4. 1. 1; 1. Vom Bellizismus des 18. Jahrhunderts zum Konzertgedanken; 49
4. 1. 2; 2. Kooperative Hegemonie oder reformiertes Gleichgewicht? Rahmenbedingungen der Neuordnung von 1814/1815; 59
4. 1. 3; 3. Die Entstehung des Europäischen Konzerts: Friedensstrategien und Konzertideen von der antinapoleonischen Allianz bis zum Aachener Kongress; 67
4. 2; Kapitel II Unter antirevolutionärem Dogma: Das Kongress-System des Fürsten Metternich; 86
4. 2. 1; 1. Ein Normenkonflikt: Intervention versus Nichtintervention; 87
4. 2. 2; 2. Das Kongresssystem in der Praxis, 1820 23; 89
4. 2. 3; 18; 89
4. 2. 4; 3. Staatsidee und Völkerrecht; 100
4. 3; Kapitel III Umdeutung und Konsolidierung: Pragmatisch kontrollierter Wandel; 102
4. 3. 1; 1. Das Konzert und die Unabhängigkeit Griechenlands; 102
4. 3. 2; 2. Selbstbestimmung versus monarchische Souveränität: Das Revolutionsjahr 1830/1831 und die belgische Frage; 115
4. 3. 3; 3. Gleichgewicht und Stabilisierung des Osmanischen Reiches: Die ägyptische Krise; 127
4. 4; Kapitel IV Konservatismus versus Konstitutionalismus: Ideologische Spaltung und konservativer Machtmissbrauch; 141
4. 4. 1; 1. Völkerrechtsbruch und vergeblicher Protest: Die Annexion Krakaus durch die Habsburgermonarchie; 143
4. 4. 2; 2. Eine interne Angelegenheit: Der Sonderbundskrieg als Vorbote der großen Erschütterung; 147
4. 4. 3; 3. Zwischenergebnis; 155
5; Teil B Herausforderung und Verstetigung: Das Europäische Konzert und die großen Krisen; 158
5. 1; Kapitel I Krieg der Ideologien oder pragmatische Krisenbeherrschung? Die Herausforderungen des Nationalismus, 1848 1852; 160
5. 1. 1; 1. Konzertierungsversuche zur Krisenbeherrschung: Die Zügelung Frankreichs nach der Februarrevolution; 164
5. 1. 2; 2. Mediationsversuche und regionales Konzert in der italienischen Frage; 175
5. 1. 3; 3. Von der Mediation zum Konzert redivivus: Die schleswig-holsteinische Frage und der deutsch-dänische Krieg; 214
5. 1. 4; 4. Die deutsche Krise, der preußisch-habsburgische Konflikt und das Europäische Konzert; 265
5. 1. 5; 5. Die Wiederherstellung des französischen Kaisertums; 304
5. 1. 6; 6. Krisenbeherrschung und Konfliktlösung, 1848 1852; 306
5. 2; Kapitel II Eindämmung des Bären, Europäisierung der Orientalischen Frage: Die russische Herausforderung; 309
5. 2. 1; 1. Vom Mönchsgezänk zum Krimkrieg; 312
5. 2. 2; 2. Der russische Völkerrechtsbruch und die europäische Mediation; 321
5. 2. 3; 3. Der Eindämmungskrieg der Westmächte und das Bemühen um Einheit des Konzerts; 336
5. 2. 4; 4. Der Pariser Kongress182; 354
5. 2. 5; 5. Das Europäische Konzert während des Krimkrieges: zerstört, kontrollierend oder verdunkelt ? ; 361
5. 3; Kapitel III Nationale Selbstbestimmung gegen monarchische Rechte: Die Pariser Konferenzen, 1856 1859; 367
5. 3. 1; 1. Grenzregelungen im Orient; 370
5. 3. 2; 2. Friedensinszenierungen und diskursive Konfliktlösung: Der preußisch-schweizerische Disput um Neuenburg; 373
5. 3. 3; 3. Richtung nationale Selbstbestimmung? Die rumänische Frage auf den Pariser Konferenzen 1858/1859; 440
5. 4; Kapitel IV Krise in Mitteleuropa, Kontinuität im Orient; 456
5. 4. 1; 1. Krieg, Mediation oder Konferenz? Bemühungen um Konfliktregulierung vor dem Italienischen Krieg; 456
5. 4. 2; 2. Die Italienische Einigung und das Europäische Konzert; 509
5. 4. 3; 3. Humanitäre Intervention in Syrien; 537
5. 4. 4; 4. Ausblick; 545
6; Teil C Institutionalisierung und normativer Diskurs; 548
6. 1; Kapitel I Institutionelle Merkmale und Handlungsrepertoire des Europäischen Konzerts; 550
6. 1. 1; 1. Institutionelle Merkmale; 554
6. 1. 2; 2. Funktionen und Kompetenzen; 571
6. 1. 3; 3. Das Handlungsrepertoire des Europäischen Konzerts; 581
6. 2; Kapitel II Interventionsnormen und Normverletzungen; 590
6. 2. 1;
Produktdetails
Erscheinungsdatum
22. April 2009
Sprache
deutsch
Untertitel
Das Europäische Konzert der Großmächte als Sicherheitsrat, 1815-1860.
1. Auflage.
Auflage
1. Auflage
Seitenanzahl
744
Reihe
Studien zur Internationalen Geschichte
Autor/Autorin
Matthias Schulz
Verlag/Hersteller
Produktart
gebunden
Gewicht
1336 g
Größe (L/B/H)
246/165/46 mm
ISBN
9783486587883
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
"Weniger neue Erkenntnisse im Detail, als vielmehr ihre Einordnung in einen größeren Zusammenhang und die Konzentration auf die Frage nach dem normativen Wandel sowie die beharrliche Mühe um eine Klärung der Begrifflichkeiten machen den großen Wert dieser Studie aus.", "bildet die Studie von Matthias Schulz des Grundstock deutschsprachiger Forschungsliteratur, an dem für die Geschichte der Intertnationalen Beziehungen im 19 Jahrhundert nicht mehr vorbeizukommen ist." Eva Maria Werner, sehepunkte "inhaltlich ist dem Autor mit dieser Pionierstudie ohne Frage ein großer Wurf gelungen." Andreas Rose, H-Soz-u-Kult "This is a monumental book. It covers a very important part of European international history, and has a lot to tell for the times we live in" Harald Müller (Director, Peace Research Institute, Frankfurt/Main), International History Review "Die Studie zeigt wie hoch das Niveau der Forschungen zu den internationalen Beziehungen ist. Sie ist gründlich gearbeitet ( Archive in Frankfurt, Berlin, Wien und Paris wurden ausgewertet), sie ist ideen- und gedankenreich, zudem gut lesbar geschrieben und bereichert die Forschung um das Europäische Mächtekonzert. Ihr sei weite Verbreitung gewünscht." Philipp Menger, Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte, 19. Bd. 2009, Heft 2
Bewertungen
0 Bewertungen
Es wurden noch keine Bewertungen abgegeben. Schreiben Sie die erste Bewertung zu "Normen und Praxis" und helfen Sie damit anderen bei der Kaufentscheidung.