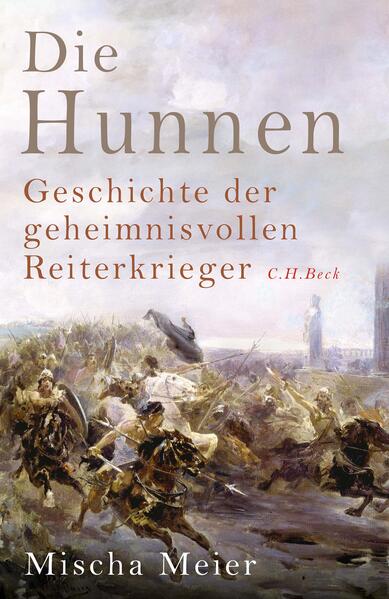Besprechung vom 04.07.2025
Besprechung vom 04.07.2025
Apokalyptische Reiter vom Rande Europas
Langer Nachhall einer kurzen Karriere als Konföderation von Räubern: Mischa Meier legt eine Geschichte der Hunnen vor.
Der Hunne ist kein Mitbürger. Er kommt aus dem Jenseits der Zivilisation, aus dem Chaos, das der gesetzlichen Ordnung vorausging, er bringt die überwundene Vorzeit in die Jetztzeit zurück. Sein Name genügt, um die Erinnerung an unausdenkliche Grausamkeiten aufzurufen, an Blutrausch und Goldgier, Leichenberge und Trinkbecher aus Totenschädeln. Als Bestien, als Teufel in Menschengestalt beschrieben schon die Römer der Spätantike ihre hunnischen Widersacher, und wer immer in späteren Jahrhunderten mit Beute machenden Reiterkriegern zu tun hatte, griff auf das Narrativ von den Schlächtern aus der Steppe zurück.
Als der deutsche Kaiser im Jahr 1900 bei einer Rede zur Einschiffung des Expeditionskorps zur Niederschlagung des Boxeraufstands in China nach einem Maßstab für rücksichtslose Grausamkeit suchte, fielen ihm Attilas Horden ein. "Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel", so sollten seine Soldaten in Fernost hausen, rief Wilhelm II. aus - und fügte damit dem deutschen Ansehen in der Welt den größten Schaden zu, den es vor Hitlers Machtantritt erleiden musste. "Huns" hießen die Deutschen fortan bei vielen Briten und Amerikanern, und im Ersten Weltkrieg wurde "Beat the Hun!" zur Parole der alliierten Kriegspropaganda. Dem Hunnen mit Pickelhaube war danach alles zuzutrauen, auch dass er belgische Mütter vergewaltigte und ihre Kinder mit dem Bajonett aufspießte.
Die Hunnen: Woher kamen sie, und wohin sind sie verschwunden? Der Tübinger Althistoriker Mischa Meier geht die Frage zunächst rezeptionsgeschichtlich an. Im siebten Jahrhundert, als der unaufhaltsam vordringende Islam das Oströmische Reich an den Rand des Untergangs drängte, wurden die längst verschwundenen Hunnen von zeitgenössischen Predigern rückwirkend ins christliche Heilsgeschehen einbezogen, als eine der vom Satan geschickten Plagen, die das Kommen des Antichrists und des Jüngsten Gerichts ankündigten. Den Grundton dieser apokalyptischen Lesart aber hatten schon zwei Jahrhunderte zuvor Autoren wie der römische Chronist Ammianus Marcellinus eingeführt, der die Steppenreiter als hässliche, unreinliche Gnome ohne Affektkontrolle und zugleich als formidable Krieger beschrieb, Über- und Untermenschen in einem.
"Wie Tiere, die keinen Verstand haben, kennen sie keinen Begriff von Ehre und Ehrlosigkeit", notierte Ammian, der wohl nie einen echten Hunnen gesehen, aber einige ihrer Kriegsgegner befragt hatte. Sie hatten ihm berichtet, wie hunnische Reiterscharen die römischen Heere aus der Ferne mit Pfeilen aus ihren Kompositbögen zusammenschossen, um anschließend die Überlebenden mit Lassos einzufangen und als Sklaven fortzuschleifen. In Ammians Schilderung verfestigten sich gleich zwei historische Mythen: Der eine handelt von der absoluten militärischen Überlegenheit der Hunnen, der andere von ihrer habituell bedingten Unfähigkeit zur Staatenbildung. Beide sind falsch, wenn auch in unterschiedlichen Graden.
Das zeigt Meier, indem er die Geschichte des Reitervolks von seinem ersten Auftauchen am Rande Europas bis zum Zerfall seiner Machtkonzentration im Donaubecken rekapituliert - eine Geschichte, die kaum mehr als ein Dreivierteljahrhundert umspannt. Ursprünglich aus Innerasien stammend, wo seine Herkunft von Forschern mit dem Steppenreich der Xiongnu in Verbindung gebracht wird, die in chinesischen Schriften auch als "Xwn" und in Sanskrit-Texten als "Huna" erscheinen, zerstörten die Hunnen um 370 nach Christus zunächst das Fürstentum der iranischstämmigen Alanen am Schwarzen Meer und stürzten sich dann auf die gotischen Greutungen in der Südwestukraine und anschließend auf deren Nachbarvolk, die Terwingen, die nördlich der Donau im heutigen Rumänien siedelten. Letztere drängten daraufhin schutzsuchend ins Römische Reich, wo sie im Jahr 378 gemeinsam mit anderen Flüchtlingsgruppen das Heer des Ostkaisers Valens bei Adrianopel vernichteten. Für die Mehrzahl moderner Historiker markiert dieses Datum den Beginn der spätantiken Völkerwanderung.
Wenig später zeigten sich auch hunnische Scharen erstmals auf römischem Gebiet. 395 drangen sie durch den Kaukasus raubend und plündernd nach Kleinasien und Nordsyrien vor, und zehn Jahre später erschienen sie gar vor Florenz - allerdings nicht als Invasoren, sondern als Hilfstruppen des römischen Feldherrn Stilicho, der durch ihren Einsatz ein nach Italien eingedrungenes Gotenheer vernichten konnte. Diese Doppelgesichtigkeit ist nach Meier ein Grundmuster der römisch-hunnischen Beziehungen und zugleich ein Spiegel der Zweiteilung der Imperiums. Denn während weströmische Heermeister gern hunnische Kavallerie bei ihren Feldzügen einsetzten - nach Stilicho vor allem Aëtius, dessen Hunnenreiter um 436 das im Nibelungenlied verewigte Burgunderreich von Worms auslöschten -, war der oströmische Reichsteil für die Krieger und ihre Verbündeten vor allem ein Schauplatz für Beutezüge und eine Quelle von Tributen, die in Tonnen von Gold bezahlt wurden.
Das änderte sich erst unter der Herrschaft Attilas, des sechsten historisch belegten Hunnenherrschers, der um 444 seinen Bruder Bleda tötete und seither allein regierte. Attila hatte, wie Meier anschaulich darlegt, das Strukturgesetz des Machtgebildes, das er leitete, begriffen und daraus die Konsequenz gezogen. An der Spitze des mobilen Beuteverbands, in dem unter hunnischer Kuratel zahlreiche unterworfene Völker mitzogen, konnte sich nur ein Anführer halten, der die Kriegerscharen mit immer neuen erpressten oder geraubten Reichtümern versorgte - oder ihnen dauerhaften Landbesitz verschaffte. Aber um die Mitte des fünften Jahrhunderts war der römische Balkan nach mehreren verheerenden Beutezügen ausgeblutet, und an den Mauern Konstantinopels brach sich die hunnische Reiterflut. Attila blieb nur die Option der Landnahme - und damit der Weg nach Westen.
Den Vorwand für seine Invasion im Jahr 451 lieferte ihm die weströmische Prinzessin Honoria, eine Schwester Valentinians III. Wegen einer verbotenen Liebesaffäre eingekerkert, bot sie Attila ihre Hand an, um ihre Ansprüche auf den Thron des kinderlosen Kaisers zu wahren. Der Hunnenfürst griff zu: Nachdem Honoria in Ravenna mit einem Senator zwangsverheiratet worden war, mobilisierte er seine Reiterarmee. Allerdings stieß er dabei auf Aëtius, den allmächtigen Heermeister des sterbenden Westreichs, der seinerseits ein Zweckbündnis aus Römern, Franken und Westgoten gegen seine früheren hunnischen Verbündeten zusammengetrommelt hatte. Auf den Katalaunischen Feldern trafen die Kriegermassen im Juni 451 aufeinander, und obwohl das Gemetzel unentschieden ausging, besiegelte es Attilas Niederlage: Sein Heer musste umkehren, die Landnahme in Gallien fand nicht statt. Im Jahr darauf versuchte er es in Italien, aber dort zwangen ihn die Fiebersümpfe und abgeernteten Felder der Poebene (und nicht, wie es die Kirchengeschichte will, Papst Leo I.) zum Rückzug. Seine Vision war gescheitert, noch ehe er 453 in der Hochzeitsnacht mit seiner letzten Ehefrau, der Germanin Ildiko, starb.
Mischa Meier schildert die kurze Hochblüte und das plötzliche Ende des Hunnenreiches, das nach Attilas Tod binnen dreier Jahre zerfiel, mit einem ebenso leidenschaftlich interessierten wie analytisch durchdringenden Blick. Neben Ammian und den oströmischen Historikern Orosius und Zosimos stützt sich seine Darstellung vor allem auf den Reisebericht des Diplomaten Priskos, der im Jahr 449 an einer Gesandtschaft an den Hof Attilas teilnahm. Darin zollt der Reisende seinen Gastgebern durchaus Respekt, indem er etwa die ostentative Bescheidenheit des Hunnenherrschers betont oder einem griechischen Händler, der ihn vor Attilas Palast anspricht, ein Loblied auf die von Steuerlasten und Verboten freie hunnische Lebensweise in den Mund legt.
Der Historiker Meier aber liest aus den Details des Berichts noch etwas anderes heraus: den Beginn des Transformationsprozesses, mit dem Attila sein mobiles Heerkönigtum in eine stabile Erbmonarchie überführen wollte. Dass dieser Plan scheiterte, lag an äußeren wie inneren Faktoren, am Ende aber vor allem daran, dass es eine hunnische Identität nach dem Muster der römischen nicht gab. Die Hunnen waren eine Räuberkonföderation, die zusammenhielt, solange materielle Gewinne winkten, und zerstob, als das Geschäftsmodell nicht mehr funktionierte. Nach Attilas Abgang zogen Horden führerloser Reiterkrieger durch Ost- und Südeuropa, traten in die Dienste wechselnder Gewaltunternehmer oder schlossen sich siegreichen Ethnien wie den Langobarden oder Awaren an. Das Oströmische Reich konnte diesen Ansturm absorbieren, die Westhälfte brach binnen weniger Jahre wie ein Kartenhaus zusammen.
Das alles ist lange her, aber darum noch längst nicht vergangen. Daran erinnert Mischa Meier, wenn er im Vorwort die russischen Gräueltaten in der Ukraine und den Terror der Hamas am 7. Oktober als Beispiele für Auslöser kollektiver Traumata aufruft. In einem späteren Kapitel spricht er gar von "putinesker Menschenverachtung". Damit meint er allerdings kein hunnisches, sondern römisches Verhalten. Denn das Imperium, das doch seit Konstantin ein christliches war, griff seinerzeit immer häufiger zum Mittel des Auftragsmordes, wenn es darum ging, politische Gegner auszuschalten. Merke: Wer die Barbarei ausmerzen will, hat sie oft selbst im Blut. Die Hunnen jedenfalls sind nie ganz aus der Geschichte verschwunden: Sie schwirren immer noch in unseren Köpfen herum. ANDREAS KILB
Mischa Meier: "Die Hunnen". Geschichte der geheimnisvollen Reiterkrieger.
C.H. Beck Verlag, München 2025. 534 S., Abb., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.