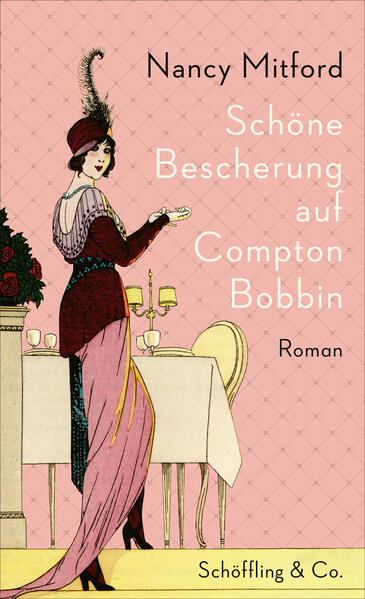
Zustellung: Sa, 14.06. - Fr, 20.06.
Versand in 4 Wochen
VersandkostenfreiBestellen & in Filiale abholen:
Köstlich amüsant und very British: eine elegante Weihnachtsgesellschaft auf dem Land endet im Fiasko. Nancy Mitfords zweiter Roman, erstmals 1932 veröffentlicht, ist ein köstlich amüsanter Ausflug in die Welt der Reichen und (nicht immer) Schönen. @font-face
{font-family:" Cambria Math" ;
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;
mso-font-charset:0;
mso-generic-font-family:roman;
mso-font-pitch:variable;
mso-font-signature:3 0 0 0 1 0}p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal
{mso-style-unhide:no;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:" " ;
margin:0cm;
margin-bottom:. 0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:12. 0pt;
font-family:" Times New Roman" , serif;
mso-fareast-font-family:" Times New Roman"}. MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
mso-default-props:yes;
font-family:" Arial" , sans-serif;
mso-ascii-font-family:Arial;
mso-fareast-font-family:Calibri;
mso-fareast-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Arial;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-fareast-language:EN-US}div. WordSection1
{page:WordSection1}
Der Schriftsteller Paul Fotheringay kann es nicht fassen: Nicht genug, dass ihn seine Angebetete Marcella verschmäht. Sein tödlich ernstes Romandebüt wird von der Presse als das lustigste Buch des Jahres gefeiert. Um zumindest seinen literarischen Ruf wiederherzustellen, recherchiert er für eine Biografie über die viktorianische Schriftstellerin Mary Bobbin und schleicht sich auf Compton Bobbin, dem Anwesen ihrer jagdbesessenen Nachfahrin, ein. Lady Bobbin organisiert dort eine Weihnachtsfeier mit wild zusammengewürfelten Gästen: Es treffen u. a. ihre rebellische Tochter Philadelphia, deren Schar an Verehrern und eine Horde ungezogener Kinder aufeinander. Und dann ist da noch Pauls Bekannte, die schöne Ex-Kurtisane Amabelle Fortescue, die ihre Feiertage zufällig in einem nahegelegenen Cottage verbringt . . .
Je deutlicher wird, wie wenig die Gäste der Weihnachtsgesellschaft zusammenpassen, desto vergnüglicher die Lektüre: Nancy Mitfords zweiter Roman, erstmals 1932 veröffentlicht, ist ein köstlich amüsanter Ausflug in die Welt der Reichen und (nicht immer) Schönen. Mitfords bissiger Humor und Sinn für Situationskomik lässt kein Auge trocken.
Produktdetails
Erscheinungsdatum
17. September 2024
Sprache
deutsch
Seitenanzahl
240
Autor/Autorin
Nancy Mitford
Übersetzung
Eva Regul
Verlag/Hersteller
Originaltitel
Originalsprache
englisch
Produktart
gebunden
Gewicht
315 g
Größe (L/B/H)
209/135/21 mm
ISBN
9783895611445
Entdecken Sie mehr
Pressestimmen
»Laut ihrer Schwester Jessica verbrachte Nancy Mitford Monate damit, »vor sich hin kichernd am Kamin zu sitzen«, während sie ihren ersten Roman schrieb. Er ist das perfekte Feiertagsschmankerl. « Rachel Cooke / The Guardian
»Lesen Sie das Buch auf Ex, dann steigt das Prickeln direkt zu Kopf. « Rachel Cooke / The Guardian
»Sehr lebendig. . . Vergnügliche Streiche und Schwindeleien. « The New York Times
»Nancy Mitfords Geschichten über den verruchten Glamour der Oberen Zehntausend sind ebenso bissig wie scharfsinnig. « Elizabeth Lowry / The Wallstreet Journal
»Einfach herrlich! « Daily Mail
»Ein schillerndes, irre komisches Vergnügen. « The Times
»Unwiderstehlich komisch. « Spectator
»Schöne Bescherung auf Compton Bobbin ist im besten Sinne das, was man eine vergnügliche Lektüre nennt [ ] Eine Wiederentdeckung, die Spaß macht. « Theresa Schäfer / Stuttgarter Zeitung
»Bietet alles, was die Lachmuskeln in Bewegung versetzen kann. « Barbara Pfeiffer / Kulturbowle
»Immer wieder tauchen in all den ironischen Wendungen der Compton-Bobbin-Geschichte verblüffend ernste und tiefsinnige Reflexionen über die Liebe auf. « Peter Meisenberg / WDR 3
»Geistreich! « Thomas Schürmann / HÖRZU
»Mitford schreibt eine zeitlose Parodie auf den verblassten Pomp eines Adelshauses, entlarvt messerscharf die Geheimnisse von Beziehungskisten. Schön bissig. « Jan Sting / Kölnische Rundschau
»Schöne Bescherung ist ein Sittenroman, der unter der englischen Upper Class spielt, er ist scharf beobachtet, witzig geschrieben. « Sylvia Staude / Frankfurter Rundschau
 Besprechung vom 10.12.2024
Besprechung vom 10.12.2024
Diese Adligen haben alle einen schweren Zacken
Nancy Mitfords erster Roman, "Christmas Pudding" aus dem Jahr 1932, erscheint endlich auf Deutsch: als "Schöne Bescherung".
Welcher aufstrebende Autor wäre nicht beglückt, wenn sein Erstlingsroman als die amüsanteste Neuerscheinung seit Monaten gefeiert wird? Paul Fotheringay freut sich darüber aber nicht im Geringsten. Der ehemalige Eton-Schüler, der in der dekadenten aristokratischen Boheme der Zwischenkriegsjahre verkehrt und reguläre Arbeit ungeachtet seiner beschränkten finanziellen Verhältnisse für einen hassenswerten Zeitvertreib hält, ist am Boden zerstört, dass "Kuriose Kapriolen" bei seinen Freunden in der Londoner Gesellschaft und bei der Kritik für so viel Erheiterung sorgt. Hatte er mit seinem Hang zur selbstmitleidigen Melodramatik das Buch doch als "entsetzliche Tragödie" intendiert. Beim Schreiben waren ihm vor lauter Rührung sogar Tränen die Wangen heruntergelaufen. Fotheringay ist eine von sechzehn Figuren, die Nancy Mitford im Prolog zu ihrer possenhaften Gesellschaftskomödie "Schöne Bescherung" als "auf der Suche nach einem Autor" einführt. Sein Ehrgeiz, sich nach der demütigenden Rezeption des Romans mit einer Biographie als ernsthafter Schriftsteller zu etablieren, liefert die Grundzüge der Handlung. Als Sujet wählt der romantisch geneigte Ästhet die Dichterin Maria Bobbin, die zu viktorianischer Zeit schrieb und deren Tagebücher, wie Fotheringay aus einem Lexikon erfährt, noch auf dem Landsitz Compton Bobbin bewahrt werden, auf dem sie mit ihrem gefräßigen Mann und zwölf Kindern lebte.
Maria Bobbins verwitwete Schwiegertochter, eine fuchsjagdbesessene Kulturbanausin, die, las Lady Bobbin, nun den Besitz mit harter Hand führt, hält die duftigen Formulierungen, mit denen Fotheringay sie bittet, den Nachlass einsehen zu dürfen, für das Ansinnen eines Bekloppten, und lehnt brüsk ab. Mithilfe seiner gut vernetzten Freundin Amabelle Fortescue, einer ehemaligen Kurtisane, die den Durchbruch aus der Halbwelt in die hohe Gesellschaft geschafft hat, gelingt es Fotheringay dank eines listigen Komplotts aber doch, Zugang zum Archiv zu bekommen. Er schleicht sich in Compton Bobbin in der Tarnung eines Hauslehrers ein, der Sir Roderick Bobbin, genannt "Bobby", den nichtsnutzigen Sohn von Lady Bobbin, deren Wunsch entsprechend durch Reiten, Jagen, Golf und frische Luft für die Aufnahme in der Militärakademie von Sandhurst trimmen soll, obwohl der Eton-Schüler sportliche Betätigungen auf Partys und den Bridgetisch beschränkt und ein Studium in Oxford vorzöge.
"Schöne Bescherung" war der zweite Roman der ältesten der sechs adligen Mitford-Schwestern, die mit ihrer Schönheit, ihrer Exzentrik, ihrem scharfen Witz und ihrer schwärmerischen Begeisterung für die extremen Ränder der Politik der Dreißigerjahre Furore machten. Unity Mitford, die Hitler anhimmelte, schoss sich am Tag der britischen Kriegserklärung gegen Deutschland eine Kugel in den Kopf, lebte aber noch fast zehn Jahre körperlich stark beeinträchtigt weiter. Diana Mitford heiratete im Haus von Joseph Goebbels und in Anwesenheit Hitlers den britischen Faschistenführer Oswald Mosley und zeigte bis zu ihrem Tod im Jahr 2003 keinerlei Reue für ihre NS-Sympathien, weil alles doch so interessant gewesen sei. Dagegen engagierte sich Jessica, die Zweitjüngste, auch aus Protest gegen ihre Familie schon früh für den Kommunismus und blieb ihm treu, ohne sich allerdings von den Eigenarten ihrer adligen Herkunft loszusagen.
Auf Englisch heißt der 1932 erschienene Roman, der jetzt erstmals ins Deutsche übersetzt wurde, "Christmas Pudding". Dessen Figuren sind in der Tat die Zutaten für einen literarischen Dampfpudding, den Nancy Mitford in der Form der Eskapaden einer weihnachtlichen Gesellschaft auf dem Lande hier zusammenrührt, um dann sich mit spitzzüngigem Humor über die Sitten und Faibles der Bobbys, Chickies, Bunchs, Biggis und Delphies lustigzumachen - oder wie die dort versammelten Exemplare britischer Aristokraten sonst noch alle mit Kosenamen heißen. Von dieser verniedlichenden Gewohnheit abgesehen, macht sich Mitford außerdem nach dem Vorbild von Charles Dickens den Spaß, ihre Figuren mit seltsamen Namen zu versehen, um deren Absurditäten zu beleuchten.
So erfindet sie nicht nur die Bobbins, sondern auch Squibby Almanack, einen von drei jungen, die klassische Musik liebenden Freunden mit beginnender Glatze, die ihrer weiblichen Begleitung den Laufpass geben, wenn sie im Konzert gähnen oder zappeln. Dann gibt es noch die dreimal verheiratete Herzogin von St Neots, die trotz fortgeschrittenem Alter das Begehren nach jungen Männern nicht verloren hat, sowie die beiden den Jugendbuchklassikern von A. A. Milne und J. M. Barrie entnommenen Kinder Christopher Robin und Wendy. Der Junge reißt am Weihnachtsmorgen die Hausgäste der Reihe nach aus dem Schlaf, um ihnen jeweils ein Schokoladenbaby abzuluchsen, weil die Gastgeberin vergessen habe, eines in seinen Strumpf zu legen. Und das Mädchen besitzt die seltsame Gewohnheit, in den Geburtsanzeigen der "Times" nach Totgeburten zu suchen und diese in einem Notizbuch zu registrieren. Mit der Benennung Paul Fotheringays nach dem Schloss, in dem Maria Stuart nach langer Gefangenschaft geköpft wurde, suggeriert Nancy Mitford wiederum das vergangenheitsverliebte Temperament des Literaten.
Bei der Charakterisierung ihrer Figuren schöpft sie - wie auch in den späteren, stark autobiographischen Romanen, allen voran "The Pursuit of Love" ("Englische Liebschaften"), die sie berühmt machen sollten - aus dem eigenen Leben. Viele Personen der Handlung tragen erkennbar Züge von Verwandten und Bekannten. Während Nancy Mitford noch an dem Buch arbeitete, verriet sie einem Freund, dass John Betjeman, ein leidenschaftlicher Anhänger des Viktorianismus, das Modell für Paul Fotheringay abgab. Mitford nahm den späteren Hofdichter auf die Schippe, indem sie Paul so zeichnete, dass er vor lauter Begeisterung für die Dichterin Maria Bobbin nicht zu erkennen vermag, wie grauenvoll die frömmelnde Sentimentalität ihrer Schriften ist. Für Bobby Bobbin stand Hamish St Clair Erskine Modell, der zwar kluge schwule, aber unendlich eitle Sohn des Grafen von Rosslyn, in den Nancy Mitford fünf Jahre lang derart unglücklich verliebt war, dass sie einen halbherzigen Selbstmordversuch unternahm - in einem Brief erzählt sie mit charakteristischer Nonchalance, wie sie dazu den Kopf in den Gasofen gesteckt habe: Es sei ein schönes Gefühl gewesen, wie ein Betäubungsmittel, doch dann sei ihr bewusst geworden, dass ihre schwangere Gastgeberin vor lauter Schreck eine Fehlgeburt erleiden könnte, und so sei sie wieder zu Bett gegangen.
In der protonazistischen Lady Bobbin, die Katholiken hasst und bei jeder Widrigkeit des Lebens eine bolschewistische Verschwörung wittert, spiegeln sich Eigenschaften beider Mitford- Eltern. Und auf die 21 Jahre alte Tochter Philadelphia projiziert die Autorin den Frust über die Beschränkungen ihrer eigenen Erziehung. Wie Mitford selbst verübelt ihre Romanfigur der Mutter unter anderem, dass sie wegen deren Abneigung gegen Mädchenschulen von einer Gouvernante unterrichtet wurde. Die ihr Zuhause als Gefängnis empfindende Philadelphia hofft, dass der Tod weniger langweilig sein werde als das Leben. Das klingt wie ein Echo der Klage ihrer Schöpferin: "Mein Leben ist langweilig, ich wäre so viel lieber tot."
Eher, als nach einem Autor zu suchen, trachten die Figuren von "Schöne Bescherung" nach Liebe und einer guten Partie. Diese beiden Kriterien sind im zynischen Ermessen Amabelle Fortescues unvereinbar. Sie predigt, dass verliebt zu sein ein sehr guter Grund sei, nicht zu heiraten; die Wahl zwischen Opportunität und Gefühl stehe im Zentrum aller Beziehungsdramen. Nancy Mitford stattet diese gestandene Frau mit jenem spöttischen Ton aus, den sie sich selbst angeeignet hatte, um Tiefschläge des Lebens nach der Devise zu überspielen, dass man wenigstens amüsant sein müsse, wenn man schon nicht glücklich sei. Das verleiht dem launigen Geplauder freilich ein unterschwelliges Pathos.
"Schöne Bescherung" bietet bereits die Keime von Mitfords späteren Erfolgen. Vieles wirkt heute aber veraltet, auch das unbefangene Reden, das die Woke-Kultur nicht goutieren dürfte. Einige Begriffe wie etwa das N-Wort sind in Eva Reguls getreuer Übersetzung denn auch neutralisiert worden. Der zeitliche Abstand zu seiner Entstehung hat dem Buch den eskapistischen Unterhaltungscharakter von Fernsehserien wie "Downton Abbey" verschafft, wobei hier das Dienstpersonal oder überhaupt "untere Schichten" nie in Erscheinung treten.
Evelyn Waugh fand, dass der Reiz von Nancy Mitfords Stil in ihrer Weigerung liege, sich zwischen mädchenhaftem Geschnatter und literarischer Sprache zu entscheiden. Sie selbst hätte sich womöglich einen Rezensenten gewünscht, wie sie ihn für Paul Fotheringays "Kuriose Kapriolen" erfunden hat: einen, der sich an die lustigsten Szenen bei P. G. Wodehouse und hier und da an die zynischsten von Evelyn Waugh erinnert fühlt und dennoch eine "verblüffende Originalität" ausmacht. "Kuriose Kapriolen" wäre kein schlechter Titel für "Schöne Bescherung" gewesen. GINA THOMAS
Nancy Mitford: "Schöne Bescherung auf Compton Bobbin". Roman.
Aus dem Englischen von Eva Regul. Schöffling & Co., Frankfurt am Main 2024. 237 S., geb.
Alle Rechte vorbehalten. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt am Main.Bewertungen
LovelyBooks-Bewertung am 30.12.2024
Kurzweilige, humorvolle Geschichte aus & über die britische High Society.
am 08.11.2024
Ein hochherrschaftliches Weihnachtsfest voll bissigen Humors und Situationskomik
"Schöne Bescherung auf Compton Bobbin" von Nancy Mitford erschien erstmals 1932 (Originaltitel Christmas Pudding); in deutscher Übersetzung wurde der Roman nun erstmals bei Schöffling & Co. (HC, geb., 233 S.) 2024 in Übersetzung aus dem Englischen von Vera Regul veröffentlicht. Da ich eine andere Buchreihe über die Mitford-Schwestern gelesen habe, war hier mein Interesse geweckt. Nancy Mitford (1904-1973) war die älteste von 6 Schwestern, die der Ehe des 2. Baron Redesdale und Sydney Bowles entstammte. Im Gegensatz zu einigen ihrer berühmten Schwestern stand sie dem Faschismus kritisch gegenüber und stellte sich in den Dienst ihres Landes, was sie mir um einiges sympathischer erscheinen lässt als z.B. Unity Mitford, die als Hitler-Anhängerin galt und sich in dessen Umfeld gerne aufhielt.
Der Gesellschaftsroman von Nancy Mitford, der um die Weihnachtszeit und an den Weihnachtstagen vermutlich Ende der 20er Jahre spielt, nimmt den Leser mit in die schönen Cotswolds, wo Amabelle Fortescue, Ex-Kurtisane und Freundin von Paul Fotheringay, Walter und Sally Montheath, Jerome Field, Michael Lewes (um nur einige zu nennen) ein Cottage namens Mulberry Farm anmietet, um die Weihnachtszeit und den Beginn des Neuen Jahres dort mit ihren Freunden zu verbringen. Das Haus ist in der Nähe von Compton Bobbin gelegen, in dem Lady Bobbin, Mutter von Roderick (Bobby) und Philadelphia Bobbin, das Regiment nach dem Tod ihres Mannes führt. Sie liebt einzig ihre Hundemeute, ist tieftraurig, dass sie wegen einer Maul- und Klauenseuche nicht wie gewohnt zur Jagd gehen kann und schart wie an jedem Weihnachtsfest den Clan der Bobbins um sich, um die Feiertage möglichst fröhlich mit ihnen zu verbringen (was allerdings nicht immer gelingt, was an den zusammengewürfelten, unterschiedlichen Gästen liegen mag). Da sie jedoch die Kosten in einem gewissen Rahmen halten muss, entfallen das Feuerwerk an Silvester und der Champagner: Stattdessen gibt es Bier und Cidre (bis auf die Ausnahme eines kleinen erwählten Kreises, die sich auch in Bobbys Zimmer diverser Cocktails erfreuen können; was auch gerne in Anspruch genommen wird. So nimmt man mit dem Bobbin Clan und im Cottage bei Amabelle Fortescue an den Bräuchen an den Weihnachtstagen teil: Lady Bobbin liebt alle südenglischen und auch deutschen Bräuche, die immer in Anwendung kommen; bei Amabelle geht es lustig zu, denn hier treffen sich (zu Spielen und Gesprächen mit diversen Drinks) Bobby und sein "Hauslehrer" Paul Fotheringay alias Paul Fisher:
Dieser hat sein Début veröffentlicht, das auch vielgelobt wird - allerdings ganz anders, als der Autor sich dies vorstellte: Sein Werk (Kuriose Kapriolen) war durchaus ernst gedacht, wird jedoch als Schmunzellektüre bei den LeserInnen verbucht, was Paul sehr kränkt. Als Amabelle ihm rät, eine Biografie zu schreiben, fragt er bei Lady Bobbin an, da er die Tagebücher der Vorfahrin und Dichterin Lady Maria Bobbin lesen wolle (über sie gab es bis dato sehr wenig). Da dieses Ansinnen jedoch nicht auf Gegenliebe stößt, müssen sich Amabelle, Bobby und Paul etwas anderes ausdenken....
Wovon Lady Bobbin nicht die geringste Ahnung hat und so nehmen viele skurrile und mit sehr britischem Humor versehene Begegnungen zu Weihnachten ihren (oft unvorhergesehenen) Lauf: Wir erleben Paul zu Pferd, lauschen manchem Heiratsantrag und sind erstaunt, dass eine der HauptprotagonistInnen selbst letztendlich (nochmal) ans Heiraten denkt. Diese lustigen Episoden bringen immer wieder in den Dialogen einen sehr humorvollen, aber auch hinterfragenden Kontext, der den Leser schmunzeln lässt. Manches fand ich einfach nur köstlich zu lesen und sehr authentisch für die englische Welt der Adligen um diese Zeit, die langsam dem Untergang geweiht war; anderes machte mich auch betroffen, da die Dekadenz so mancher Zeitgenossen nicht zu übersehen bzw. zu überlesen war. Der Ton Nancy Mitfords und ihr Schreibstil gefielen mir sehr, da zwischen den Zeilen eine kritische Autorin nie zu vermissen war und vieles bewusst noch etwas überzeichnet dargestellt wurde.
Fazit:
Scharfzüngig und entlarvend nimmt Nancy Mitford, selbst diesem gesellschaftlichen Stand angehörend, die britische Upper Class der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts mit Hilfe des "Bobbin Clans", die sich zu jedem Weihnachtsfest auf Compton Bobbin trifft, gekonnt auf die Schippe; an bissigem Humor und einer köstlichen Portion Situationskomik fehlte es ihr nicht. Voller Lokalkolorit und historischer Authentizität, einigen schrägen (wenn auch adeligen) Charakteren gereicht der Roman besonders in der kommenden Advents- und Weihnachtszeit mit einem Augenzwinkern zu meinen persönlichen Empfehlungen. 4*









